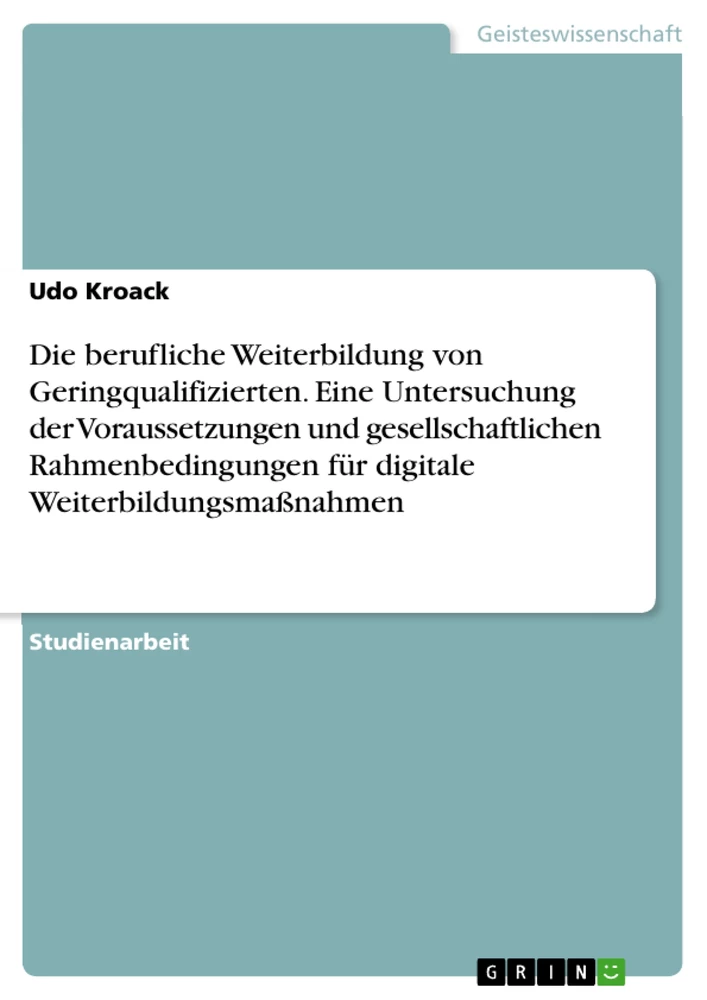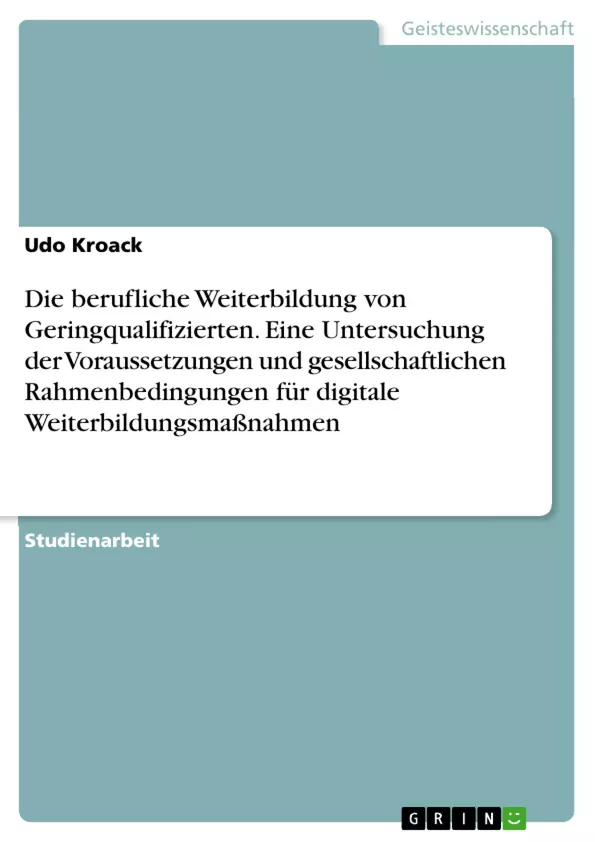Seit Ende der 1960er Jahre vollzieht sich ein Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft, verbunden mit einer steigenden Digitalisierung und Globalisierung in der Arbeitswelt. Im Zuge dieser Veränderungen tendiert die Arbeitskräftenachfrage in Richtung einer Höherqualifizierung. Gleichzeitig wird sich durch den demographischen Wandel die Struktur der Gesellschaft deutlich verändern. Die Sicherung des Fachkräftebedarfs stellt eine zentrale politische Herausforderung dar, die die Notwendigkeit nach sich zieht, alle Potenziale auszuschöpfen.
Vor diesem Hintergrund wird dem lebenslangen Lernen und der beruflichen Weiterbildung eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, aber auch der Chancengleichheit und der sozialen Teilhabe zugeschrieben. Berufliche Weiterbildung soll Versäumnisse in früheren Bildungsphasen kompensieren, um Zugang zu existenzsichernder Arbeit und sozialer Integration zu gewähren.
In dieser Arbeit soll untersucht werden, inwieweit Weiterbildung diesen hohen Erwartungen gerecht werden kann. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass gerade die Zielgruppe der formal gering Qualifizierten bei der Weiterbildungsbeteiligung stark unterrepräsentiert ist. Um die Ursachen für dieses Phänomen eruieren zu können, wird ein genauerer Blick auf die Merkmale der Gruppe von formal gering Qualifizierten und ihre Situation am Arbeitsmarkt geworfen. Im Anschluss wird die Ungleichheit in der Weiterbildungsteilnahme unter Berücksichtigung von soziodemographischen Faktoren genauer beleuchtet. Es soll untersucht werden, ob der Einsatz von digitalen Medien diese hinderlichen Faktoren abschwächen oder verhindern kann.
Der Fokus soll aber nicht auf einzelnen Instrumenten des E-Learning liegen, sondern vielmehr darauf, ob die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen innerhalb der Zielgruppe geeignet sind, diese neuen Lernformen erfolgreich einsetzen zu können. Hierzu werden die Bildungsvoraussetzungen der gering Qualifizierten beschrieben, um danach auch einen soziologischen Blick auf die unterschiedlichen Einstellungen bestimmter gesellschaftlicher Schichten gegenüber Bildungzu werfen. Es werden Ansatzpunkte zur Verbesserung der Situation schlussgefolgert und exemplarisch bereits initiierte Maßnahmen und Projekte vorgestellt sowie Vorschläge eingebracht, den Ursachen für die Weiterbildungsabstinenz zu begegnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Zielgruppe „gering Qualifizierte“
- Merkmale der Zielgruppe „gering Qualifizierte“
- Arbeitsmarktsituation der gering Qualifizierten
- Soziale Ungleichheiten bei der Teilnahme an beruflicher Weiterbildung
- Beschreibung der Disparitäten anhand soziodemographischer Faktoren
- Hemmende Faktoren bei formal gering Qualifizierten
- Digitale Medien – eine „Wunderwaffe“ zur Weiterbildung von Geringqualifizierten im quartären Sektor?
- Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für digitale Weiterbildungsangebote
- Soziologische Aspekte
- Ansatzpunkte zur Einbeziehung weiterbildungsabstinenter Gruppen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Voraussetzungen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die berufliche Weiterbildung von Geringqualifizierten. Sie untersucht, inwieweit berufliche Weiterbildung den hohen Erwartungen gerecht werden kann, die an sie gestellt werden, um die Beschäftigungsfähigkeit, Chancengleichheit und soziale Teilhabe der Zielgruppe zu fördern.
- Merkmale und Arbeitsmarktsituation von Geringqualifizierten
- Soziale Ungleichheiten in der Weiterbildungsteilnahme
- Hemmende Faktoren für die Weiterbildungsteilnahme von Geringqualifizierten
- Potenzial digitaler Medien für die Weiterbildung von Geringqualifizierten
- Ansatzpunkte zur Einbeziehung weiterbildungsabstinenter Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft dar und beleuchtet die Bedeutung von lebenslangem Lernen und beruflicher Weiterbildung für die Beschäftigungsfähigkeit und soziale Teilhabe. Sie hebt die Unterrepräsentanz von Geringqualifizierten in der Weiterbildungsbeteiligung hervor.
- Die Zielgruppe „gering Qualifizierte“: Dieses Kapitel definiert die Zielgruppe und beleuchtet ihre Merkmale sowie ihre Arbeitsmarktsituation. Es werden verschiedene Definitionen und Begrifflichkeiten aus der Literatur und Arbeitsmarktpolitik diskutiert.
- Soziale Ungleichheiten bei der Teilnahme an beruflicher Weiterbildung: Dieses Kapitel analysiert die Ungleichheiten in der Weiterbildungsteilnahme unter Berücksichtigung von soziodemographischen Faktoren anhand des Adult Education Survey 2012 und 2014. Es untersucht die Barrieren für die Weiterbildungsteilnahme auf Mikro-, Meso- und Makroebene.
- Ansatzpunkte zur Einbeziehung weiterbildungsabstinenter Gruppen: Dieses Kapitel stellt exemplarisch bereits initiierte Maßnahmen und Projekte vor und bringt Vorschläge ein, den Ursachen für die Weiterbildungsabstinenz zu begegnen.
Schlüsselwörter
Berufliche Weiterbildung, Geringqualifizierte, Bildungsferne, soziale Ungleichheit, Weiterbildungsteilnahme, digitale Medien, E-Learning, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, Bildungsvoraussetzungen, soziologische Aspekte.
Häufig gestellte Fragen
Wer gilt als "gering qualifiziert" in der beruflichen Weiterbildung?
Als formal gering qualifiziert gelten Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung oder mit einem niedrigen Bildungsabschluss, die oft prekäre Arbeitsmarktpositionen innehaben.
Warum nehmen Geringqualifizierte seltener an Weiterbildungen teil?
Hemmende Faktoren sind unter anderem negative Schulerfahrungen, mangelndes Selbstvertrauen, finanzielle Hürden und fehlende Unterstützung durch den Arbeitgeber.
Sind digitale Medien eine "Wunderwaffe" für die Weiterbildung?
Digitale Medien bieten Flexibilität, setzen aber bestimmte Lernvoraussetzungen und technische Infrastruktur voraus. Die Arbeit untersucht kritisch, ob sie Barrieren abbauen oder neue schaffen.
Welche Rolle spielt der demografische Wandel für die Weiterbildung?
Durch den Fachkräftemangel wird es für die Politik und Wirtschaft essenziell, alle Potenziale – auch die der Geringqualifizierten – durch lebenslanges Lernen auszuschöpfen.
Was sind soziologische Aspekte der Weiterbildungsabstinenz?
Unterschiedliche gesellschaftliche Schichten haben verschiedene Einstellungen zu Bildung. Die Arbeit beleuchtet, wie soziale Herkunft die Bereitschaft zur Teilnahme an beruflicher Qualifizierung beeinflusst.
- Quote paper
- Udo Kroack (Author), 2016, Die berufliche Weiterbildung von Geringqualifizierten. Eine Untersuchung der Voraussetzungen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für digitale Weiterbildungsmaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341638