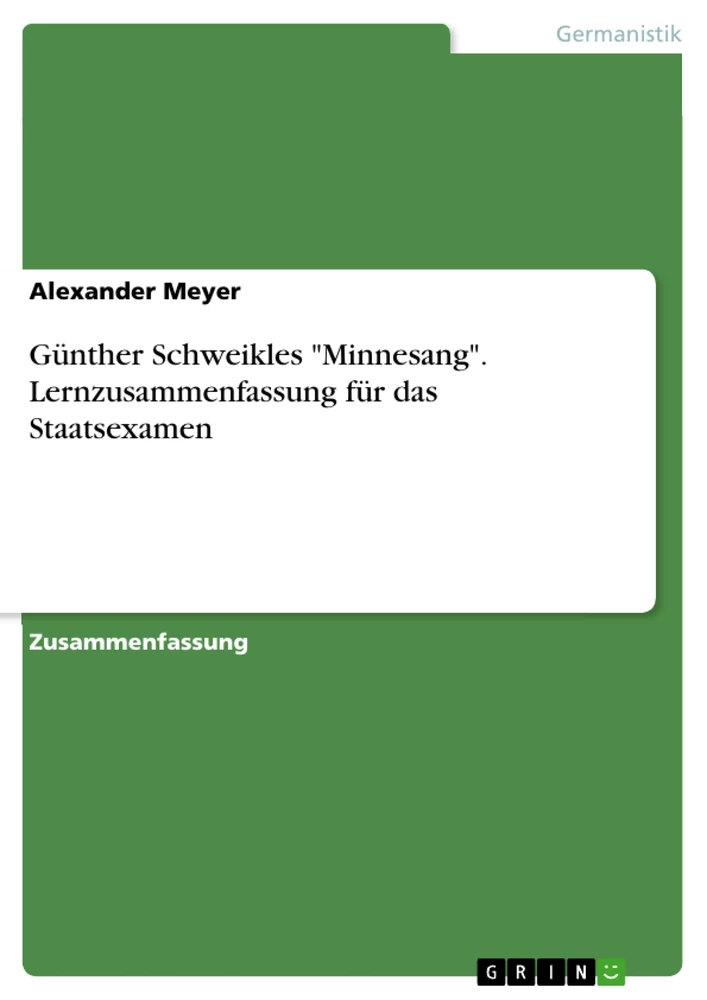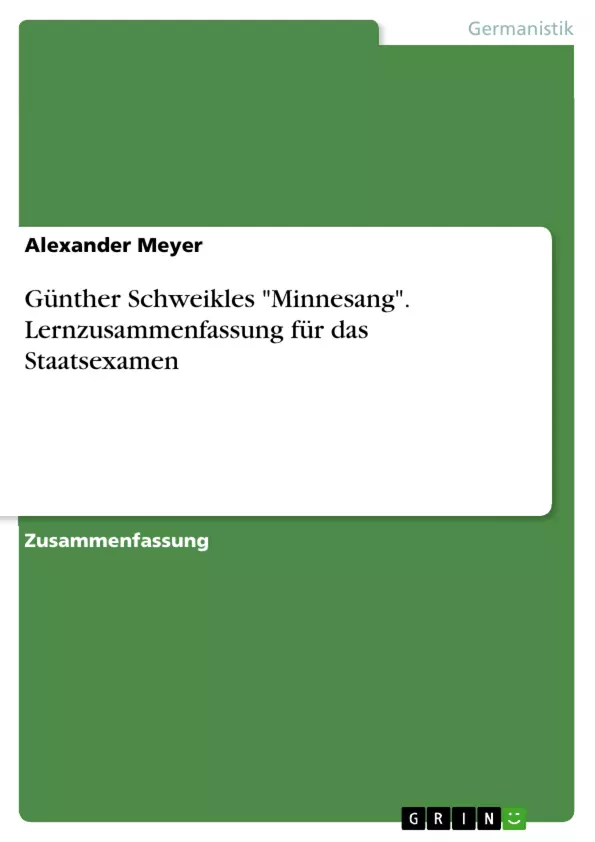Die umfangreiche Metzler-Einführung in die mittelhochdeutsche Lyrikgattung "Minnesang" von Günther Schweikle ist das Standardwerk, das auf keiner Literaturliste für das mündliche Staatsexamen zum Thema Minnesang fehlen darf. Der mittelhochdeutsche Minnesang wird hier von Günther Schweikle ausführlich und auf aktuellem Forschungsstand präsentiert.
Angeboten wird ein ausführliches Lernexzerpt ohne detaillierte Literaturangaben, mit dem Sie sich effektiv auf die Prüfung vorbereiten können und die wichtigsten Inhalte wiederholen können.
Die eigenständige Lektüre des Primärtextes wird empfohlen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überlieferung
- Handschrift A
- Handschrift B
- Handschrift C
- Handschrift E
- Die Lachmann-Schule (19. Jh.)
- Herkunfts- und Entstehungstheorien des Minnesangs
- Phasen des Minnesangs
- Erste Phase (Frühphase): 1150/60-1170
- Zweite Phase (erste Hochphase): ca. 1170-1190/1200
- Dritte Phase (zweite Hochphase): 1190-1210/20
- Vierte Phase (Höhepunkt und Überwindung): 1190-1230
- Fünfte Phase (erste Spätphase): ca. 1210-1240
- Sechste Phase (zweite Spätphase): ca. 1210-1300
- Autoren
- Gattungen
- Klassifikationsmöglichkeiten von Minneliedern
- Minne- oder Werbelied (fiktives Rollenspiel, monologische Aussprache ♂)
- Minneklage
- Direktes Werbe- oder Klagelied (Anrede-Lied)
- Frauenpreislied
- Minne-Preislieder
- Minnelehre (Mineregel, Minnereflexion)
- Minnespruch
- Frauenlied - Frauenrede
- Naturlieder
- Der Wechsel
- Dialog- oder Gesprächslied
- Botenlied
- Tagelied (tagelied / tagewîse)
- Die Pastourelle
- Der Leich, Pl. Leichs
- Weitere Liedtypen
- Form des Minnesangs
- Strophik
- Thematik
- Wechselseitige Minne
- Hohe Minne
- Niedere Minne
- Herzeliebe
- Dörperliche Minne
- Zusammenfassung der Minne-Thematik
- Frauenbilder
- Die Frau in den Frauenliedern - und Frauenstrophen
- Die Frau in den Minneklagen und Werbeliedern des Mannes
- Männerrollen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Lernzusammenfassung bietet eine umfassende Übersicht über den Minnesang, ein bedeutendes literarisches Phänomen des Mittelalters. Sie beleuchtet die Entstehung, Überlieferung und Entwicklung dieser komplexen Gattung, wobei der Fokus auf den Inhalten, Formen und Interpretationen der Minnesangs liegt.
- Die Entwicklung des Minnesangs von seinen Anfängen bis zu seinem Höhepunkt und der Überwindung
- Die verschiedenen Handschriften und ihre Bedeutung für die Überlieferung des Minnesangs
- Die verschiedenen Gattungen des Minnesangs und ihre charakteristischen Merkmale
- Die Thematik des Minnesangs, insbesondere die verschiedenen Formen der Minne
- Die Darstellung von Frauen und Männern im Minnesang
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Entwicklung der Minnesangsforschung im 19. Jahrhundert und stellt die besonderen Herausforderungen bei der Interpretation dieser Gattung heraus. Sie betont die Bedeutung des Minnesangs als literarisches Phänomen mit eigener poetischer Autonomie und spezifischer Metaphorik und Topik, das nicht als bloße Widerspiegelung realhistorischer Zustände betrachtet werden darf.
2. Überlieferung
Dieses Kapitel widmet sich der Überlieferung des Minnesangs durch die Analyse wichtiger Handschriften. Es beschreibt die wichtigsten Handschriften (A, B, C, E) und ihre Besonderheiten, wie z.B. die Anzahl der Autoren, die Art der enthaltenen Texte und die Anordnung der Gedichte.
2.1. Handschrift A
Die kleine Heidelberger Liederhandschrift, auch bekannt als Handschrift A, enthält Texte von Minnesängern aus der Zeit zwischen 1180 und 1240. Sie zeichnet sich durch Strophenanfänge mit Initialen und Abschnitte mit Autorennamen aus.
2.2. Handschrift B
Die Weingartner oder Stuttgarter Liederhandschrift, auch bekannt als Handschrift B, enthält eine Sammlung von Minnesängern aus dem Hochmittelalter. Sie ist durch Initialen, ganzseitige Miniaturen und eine hierarchische Ordnung der Autoren gekennzeichnet.
2.3. Handschrift C
Die Große Heidelberger Liederhandschrift, auch bekannt als Manessische Handschrift oder Manesse-Kodex, ist eine Sammlung von Minnesängern, die von den Anfängen der weltlichen Liedkunst bis zur Entstehung der Handschrift um 1300 reicht. Sie ist durch zweispaltige Anordnung, wechselnde Initialen, Randverzierungen und ganzseitige Miniaturen gekennzeichnet.
2.4. Handschrift E
Die Würzburger Liederhandschrift, auch bekannt als Handschrift E, enthält Texte von Minnesängern, darunter Walther und Reinmar. Sie ist durch eine Sammlung von Gebrauchstexten, dichterischen Texten und Spruchdichtung gekennzeichnet.
2.5. Die Lachmann-Schule (19. Jh.)
Dieses Kapitel beleuchtet die Textkritik der Lachmann-Schule und ihre Methoden zur Rekonstruktion des ursprünglichen Wortlauts von Liedern. Es kritisiert die Annahme eines einmaligen Urtextes und die Vorstellung von einer langen mündlichen Überlieferung, die den Text 'verderbt' habe.
3. Herkunfts- und Entstehungstheorien des Minnesangs
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Theorien zur Entstehung des Minnesangs. Es beleuchtet sowohl ältere Forschungsergebnisse als auch neuere Minnesangtheorien.
4. Phasen des Minnesangs
Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen des Minnesangs, von der Frühphase bis zur Spätphase. Es erläutert die charakteristischen Merkmale jeder Phase und die wichtigsten Vertreter.
5. Autoren
Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über die wichtigsten Autoren des Minnesangs und ihre Werke.
6. Gattungen
Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Gattungen des Minnesangs und ihren charakteristischen Merkmalen. Es beschreibt die Klassifikationsmöglichkeiten von Minneliedern, die verschiedenen Arten von Minneliedern, Frauenlieder, Naturlieder, Dialoglieder und andere Liedtypen.
7. Form des Minnesangs
Dieses Kapitel beleuchtet die Form des Minnesangs, insbesondere die Strophik.
8. Thematik
Dieses Kapitel behandelt die Thematik des Minnesangs, insbesondere die verschiedenen Formen der Minne, wie z.B. die wechselseitige Minne, die hohe Minne, die niedere Minne, die Herzeliebe und die dörperliche Minne.
9. Frauenbilder
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Frauen im Minnesang, sowohl in den Frauenliedern als auch in den Minneklagen und Werbeliedern des Mannes.
10. Männerrollen
Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Männern im Minnesang.
Schlüsselwörter
Minnesang, Minne, Minnelied, Überlieferung, Handschrift, Lachmann-Schule, Textkritik, Gattungen, Frauenbild, Männerrolle, Mittelalter, Literaturgeschichte, Poetik, Metaphorik, Topik, Minnelehre, Herzeliebe, Hohe Minne, Niedere Minne, Dörperliche Minne, Frauenlied, Minneklage, Werbelied, Naturlied, Dialoglied, Strophik,
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Minnesang?
Der Minnesang ist die ritterlich-höfische Liebeslyrik des Mittelalters, die zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert in mittelhochdeutscher Sprache verfasst und gesungen wurde.
Welche Handschriften sind für den Minnesang am wichtigsten?
Besonders bedeutend sind die Handschriften A (Kleine Heidelberger), B (Weingartner) und vor allem C (Große Heidelberger / Manesse-Kodex).
Was ist der Unterschied zwischen „Hoher Minne“ und „Niederer Minne“?
Die Hohe Minne ist die idealisierte, oft unerreichbare Liebe zu einer sozial höhergestellten Frau. Die Niedere Minne thematisiert eher eine gegenseitige, erfüllbare Liebe.
Was versteht man unter einem „Tagelied“?
Das Tagelied beschreibt den Abschied zweier Liebender bei Tagesanbruch nach einer gemeinsam verbrachten Nacht, oft gewarnt durch einen Wächter.
Wer war ein bedeutender Vertreter des Minnesangs?
Walther von der Vogelweide gilt als einer der wichtigsten und vielseitigsten Minnesänger, der die Gattung maßgeblich weiterentwickelte.
- Quote paper
- Alexander Meyer (Author), 2015, Günther Schweikles "Minnesang". Lernzusammenfassung für das Staatsexamen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341738