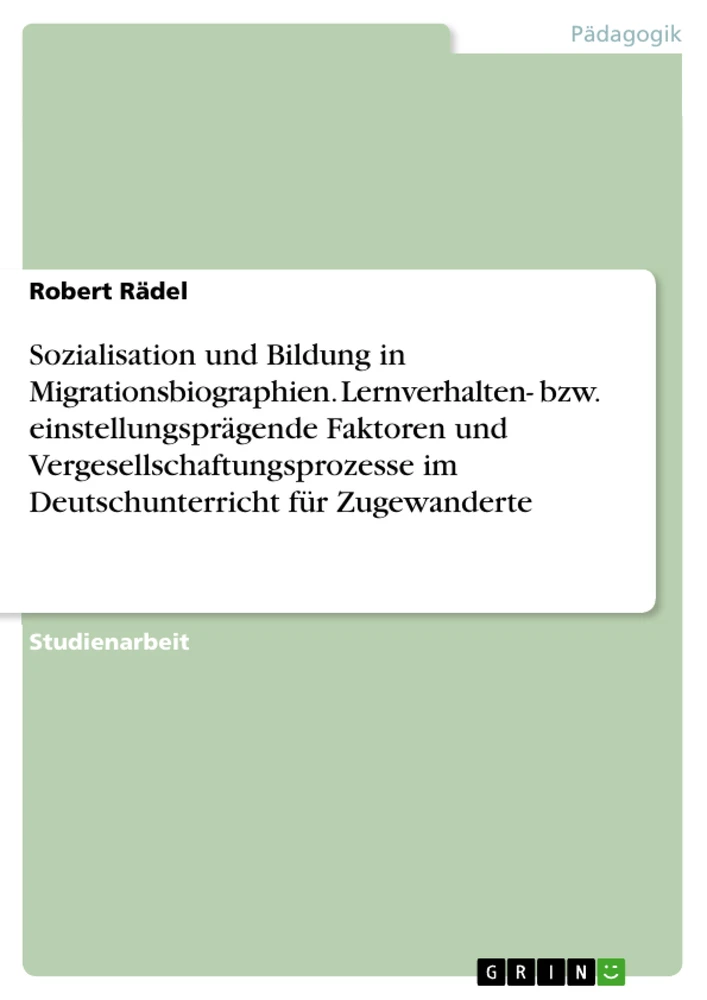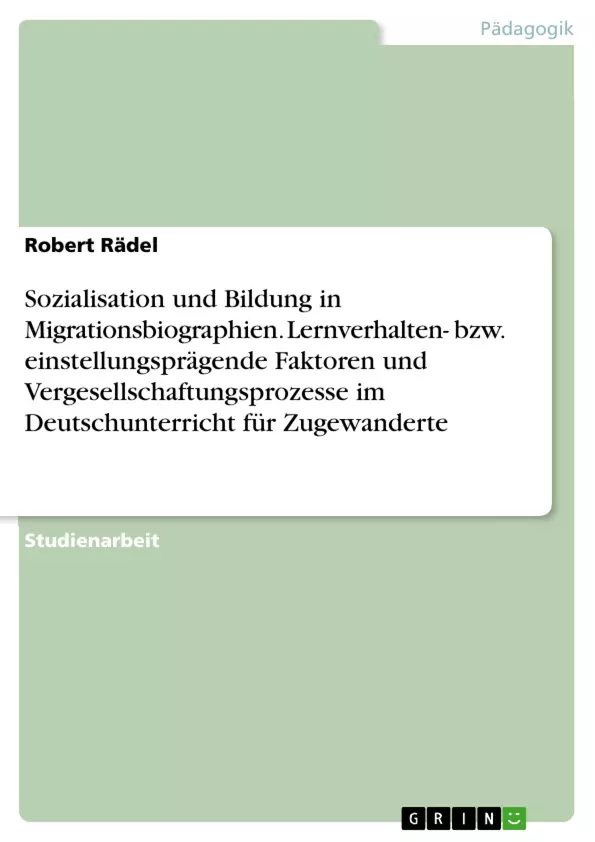Die Erwachsenenbildung steht vor der Herausforderung, extrem heterogen besetzte Sprach- und Integrationskurse zu unterrichten, wobei die Dozenten idealerweise didaktisch und pädagogisch teilnehmerorientiert handeln. Sie treffen auf hochgradig diverse Biographien, die sich im Unterricht durch ein individuelles Lernverhalten ausdrücken.
In der vorliegenden Arbeit wird der Zusammenhang von Migrationserfahrung, Lernverhalten und Vergesellschaftung theoretisch diskutiert und exemplarisch belegt. Anhand der Lebensgeschichte von drei Migrantinnen und Migranten aus einem berufsvorbereitenden Deutschkurs wird gezeigt, dass sich relevante persönliche Einstellungen und analoges Lernverhalten (vor allem) aus der erzählten Biographie ableiten lassen können.
An die Fragestellung knüpfen weitere Aspekte an, die im Laufe der Arbeit gestreift werden: Welche Rolle spielt die Biographizität als Schlüsselkompetenz in Migrationsbiographien? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Erfahrungslernen und Unterrichtslernen? Und kann man Erwachsenenbildung und Deutschunterricht als einen „Vergesellschaftungsmodus“ für Migranten ansehen?
Anfangs werden die aktuell relevanten Metatheorien zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft bzw. Ansätze zur Erklärung von Einstellungen und Verhalten diskutiert. Aus sozialkonstruktivistischer Analyseperspektive wird begründet, warum klassische Erklärungsmodelle anhand von Milieus, Habitus oder Lebenslagen hier nicht sinnvoll sind, um ursächliche Faktoren für heutige Verhaltensweisen in Migrationsbiographien zu identifizieren.
Mit den Erkenntnissen der gegenwärtigen Biographieforschung werden Hypothesen entwickelt, und diese dann anhand eines ausgewerteten autobiographisch-narrativen Gruppeninterviews mit drei Kursteilnehmern und dokumentierten Unterrichtsbeobachtungen als Fallstudie getestet. Am Schluss werden sowohl die Ergebnisse als auch die Vorgehensweise diskutiert, um die epistemischen und methodischen Möglichkeiten und Grenzen der erwachsenenpädagogischen Biographieforschung darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemaufriss und Fragestellung
- Vorgehensweise und Literatur
- Theoretische Grundlagen und Annahmen
- Metatheorien zur Verortung von Individuum und Gesellschaft
- Erwachsenensozialisation, Biografieforschung und Biographizität
- Pädagogische Lerntheorien
- Einstellungen und Lernverhalten
- Hypothesen
- Design der exemplarischen Fallstudie
- Methode, Sample und Gruppeninterview
- Das Gruppeninterview
- Unterrichtsbeobachtungen
- Auswertung und Ergebnisse
- Diskussion der Vorgehensweise, Reflexion und Kritik
- Literatur
- Monographien und Sammelbände
- Fachaufsätze
- Sonstiges
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Sozialisation und Bildung auf Migrationsbiographien und beleuchtet die Lernverhalten- bzw. einstellungsprägenden Faktoren und Vergesellschaftungsprozesse im Deutschunterricht für Zugewanderte. Sie analysiert anhand von drei exemplarischen Fallstudien den Zusammenhang zwischen Biographie, Lernverhalten und Integration.
- Zusammenhänge zwischen Biographizität und Lernverhalten in Migrationsbiographien
- Der Einfluss von Erfahrungen auf das Lernen im Deutschunterricht für Zugewanderte
- Die Rolle der Erwachsenenbildung und des Deutschunterrichts als Vergesellschaftungsmodus für Migranten
- Die Bedeutung von Sozialisationsprozessen im Deutschunterricht für Zugewanderte
- Die Analyse und Interpretation von autobiographisch-narrativen Interviews im Rahmen der Erwachsenenpädagogischen Biografieforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Bedarf an Deutschunterricht für Zugewanderte in Deutschland dar und führt die Problematik der Integration in den Fokus. Sie erläutert die Heterogenität der Bildungsvoraussetzungen und die Notwendigkeit eines teilnehmerorientierten Deutschunterrichts.
- Theoretische Grundlagen und Annahmen: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene metatheoretische Ansätze zur Verortung von Individuum und Gesellschaft und stellt die Relevanz der sozialkonstruktivistischen Perspektive heraus. Es geht auf die Bedeutung der Erwachsenensozialisation, der Biografieforschung und der Biographizität sowie auf pädagogische Lerntheorien ein.
- Design der exemplarischen Fallstudie: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und das Design der Fallstudie, die auf autobiographisch-narrativen Gruppeninterviews mit drei Kursteilnehmern und dokumentierten Unterrichtsbeobachtungen basiert.
Schlüsselwörter
Migrationsbiographien, Deutschunterricht für Zugewanderte, Lernverhalten, Einstellungen, Sozialisation, Biografieforschung, Biographizität, Erwachsenenbildung, Vergesellschaftung, Gruppeninterview, Unterrichtsbeobachtung, qualitative Forschung, sozialkonstruktivistische Perspektive.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Migrationsbiographie das Lernverhalten?
Persönliche Einstellungen und das Lernverhalten lassen sich oft direkt aus der erzählten Lebensgeschichte und den darin enthaltenen Erfahrungen ableiten.
Was versteht man unter "Biographizität"?
Es ist die Schlüsselkompetenz, das eigene Leben vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Anforderungen zu gestalten und aus Erfahrungen zu lernen.
Kann Deutschunterricht ein "Vergesellschaftungsmodus" sein?
Ja, die Arbeit diskutiert, inwiefern Sprachkurse nicht nur Wissen vermitteln, sondern als Prozess der Eingliederung in die Gesellschaft (Vergesellschaftung) wirken.
Warum sind klassische Milieu-Modelle hier oft nicht hilfreich?
Aus sozialkonstruktivistischer Sicht greifen starre Modelle bei hochgradig diversen Migrationsbiographien zu kurz, um individuelles Verhalten zu erklären.
Welche Methode wurde für die Fallstudien genutzt?
Die Untersuchung basiert auf autobiographisch-narrativen Gruppeninterviews und dokumentierten Unterrichtsbeobachtungen.
- Quote paper
- Robert Rädel (Author), 2016, Sozialisation und Bildung in Migrationsbiographien. Lernverhalten- bzw. einstellungsprägende Faktoren und Vergesellschaftungsprozesse im Deutschunterricht für Zugewanderte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341947