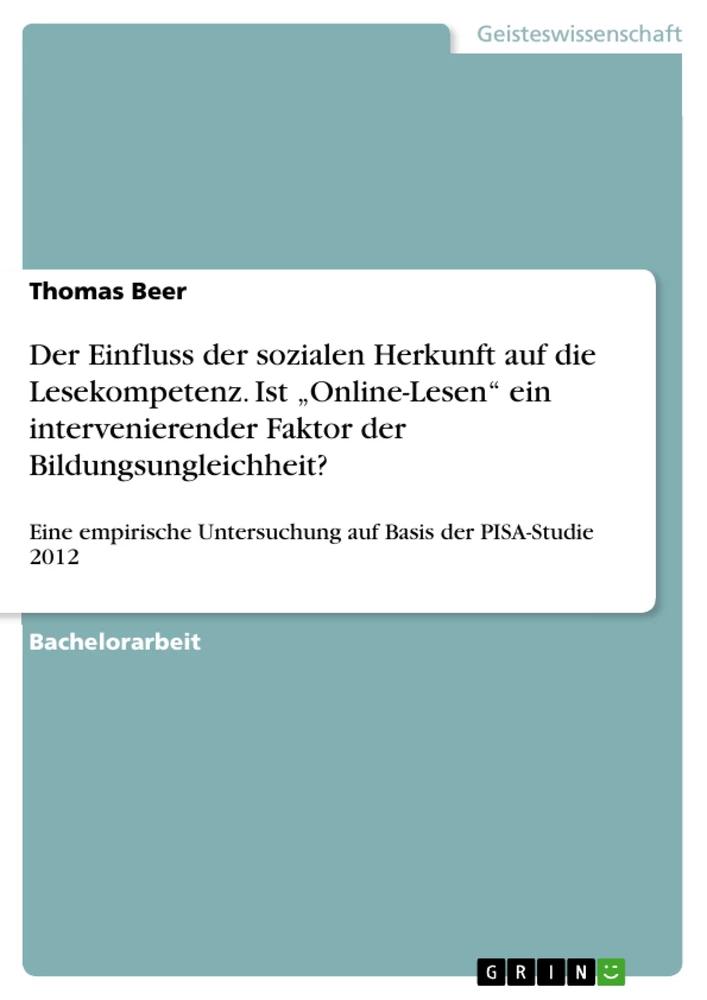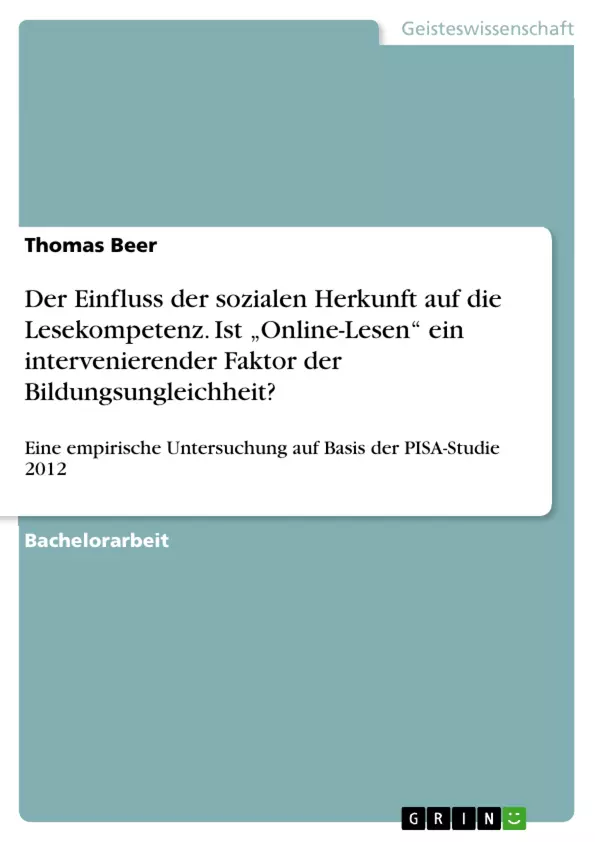In allen bisher durchgeführten PISA-Erhebungen zeigt sich ein Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und den Kompetenzen der Schüler. Die Lesekompetenz rückt in den Fokus dieser Forschungsarbeit, da sie als universelles Kulturwerkzeug eine Schlüsselrolle für den Schulerfolg einnimmt. Unter dem Begriff „Digitale Ungleichheit“ werden außerdem schon seit längerem Unterschiede in der Internetnutzung zwischen verschiedenen Schichten konstatiert. In der heutigen Zeit, in der die Internetnutzung wie selbstverständlich zu unserem Alltag gehört, stellt sich die Frage, ob die Unterschiede in der Lesekompetenz eventuell auch dadurch zu erklären sind, dass Schüler unterschiedlicher sozialer Herkunft das Internet unterschiedlich häufig zu Lesezwecken nutzen. Die vorliegende Forschungsarbeit basiert auf den Daten der PISA-Erhebung von 2012 und hat das Ziel zu untersuchen, inwieweit es sich beim Online-Lesen um einen mediierenden Faktor handelt, der zumindest einen Teil des Einflusses der sozialen Herkunft auf die Lesekompetenz erklären kann. Die theoretische Grundlage der Untersuchung bildet ein eigens entworfenes Modell, das auf der Vermengung der Kapital- und Habitus-Theorie von Bourdieu und des Matthäus-Effekts des Lesens von Stanovich beruht. Zur Messung der Online-Leseaktivität wird ein Index in Anlehnung an den „Online Reading Acitivities Index“ der PISA Studie von 2009 gebildet. Die Messung der sozialen Herkunft erfolgt mit dem „Index of Economic, Social and Cultural Status“. Als Indikator der Lesekompetenz wird der erste von fünf „Plausible Values“ herangezogen. Die vorliegende Fragestellung wird mittels einer Mediator-Analyse auf Basis von linearen Regressionsmodellen mit einer Stichprobe von insgesamt 3231 Schülern untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Lesekompetenz und Internetnutzung im Fokus sozialer Ungleichheit.
- Forschungsstand
- Lesekompetenz - eine Qualifikation, die Türen öffnet..
- Lesekompetenz und soziale Herkunft
- Internetnutzung (Online-Lesen) und soziale Herkunft..
- Lesekompetenz und Online-Lesen
- Theoretische Einbettung und Forschungshypothesen......
- Die Kapital-Theorie von Bourdieu.
- Ökonomisches Kapital
- Kulturelles Kapital.........
- Soziales Kapital .....
- Die Habitus-Theorie ......
- Modell zum Matthäus-Effekt des Lesens.
- Synthese zu einem Erklärungsmodell......
- Die Kapital-Theorie von Bourdieu.
- Datengrundlage ......
- Die PISA-Studie im Überblick...........
- Grundgesamtheit und Stichprobenziehung.
- Gewichtung..
- Plausible Values.....
- Konzeptspezifikation und Operationalisierung.
- Lesekompetenz.........
- Soziale Herkunft..
- Online-Lesen .....
- Drittvariablen..........\li>
- Datenanalyse.
- Deskriptive Analyse relevanter Verteilungen.
- Analyse bivariater Zusammenhänge ......
- Mediator-Analyse.
- Ergebnisse........
- Diskussion.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Forschungsarbeit untersucht den Einfluss der sozialen Herkunft auf die Lesekompetenz von Schülern im Kontext der PISA-Studie 2012. Dabei steht die Frage im Zentrum, ob die Nutzung des Internets zum Lesen ("Online-Lesen") als intervenierender Faktor die Bildungsungleichheit beeinflusst.
- Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Lesekompetenz
- Rolle des Online-Lesens als möglicher Mediator-Effekt
- Theoretische Einbettung in die Kapital- und Habitus-Theorie von Bourdieu
- Anwendung des Matthäus-Effekts des Lesens von Stannovich
- Empirische Analyse der PISA-Daten 2012
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Lesekompetenz und Internetnutzung im Kontext sozialer Ungleichheit ein. Kapitel 2 beleuchtet den Forschungsstand zu den Themen Lesekompetenz, sozialer Herkunft, Internetnutzung und deren Zusammenhänge. Kapitel 3 präsentiert die theoretische Einbettung der Forschungsarbeit in die Kapital- und Habitus-Theorie von Bourdieu sowie das Modell zum Matthäus-Effekt des Lesens. Kapitel 4 beschreibt die Datengrundlage der Studie, die auf der PISA-Studie 2012 basiert. In Kapitel 5 werden die Konzepte Lesekompetenz, soziale Herkunft, Online-Lesen und Drittvariablen spezifiziert und operationalisiert. Kapitel 6 erläutert die Datenanalyse, die sowohl deskriptive Analysen als auch bivariate Zusammenhänge und eine Mediator-Analyse umfasst. Die Ergebnisse der Analyse werden in Kapitel 7 präsentiert. Abschließend erfolgt in Kapitel 8 eine Diskussion der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Lesekompetenz, soziale Herkunft, Bildungsungleichheit, Online-Lesen, Internetnutzung, PISA-Studie, Kapital-Theorie, Habitus-Theorie, Matthäus-Effekt des Lesens, Mediator-Effekt.
- Quote paper
- Thomas Beer (Author), 2015, Der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Lesekompetenz. Ist „Online-Lesen“ ein intervenierender Faktor der Bildungsungleichheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342090