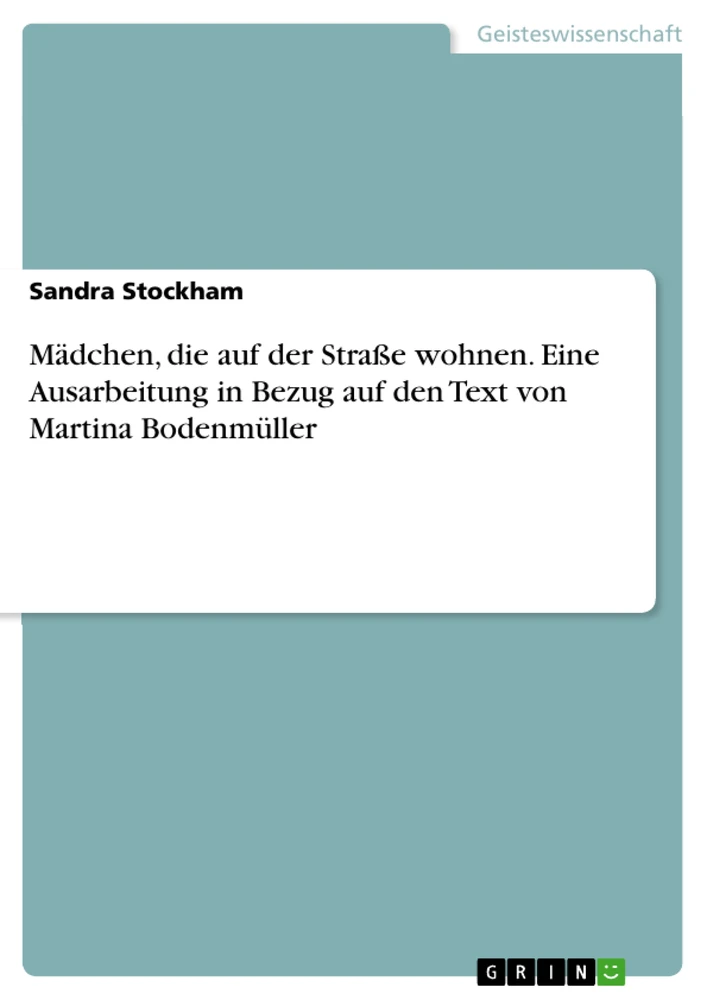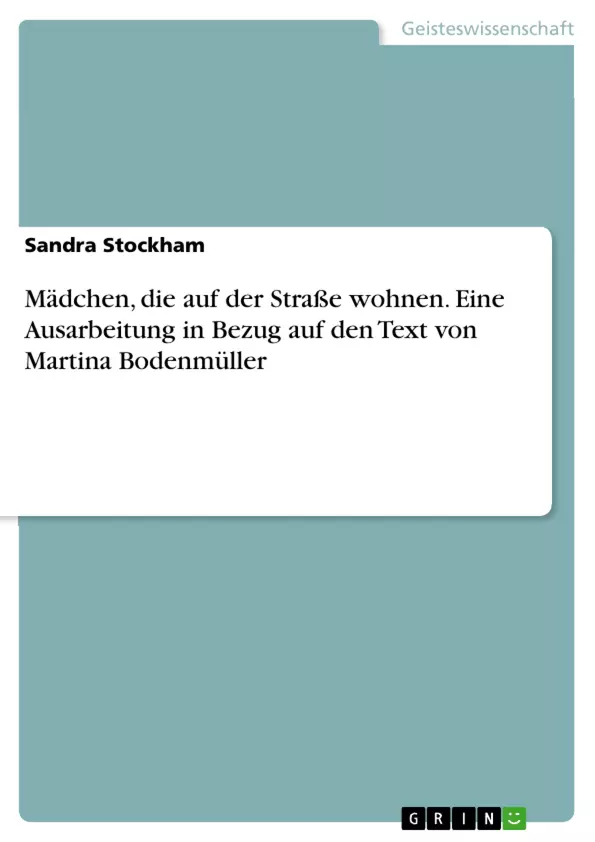Martina Bodenmüller behandelt in ihrem Text „Auf der Straße leben“ die besonderen Lebenssituationen von Mädchen und jungen Frauen ohne Wohnung. Mädchen sind zwischen 14 und 18 Jahren alt, nach dem KJHG §7 Abs. 1 gelten sie ab dem 18 bis zum 27 Lebensjahr als junge Frauen. In dem Text geht Martina Bodenmüller auch auf die Unterschiede zu dem Leben erwachsener Wohnungsloser ein. In der folgenden Referatsausarbeitung werde ich auf Frau Bodenmüllers Text und Buch eingehen und unter Berücksichtigung der Diskussion in der Modulveranstaltung verschiedene Blickwinkel auf das Thema beleuchten.
Für die Bearbeitung dieses Themas ist es unumgänglich, sich mit den Gesetzen zu befassen, da diese unmittelbaren Einfluss auf das Leben der Mädchen und jungen Frauen auf der Straße haben. Auch spielt die Gesetzgebung eine nicht irrelevante Rolle für die Ausgestaltung „sozialarbeiterischer“ Angebote für diese Zielgruppe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzliche Grundlagen
- Die „wohnungslosen Mädchen und jungen Frauen“
- Begriffe und Definitionen:
- Untergruppen der Frauen in latenter Wohnungslosigkeit:
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Auf der Straße leben“ von Martina Bodenmüller befasst sich mit den Lebensbedingungen von Mädchen und jungen Frauen ohne Wohnung. Er untersucht die Besonderheiten dieser Situation und die Herausforderungen, denen diese junge Zielgruppe im Vergleich zu erwachsenen Wohnungslosen gegenübertritt.
- Die besonderen Lebensbedingungen von Mädchen und jungen Frauen in Wohnungslosigkeit
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen auf diese Zielgruppe
- Die Schwierigkeiten bei der Definition und Einteilung von Untergruppen innerhalb der Gruppe der wohnungslosen Frauen
- Die Notwendigkeit von partizipativen Angeboten, die auf die Bedürfnisse dieser jungen Menschen eingehen
- Die Bedeutung der Selbsthilfe und Selbstbestimmung innerhalb der Gruppe der wohnungslosen Mädchen und jungen Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Autorin stellt die Thematik der Wohnungslosigkeit von Mädchen und jungen Frauen in den Kontext des Jugendhilfegesetzes und beleuchtet die Unterschiede zu erwachsenen Wohnungslosen.
Gesetzliche Grundlagen
Dieser Abschnitt befasst sich mit den relevanten gesetzlichen Regelungen, die das Leben von Mädchen und jungen Frauen auf der Straße beeinflussen. Dabei werden die Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Selbsthilfe, die legale Lebensführung und den Zugang zu staatlichen Unterstützungssystemen beleuchtet.
3.1 Die „wohnungslosen Mädchen und jungen Frauen“
Dieser Abschnitt betrachtet die Entscheidungsprozesse und die Gründe, die Mädchen und junge Frauen dazu bewegen, ein Leben in Unsicherheit und Perspektivlosigkeit zu wählen. Die Autorin betont die Bedeutung von partizipativen Angeboten, die auf die Bedürfnisse dieser jungen Menschen eingehen.
3.2 Begriffe und Definitionen:
Der Abschnitt erläutert die verschiedenen Bezeichnungen im Kontext der Obdachlosigkeit und die Schwierigkeiten, die diese Bezeichnungen für die Betroffenen mit sich bringen. Er beleuchtet die Kritik an der Unterscheidung zwischen Obdachlosen und Nichtsesshaften und die Notwendigkeit, alternative Begriffe zu verwenden.
3.3 Untergruppen der Frauen in latenter Wohnungslosigkeit:
Hier werden verschiedene Untergruppen der Frauen in Wohnungsnot vorgestellt, die über die klassischen Definitionen hinausgehen. Insbesondere wird die Situation von Mädchen und jungen Frauen, die nicht in einem Familienverband leben oder diesen bewusst verlassen haben, betrachtet.
Schlüsselwörter
Wohnungslosigkeit, Mädchen, junge Frauen, Jugendhilfegesetz, Obdachlosigkeit, Nichtsesshaftigkeit, Partizipation, Selbsthilfe, Selbstbestimmung, legale Lebensführung, Zugang zu staatlichen Unterstützungssystemen, Untergruppen, latente Wohnungslosigkeit, prekäre Wohnverhältnisse, Familienverband.
Häufig gestellte Fragen
Ab wann gelten wohnungslose Personen als „junge Frauen“?
Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) gelten sie ab dem 18. bis zum 27. Lebensjahr als junge Frauen, während sie davor als Mädchen (14-18 Jahre) eingestuft werden.
Was sind die Ursachen für Wohnungslosigkeit bei Mädchen?
Oft sind es bewusste Entscheidungen, einen belastenden Familienverband zu verlassen, was zu einem Leben in Unsicherheit und Perspektivlosigkeit führt.
Welchen Einfluss haben Gesetze auf wohnungslose junge Frauen?
Gesetzliche Rahmenbedingungen bestimmen den Zugang zu staatlichen Unterstützungssystemen, die Möglichkeiten der Selbsthilfe und die legale Lebensführung auf der Straße.
Was versteht man unter „latenter Wohnungslosigkeit“?
Dies beschreibt prekäre Wohnverhältnisse, bei denen Frauen zwar ein Dach über dem Kopf haben, aber keine gesicherte oder eigene Wohnung besitzen (z. B. Unterkommen bei Bekannten).
Warum ist Partizipation in der Sozialarbeit für diese Zielgruppe wichtig?
Angebote müssen auf die spezifischen Bedürfnisse und die Selbstbestimmung der jungen Frauen eingehen, um wirksam zu sein und Akzeptanz zu finden.
- Quote paper
- Sandra Stockham (Author), 2014, Mädchen, die auf der Straße wohnen. Eine Ausarbeitung in Bezug auf den Text von Martina Bodenmüller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342155