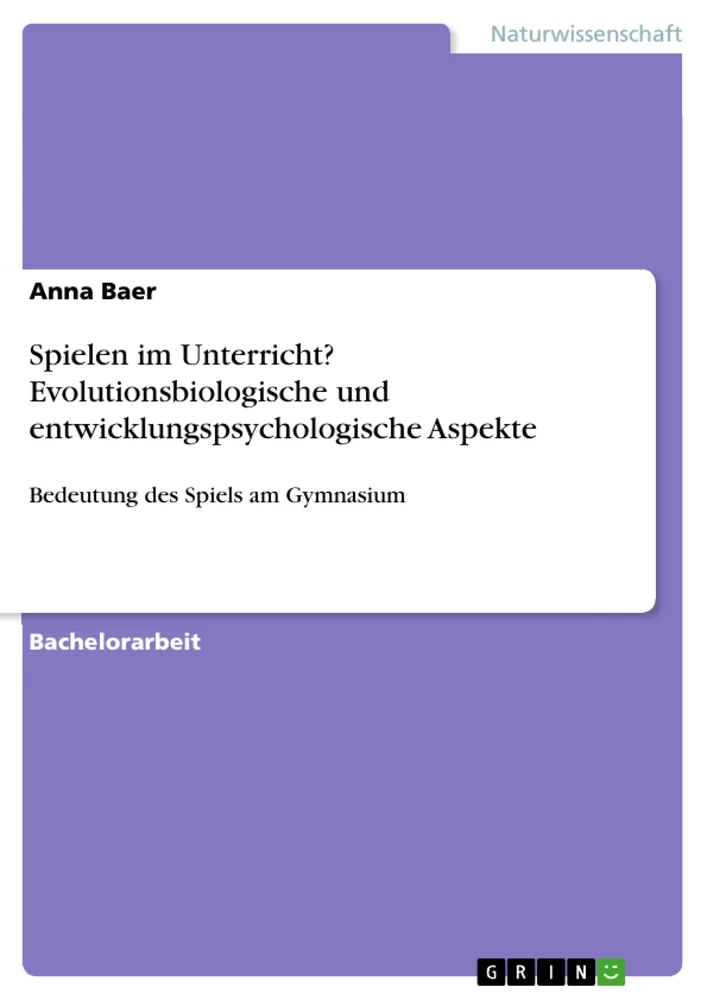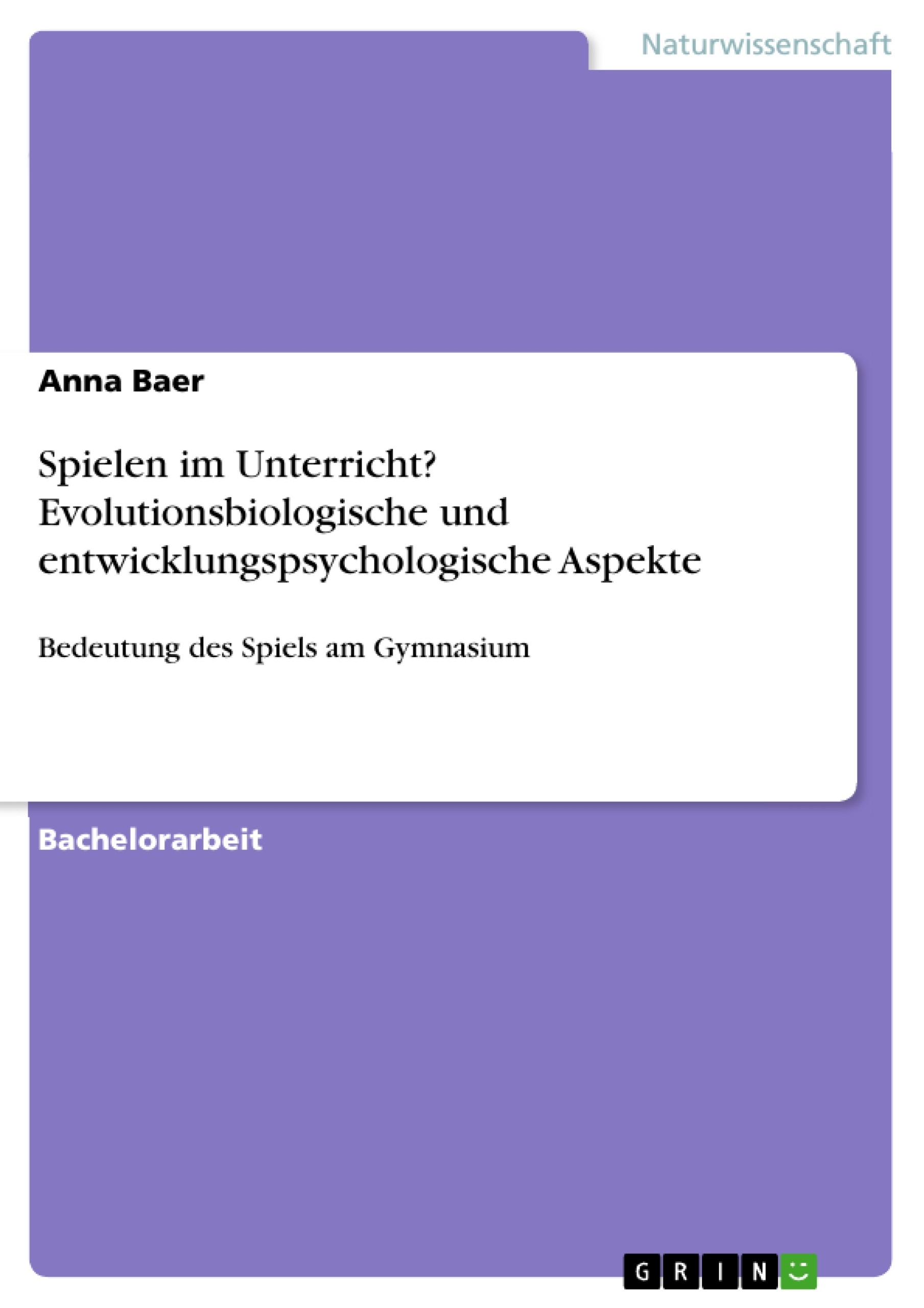Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Thematik des Spiels. Dabei werden einerseits die Schwierigkeiten thematisiert, den Spielbegriff zu definieren, andererseits wird versucht, sich diesem Phänomen entwicklungspsychologisch und evolutionsbiologisch zu nähern und die Funktionen des Spiels herauszustellen. Dieser theoretische Teil dient als Grundlage für die Betrachtung des Spiels in der Schule. Hier werden Spielformen vorgestellt und verschiedene Sichten auf das Spiel in der Schule dargestellt, die durch Auswertung von Literatur gewonnen wurden. Da es viele widersprüchliche Veröffentlichungen zu dem Spiel in der Schule gibt, die zum Teil nicht mehr aktuell sind, wurden auch aktuelle Meinungen zum Spiel in der Schule erhoben. Es wurde dazu ein Online-Fragebogen entwickelt, der sich mit der Bedeutung des Spiels in der Schule befasst. Die Ergebnisse dieses Fragebogens sind, wie diejenigen in der Literatur, zweigeteilt. Das Wesen der Schule und der damit einhergehende Leistungsdruck werden oft als Grund genannt, weshalb dem Spiel ein geringer Stellenwert in der Schule und vor allem in der hier untersuchten Schulform des Gymnasiums eingeräumt wird. Doch auch positive Aspekte, wie die Wissensvermittlung und die Förderung von Kreativität, Merkfähigkeit, Kooperation, Intelligenz, logischem Denken und Problemlösefähigkeit sind Aspekte, die unter den Antworten der Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmer auftauchen. Denn die Beschäftigung mit Spiel, trotz aller Kritik, ist die Mühe wert und kann in der Schule in den verschiedensten Formen Anwendung finden.
Diese Arbeit richtet sich an alle „Spielinteressierten“, die sich mit dem Thema im Rahmen des Studiums, des Referendariats oder auch innerhalb einer Lehrerfortbildung beschäftigen, aber auch an Kritiker des Spiels, die in diesem vielleicht nur verschwendete Zeit innerhalb unserer heutigen Leistungsgesellschaft sehen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Spiel?
- 2.1 Definitionsversuche
- 2.2 Allgemeine Charakteristika des Spiel
- 2.3 Verschiedene Theorien zum Spiel
- 2.3.1 Vorübungstheorie nach Karl GROOS (1899)
- 2.3.2 Psychoanalytische Theorie nach Siegmund FREUD (1905)
- 2.3.3 Funktionslusttheorie nach BÜHLER (1929)
- 2.3.4 Theorie der Notwendigkeit nach HUIZINGA (1956)
- 2.3.5 Spieltheorie nach PIAGET (1972)
- 2.3.6 Theorie des Aktivierungszirkels nach HECKHAUSEN (1973)
- 2.3.7 Sonstige Theorien zum Thema Spiel
- 2.4 Formen unterschiedlichen Spielen
- 2.4.1 Funktions- und Experimentierspiel
- 2.4.2 Frühes Symbolspiel
- 2.4.3 Konstruktionsspiel
- 2.4.4 Symbolspiel/Rollenspiel
- 2.4.5 Regelspiel
- 2.5 Spiel im Wandel der Zeit - Computerspiele?
- 3. Welche Funktionen hat das Spiel?
- 3.1 Evolutionäre Sicht auf das Spiel
- 3.1.1 Ein Blick auf unsere Kultur
- 3.1.2 Spielen im Tierreich - warum spielen Tiere?
- 3.1.3 Entwicklung zum Menschen hin
- 3.1.3.1 Was weiß man über das Spielen bei kleinen Kindern?
- 3.1.3.2 Spiele bei Erwachsenen?
- 3.2 Was kann das Spiel in Bezug auf das Individuum leisten?
- 3.2.1 Acht hauptsächliche Funktionen des Kinderspiels nach MOGEL
- 3.2.2 Exemplarisches Beispiel: Rollenspiel
- 3.2.3 Langfristige Auswirkungen, Transfer von Spielleistungen
- 3.3 Kritik am Spiel generell
- 4. Spiel in der Schule
- 4.1 Die Geschichte des Spiels in der Schule
- 4.2 Spielformen in der Schule
- 4.2.1 Lernspiel
- 4.2.2 Rollenspiel
- 4.2.3 Darstellendes Spiel
- 4.2.4 Planspiel
- 4.3 Kritik am Spiel in der Schule
- 4.3.1 Lernziele durch Spiele erreichen?
- 4.3.2 Das Wesen der Schule - wieso Spiel in der Schule problematisch ist
- 4.4 Wieso Spiel in der Schule? - positive Aspekte
- 4.5 Informationen für die Lehrkraft/den Spielleiter
- 4.6 Spielvorschläge - Benita DAUBLEBSKY
- 5. Umfrage an einem Gymnasium zu der Bedeutung des Spiels in der Schule
- 5.1 Material und Methoden
- 5.2 Ergebnisse
- 5.3 Diskussion
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
- 8. Anhang - Fragebogen zu der Umfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Thematik des Spiels, wobei die Schwierigkeiten bei der Definition des Spielbegriffs sowie die entwicklungspsychologischen und evolutionsbiologischen Aspekte des Spiels beleuchtet werden. Die Arbeit untersucht die Funktionen des Spiels und setzt diese in Beziehung zum Spiel in der Schule. Dabei werden verschiedene Spielformen vorgestellt und die unterschiedlichen Perspektiven auf das Spiel im schulischen Kontext analysiert. Die Arbeit befasst sich auch mit den aktuellen Meinungen zum Spiel in der Schule, die durch eine Online-Umfrage erhoben wurden.
- Die Definition des Spielbegriffs und dessen verschiedene Ausprägungen
- Die Funktionen des Spiels aus entwicklungspsychologischer und evolutionsbiologischer Sicht
- Die Rolle des Spiels in der Schule und die verschiedenen Spielformen im Unterricht
- Die Kritik am Spiel in der Schule und die Argumente für und gegen dessen Integration
- Die Bedeutung des Spiels für die Förderung von Kreativität, Lernfähigkeit und sozialen Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Spiels ein und beleuchtet die Bedeutung des Spiels in der Schule. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Definition des Spielbegriffs, seinen allgemeinen Charakteristika und verschiedenen Theorien zum Spiel. Kapitel 3 beleuchtet die Funktionen des Spiels aus evolutionärer Sicht und untersucht die Auswirkungen des Spiels auf das Individuum. Kapitel 4 analysiert die Rolle des Spiels in der Schule, betrachtet verschiedene Spielformen und diskutiert Kritik und positive Aspekte des Spiels im Unterricht. Kapitel 5 stellt die Ergebnisse einer Online-Umfrage zu der Bedeutung des Spiels in der Schule dar. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Spiel, Spielbegriff, Entwicklungspsychologie, Evolutionsbiologie, Funktionen des Spiels, Schule, Unterricht, Spielformen, Lernspiel, Rollenspiel, Kritik am Spiel, Online-Umfrage.
- Quote paper
- Anna Baer (Author), 2016, Spielen im Unterricht? Evolutionsbiologische und entwicklungspsychologische Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342200