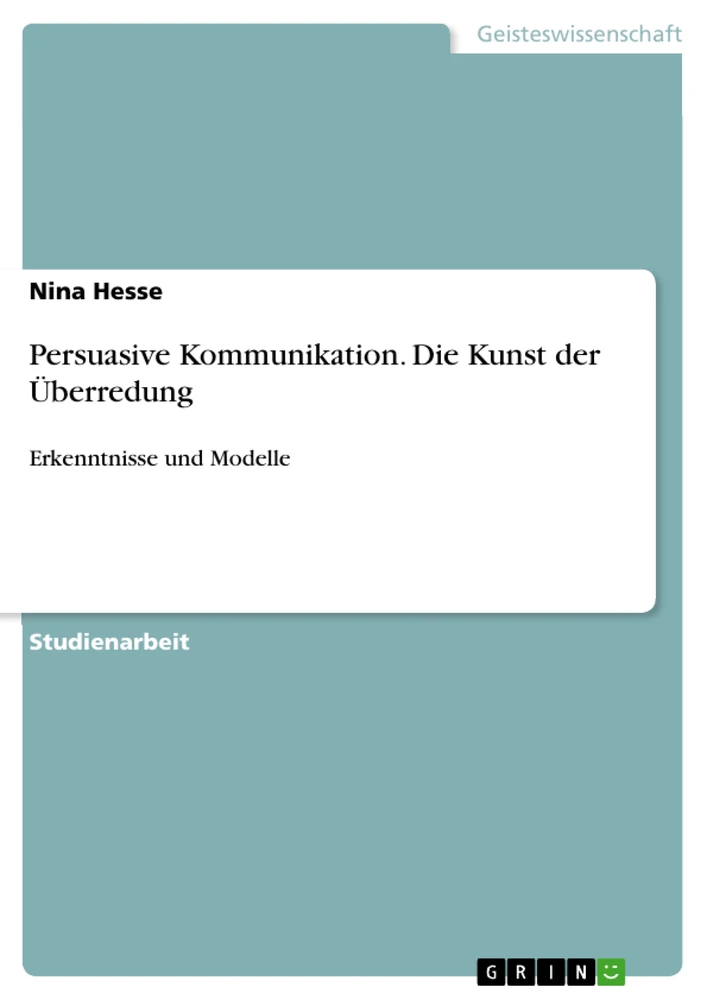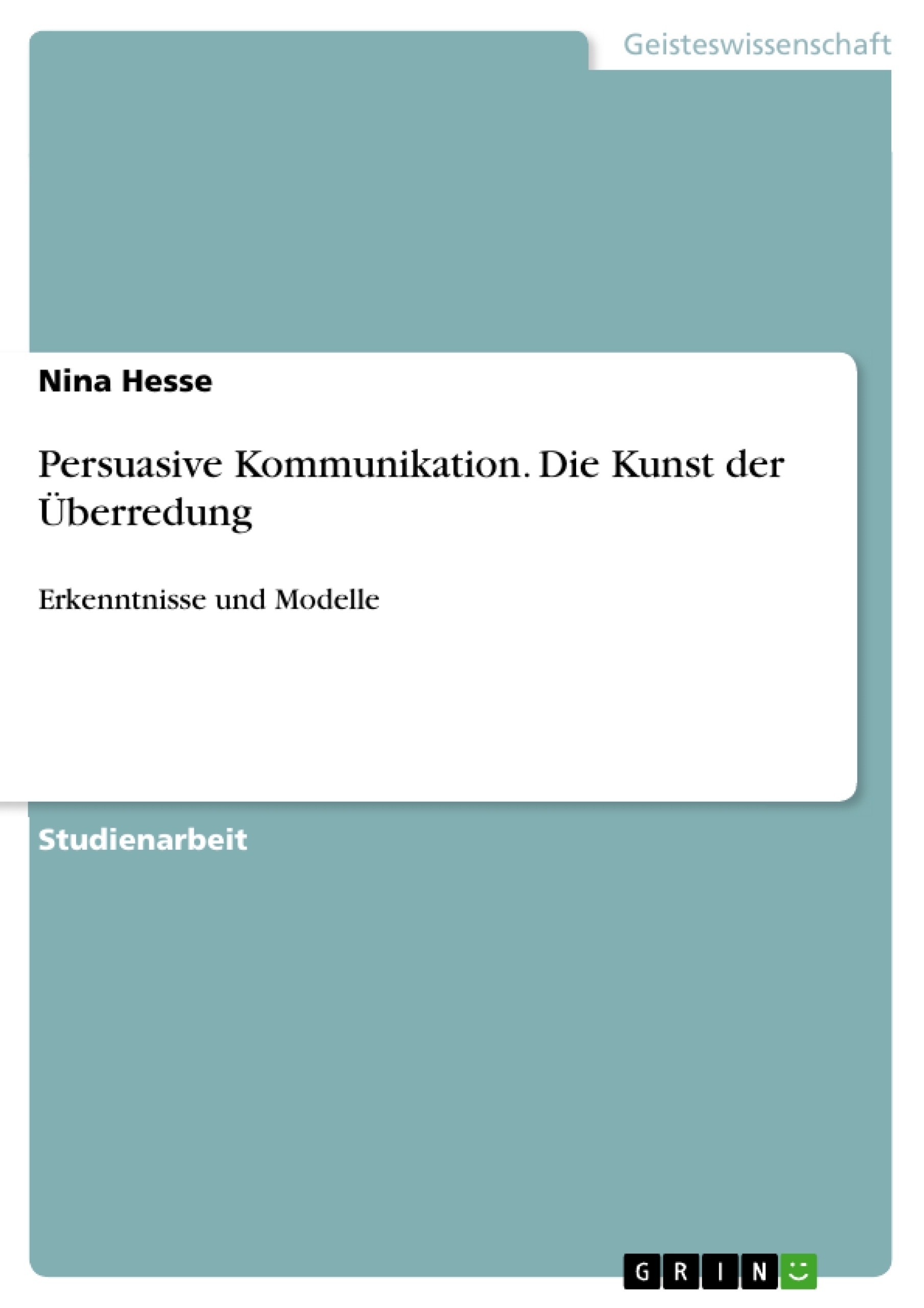Schon das Johannesevangelium, eines der zentralen Werke des christlichen Glaubens, verwendet eine Kommunikationstechnik, die nach heutigem Verständnis der Persuasion zugeordnet
werden kann, und die aus rein linguistischer Betrachtung heraus, sich durch die gesamte Schöpfungsgeschichte zieht.
Die Frage ob und wie Menschen zu beeinflussen sind ist
vermutlich eine der ältesten, wenn nicht gar so alt wie der Mensch selbst. Doch die historisch datierbaren Anfänge der Persuasion reichen, über die biblische Geschichte hinaus, bis in das Altertum zurück und lassen sich – wie auch die der meisten Wissenschaften – in der Philosophie finden. So sagte schon Aristoteles, dass es drei Arten der Überzeugung
gibt. Die erste hängt vom Charakter des Sprechers ab, die zweite von seiner Begabung, die Zuhörer in einen von ihm gewünschten geistigen Zustand zu versetzen, und die dritte vom Beweis oder scheinbaren Beweis, der durch die Worte selbst gegeben wird.
Bereits vor Aristoteles systematischer Darstellung der Redekunst kursierten entsprechende Handbücher, welche die Praxis lehrten. Zunehmend entwuchsen auch ideologische
Konflikte zwischen den Vertretern der verschiedenen Denkströmungen. Der platonische Dialog beleuchtet das Motiv der Rede, hervorgehend aus den unterschiedlichen Auffassungen des sittlich sokratischen Individualismus zu der relativistischen Sicht der Sophisten.
Während das sokratische Postulat gilt, durch die Rede zur Wahrheit hinzuführen, legitimieren die Sophisten die „Überredung mit der Ansicht, dass eine Wahrheit nicht existiere oder wenn, nicht erkennbar sei.“ (Duthel, 2013, S. 71). Nach sophistischem Verständnis geht es bei der Rede nur um die Überredungskraft, selbst wenn die Person von falschen oder widersprüchlichen Inhalten überzeugt werden soll.
Die nachfolgende Arbeit orientiert sich an einigen der wichtigsten Erkenntnissen empirischer Persuasionsforschung des 20. Jahrhunderts. Der Begriffsdefinition folgt eine Einführung zur Einstellungsbildung und deren Modulation. Als Gegenstand werden Berichte zahlreicher Experimente US-amerikanischer Sozialpsychologen herangezogen, die als Yale-Ansatz zur Einstellungsänderung in der Wissenschaft Verbreitung finden. Um ein besseres Verständnis darüber zu erlangen, in welchen verschiedenen Modalitäten persuasive Kommunikation abläuft, werden im abschließenden Teil dieser Arbeit Informationsverarbeitungsmodelle vorgestellt, die auf einen konkreten Marketingkontext angewandt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition des Persuasionsbegriffs
- 3. Einstellung
- 3.1 Einstellungsbildung
- 3.2 Einstellungsänderung
- 4. Erste empirische Erkenntnisse der Persuasionsforschung
- 4.1 Der Yale-Ansatz zur Einstellungsänderung
- 4.1.1 Der Einfluss der Quelle
- 4.1.2 Assimilations- und Kontrasteffekte
- 4.2 Weitere Erkenntnisse der Persuasionsforschung
- 4.1 Der Yale-Ansatz zur Einstellungsänderung
- 5. Informationsverarbeitungsmodell
- 5.1 Das Elaboration-Wahrscheinlichkeits-Modell
- 5.2 Das Heuristisch-Systematische-Modell
- 5.3 Weitere Prozessmodelle der Persuasionsforschung
- 6. Praxisreflexion
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht persuasive Kommunikation und deren Wirkung auf Einstellungen. Ziel ist es, die wichtigsten empirischen Erkenntnisse der Persuasionsforschung, insbesondere den Yale-Ansatz, vorzustellen und verschiedene Informationsverarbeitungsmodelle zu erläutern. Die Arbeit reflektiert die Praxisrelevanz der gewonnenen Erkenntnisse.
- Definition und Wirkung von persuasiver Kommunikation
- Einstellungsbildung und -änderung
- Der Yale-Ansatz und seine zentralen Befunde
- Informationsverarbeitungsmodelle (z.B. Elaboration-Likelihood-Modell)
- Praxisbezug persuasiver Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses von persuasiver Kommunikation, beginnend mit dem Johannesevangelium und Aristoteles' Drei Arten der Überzeugung. Sie stellt den historischen Kontext heraus, unterscheidet zwischen sokratischer und sophistischer Rhetorik und kündigt den Fokus der Arbeit auf empirische Persuasionsforschung des 20. Jahrhunderts an.
2. Definition des Persuasionsbegriffs: Dieses Kapitel definiert persuasive Kommunikation als einen kommunikativen Akt, der primär auf die Änderung der Einstellung des Rezipienten abzielt, unabhängig von der Informationsqualität oder Nützlichkeit der Botschaft. Es unterstreicht den konnotativen Charakter persuasiver Kommunikation und den oftmals im Dunkeln bleibenden Motiv des Senders.
3. Einstellung: Dieses Kapitel behandelt die Einstellungsbildung, die als Ergebnis direkter und indirekter Erfahrungen beschrieben wird und aus kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Komponenten besteht. Es unterscheidet zwischen expliziten und impliziten Einstellungen und legt dar, wie diese auf der Bewusstseinsebene bzw. unbewusst wirken. Weiterhin wird die Einstellungsänderung thematisiert, im Besonderen der Zusammenhang zwischen Verhaltensänderung und kognitiver Dissonanz und deren Auflösung durch interne Rechtfertigung.
4. Erste empirische Erkenntnisse der Persuasionsforschung: Dieses Kapitel beschreibt den Yale-Ansatz der Persuasionsforschung der 1950er Jahre, finanziert von der Rockefeller-Stiftung und initiiert durch einen Auftrag der US-Armee. Es fasst die zentralen Erkenntnisse der zahlreichen Experimente mit der Formel „Wer sagt was zu wem“ zusammen und erwähnt die Studie von Hovland und Weiss (1951) zum Einfluss der Quelle Glaubwürdigkeit auf die Informationsaufnahme.
5. Informationsverarbeitungsmodell: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Informationsverarbeitungsmodellen, die das Verständnis persuasiver Kommunikation vertiefen. Es werden das Elaboration-Wahrscheinlichkeits-Modell und das Heuristisch-Systematische-Modell als Beispiele genannt.
6. Praxisreflexion: (Kapitelzusammenfassung fehlt, da der Text an dieser Stelle endet)
Schlüsselwörter
Persuasive Kommunikation, Einstellungsänderung, Yale-Ansatz, Informationsverarbeitungsmodelle, Elaboration-Likelihood-Modell, Heuristisch-Systematisches Modell, Einstellungsbildung, kognitive Dissonanz, Quelle Glaubwürdigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Persuasive Kommunikation
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit persuasiver Kommunikation und ihrer Wirkung auf Einstellungen. Sie untersucht empirische Erkenntnisse der Persuasionsforschung, insbesondere den Yale-Ansatz, und erläutert verschiedene Informationsverarbeitungsmodelle. Ein Praxisbezug der gewonnenen Erkenntnisse wird ebenfalls reflektiert.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Wirkung persuasiver Kommunikation, Einstellungsbildung und -änderung, den Yale-Ansatz und seine zentralen Befunde, Informationsverarbeitungsmodelle (z.B. Elaboration-Likelihood-Modell) und den Praxisbezug persuasiver Kommunikation.
Was ist der Yale-Ansatz und welche Rolle spielt er in der Arbeit?
Der Yale-Ansatz, ein wichtiger Bestandteil der Persuasionsforschung der 1950er Jahre, wird ausführlich vorgestellt. Die Arbeit fasst die zentralen Erkenntnisse der zahlreichen Experimente des Yale-Ansatzes zusammen, die mit der Formel „Wer sagt was zu wem“ beschrieben werden können. Die Studie von Hovland und Weiss (1951) zum Einfluss der Quelle-Glaubwürdigkeit auf die Informationsaufnahme wird ebenfalls erwähnt.
Welche Informationsverarbeitungsmodelle werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Informationsverarbeitungsmodelle, die das Verständnis persuasiver Kommunikation vertiefen. Als Beispiele werden das Elaboration-Likelihood-Modell und das Heuristisch-Systematische Modell genannt.
Wie wird der Begriff der „Einstellung“ in der Arbeit definiert und behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einstellungsbildung als Ergebnis direkter und indirekter Erfahrungen, bestehend aus kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Komponenten. Es wird zwischen expliziten und impliziten Einstellungen unterschieden und der Zusammenhang zwischen Verhaltensänderung und kognitiver Dissonanz und deren Auflösung durch interne Rechtfertigung erläutert.
Wie wird persuasive Kommunikation definiert?
Persuasive Kommunikation wird als kommunikativer Akt definiert, der primär auf die Änderung der Einstellung des Rezipienten abzielt, unabhängig von der Informationsqualität oder Nützlichkeit der Botschaft. Der konnotative Charakter persuasiver Kommunikation und das oft unbekannte Motiv des Senders werden betont.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit und worum geht es in ihnen?
Die Seminararbeit umfasst Kapitel zu Einleitung (historischer Kontext persuasiver Kommunikation), Definition des Persuasionsbegriffs, Einstellung (Bildung und Änderung), ersten empirischen Erkenntnissen der Persuasionsforschung (insbesondere der Yale-Ansatz), Informationsverarbeitungsmodellen und einer Praxisreflexion (letzteres Kapitel ist im vorliegenden Auszug unvollständig).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Persuasive Kommunikation, Einstellungsänderung, Yale-Ansatz, Informationsverarbeitungsmodelle, Elaboration-Likelihood-Modell, Heuristisch-Systematisches Modell, Einstellungsbildung, kognitive Dissonanz, Quelle-Glaubwürdigkeit.
Welche Quellen werden in der Einleitung erwähnt?
Die Einleitung erwähnt das Johannesevangelium und Aristoteles' drei Arten der Überzeugung, um den historischen Kontext persuasiver Kommunikation zu beleuchten. Es wird zwischen sokratischer und sophistischer Rhetorik unterschieden.
- Citar trabajo
- Nina Hesse (Autor), 2015, Persuasive Kommunikation. Die Kunst der Überredung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342245