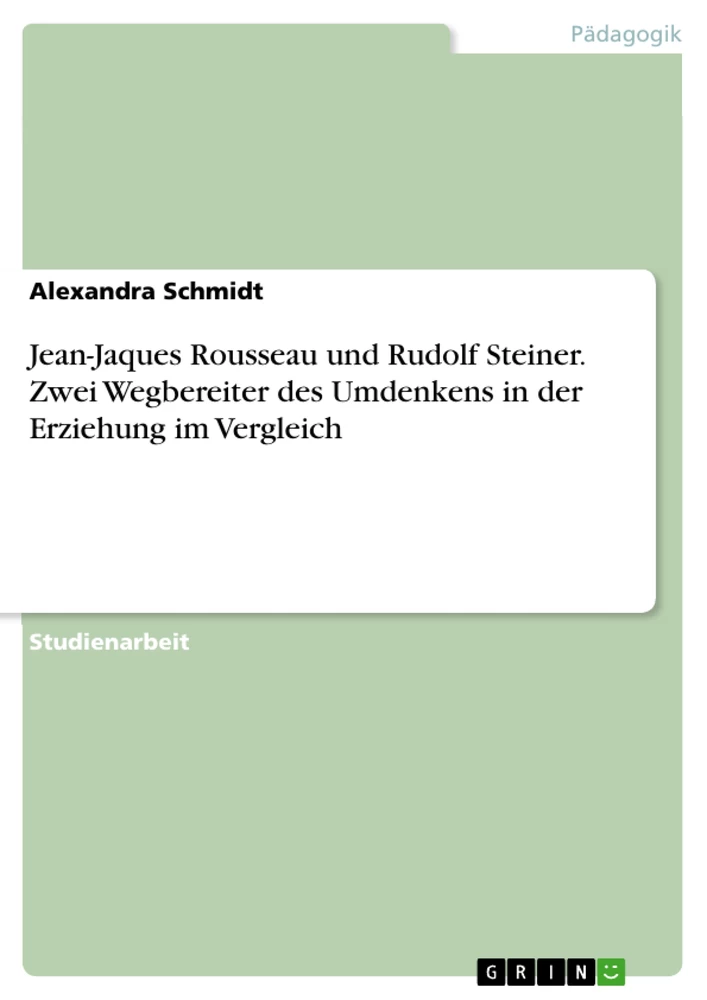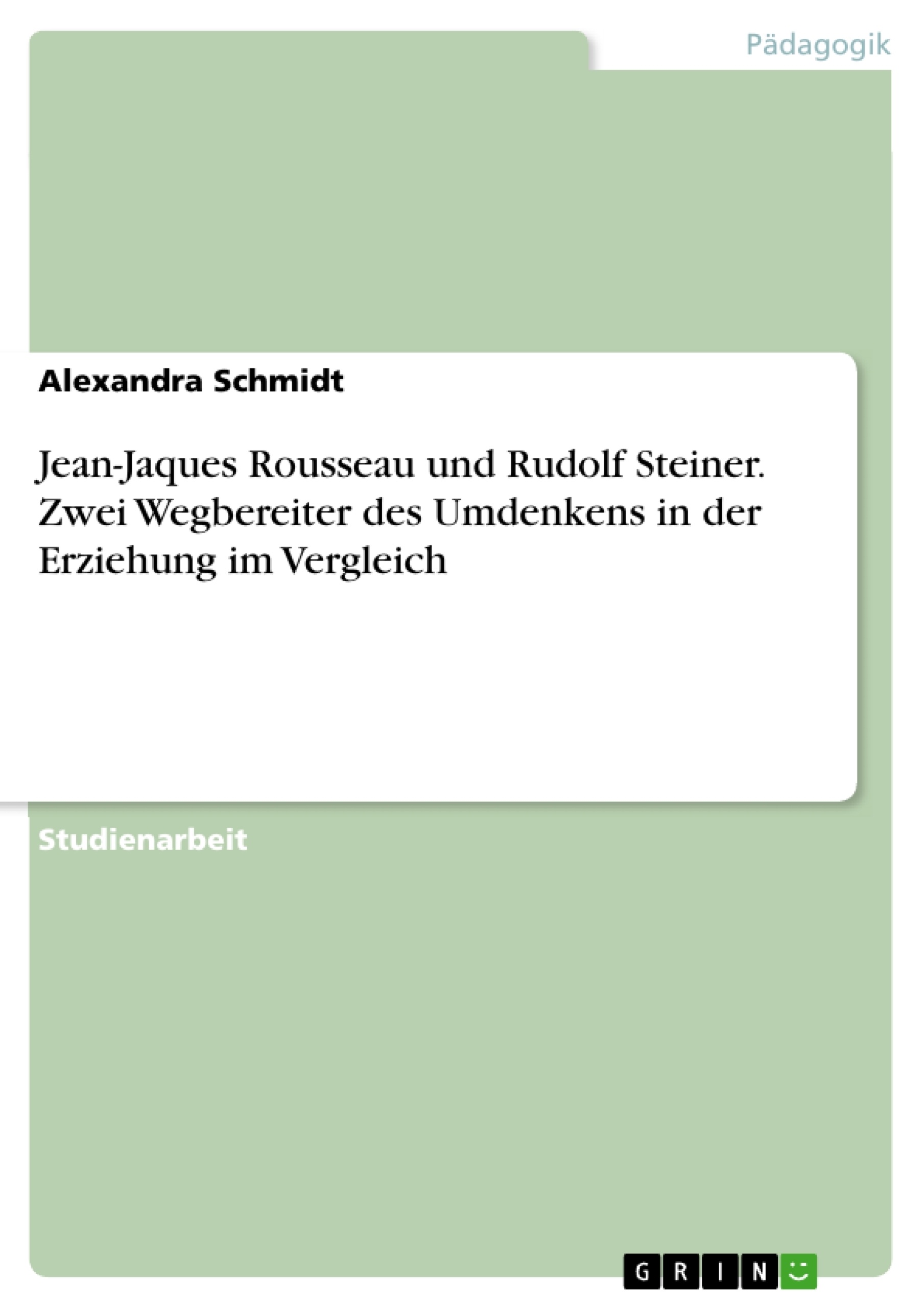Die Bedeutung von Erziehung ist in unserer heutigen Gesellschaft wichtiger denn je in unserer Geschichte. Hat sich das Kinderbild der Erwachsenen doch im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte drastisch geändert. Galten Kinder noch bis zum Anfang des achtzehnten Jahrhunderts als kleine Erwachsene und bedurften der damaligen Anschauung nach keiner besonderen Behandlung, so werden sie heute in Zeiten der rückläufigen Geburtenraten, oft von den Eltern glorifiziert und müssen die Wünsche und Erwartungen dieser in sich bündeln.
Die Eltern des 2010er Jahrzehnts stehen hingegen unter dem Druck ihre Söhne und Töchter unbedingt fördern zu müssen, im Hinblick auf eine Zukunft die in unserem Kulturkreis vor allem auf einen hohen Lebensstandard und finanziellem Erfolg ausgerichtet ist.
Frühförderung im Kindergartenalter und Schulreformen im Jahrestakt sind Schlagworte der Erziehung. Gleichzeitig geben schlechte PISA Ergebnisse und wachsender Schulunmut den öffentlichen pädagogischen Einrichtungen ein negatives Bild und Ansehen.
Schüler und Schülerinnen verlassen immer früher die Schule, sowohl durch die auf acht Jahre verkürzte Gymnasialzeit oder des Wegfalls des Sitzenbleibens zum Beispiel in Hamburg um eine Berufsausbildung zu absolvieren und dem Arbeitsmarkt schnellstmöglich zur Verfügung zu stehen. Mit dem Anspruch, dass in kürzerer Zeit derselbe Stoff qualitativ gleichwertig erlernt wird. Von Pädagogen und Pädagoginnen wird erwartet diesem Bildungsanspruch gerecht zu werden und gleichzeitig noch erzieherisch auf die Kinder einzuwirken.
Mädchen und Jungen verschiedenster Charaktere und Biografien denen im 45 Minuten Takt derselbe Unterrichtsstoff auf dieselbe Weise vermittelt wird. Was schon Klaus Holzkamp 1992 in „Die Fiktion administrativer Planbarkeit schulischer Lernprozesse“ kritisch bemängelte. Um diesem Tempo gerecht zu werden, wird mit der Frühförderung und dem Leistungsdruck schon im Kindergartenalter begonnen.
Wie steht nun diese Entwicklung im Einklang mit den Pädagogen und Pädagoginnen, welche die Wegbereiter unserer heutigen Erziehungskonzepte sind. Als einer der ursprünglichsten Wegbereiter der Pädagogik und des Bildes des Kindes in der Gesellschaft, kann der schweizerisch-französische Philosoph und Pädagoge Jean-Jaques Rousseau genannt werden. Oft zitiert und kontrovers diskutiert, ebenso wie der Urheber der Anthroposophie und Begründer der Waldorf Pädagogik, Rudolf Steiner.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Leben Rousseaus
- Jean-Jaques Rousseau - Kurzbiografie
- Die Epoche der Aufklärung, Gesellschaftskritik
- Das Erziehungskonzept - Emile oder Über die Erziehung
- Negative Erziehung
- Rudolf Steiner und die Waldorfpädagogik
- Rudolf Steiner - Kurzbiografie
- Grundzüge der Anthroposophie
- Waldorfschulen und die Pädagogik
- Vergleich Jean-Jaques Rousseau und Rudolf Steiner
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den beiden bedeutenden Pädagogen Jean-Jaques Rousseau und Rudolf Steiner und analysiert ihre Beiträge zur Entwicklung des modernen Erziehungskonzepts. Der Fokus liegt auf dem Vergleich ihrer Lebensläufe, ihrer pädagogischen Ansätze und deren Einfluss auf die heutige Bildungslandschaft.
- Das Kinderbild in der Aufklärung und im 20. Jahrhundert
- Die Bedeutung von Natur und Erfahrung in der Erziehung
- Kritik an traditionellen Bildungssystemen
- Individuelle Entwicklung und Selbstbestimmung
- Die Rolle von Kunst und Kultur in der Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die Bedeutung von Erziehung in der heutigen Gesellschaft. Sie zeigt die Veränderungen im Kinderbild und den Herausforderungen der modernen Bildungslandschaft auf.
Das Leben Rousseaus
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Leben von Jean-Jacques Rousseau, einschließlich seiner frühen Jahre, seiner Beziehung zu Madame de Warens und seinen literarischen Werken. Es beschreibt auch den Einfluss der Aufklärung auf sein Denken und sein Erziehungskonzept.
Rudolf Steiner und die Waldorfpädagogik
Dieses Kapitel behandelt das Leben und die Ideen von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik. Es stellt die Grundprinzipien der Anthroposophie vor und erläutert die pädagogischen Prinzipien der Waldorfschulen.
Vergleich Jean-Jaques Rousseau und Rudolf Steiner
Dieses Kapitel vergleicht die pädagogischen Ansätze von Rousseau und Steiner und analysiert ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Es untersucht den Einfluss ihrer Ideen auf die heutige Bildungslandschaft und die Relevanz ihrer Werke für die Pädagogik des 21. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Erziehung und Bildung, insbesondere mit den Theorien von Jean-Jacques Rousseau und Rudolf Steiner. Wichtige Themen sind die Bedeutung von Natur und Erfahrung, Kritik an traditionellen Bildungssystemen, individuelle Entwicklung, Selbstbestimmung, Kunst und Kultur in der Pädagogik, sowie die Waldorfpädagogik und die Anthroposophie.
Häufig gestellte Fragen
Was war Jean-Jacques Rousseaus Erziehungskonzept?
In "Emile oder Über die Erziehung" propagierte Rousseau eine "negative Erziehung", bei der das Kind vor schädlichen gesellschaftlichen Einflüssen geschützt wird und durch eigene Erfahrung in der Natur lernt.
Was sind die Grundzüge der Waldorfpädagogik von Rudolf Steiner?
Sie basiert auf der Anthroposophie und betont die ganzheitliche Entwicklung von "Kopf, Herz und Hand" sowie die Berücksichtigung von Jahrsiebten in der kindlichen Entwicklung.
Wie hat sich das Kinderbild seit dem 18. Jahrhundert verändert?
Früher galten Kinder als "kleine Erwachsene". Heute werden sie oft glorifiziert, stehen aber unter hohem Leistungsdruck durch Frühförderung und Erwartungen an finanziellen Erfolg.
Welche Gemeinsamkeiten haben Rousseau und Steiner?
Beide übten scharfe Kritik an den traditionellen, administrativen Bildungssystemen ihrer Zeit und forderten eine Erziehung, die sich am Wesen des Kindes orientiert.
Was kritisierte Klaus Holzkamp an modernen Schulen?
Er bemängelte die "Fiktion administrativer Planbarkeit", also den Versuch, Lernprozesse starr vorzugeben, ohne auf die individuellen Biografien der Kinder einzugehen.
- Quote paper
- Alexandra Schmidt (Author), 2014, Jean-Jaques Rousseau und Rudolf Steiner. Zwei Wegbereiter des Umdenkens in der Erziehung im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342426