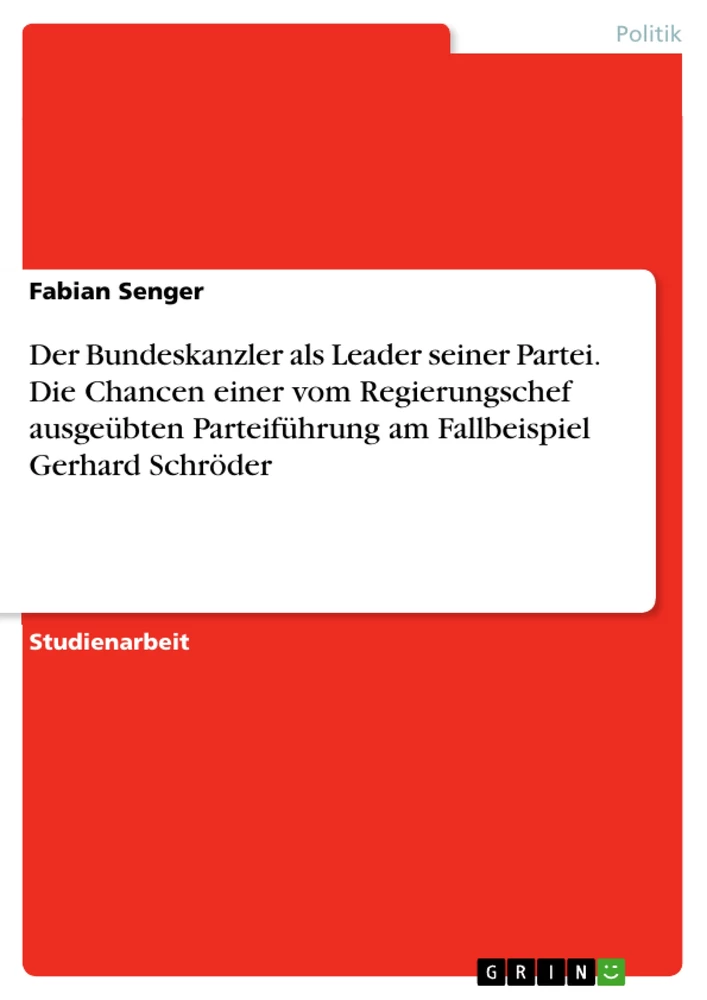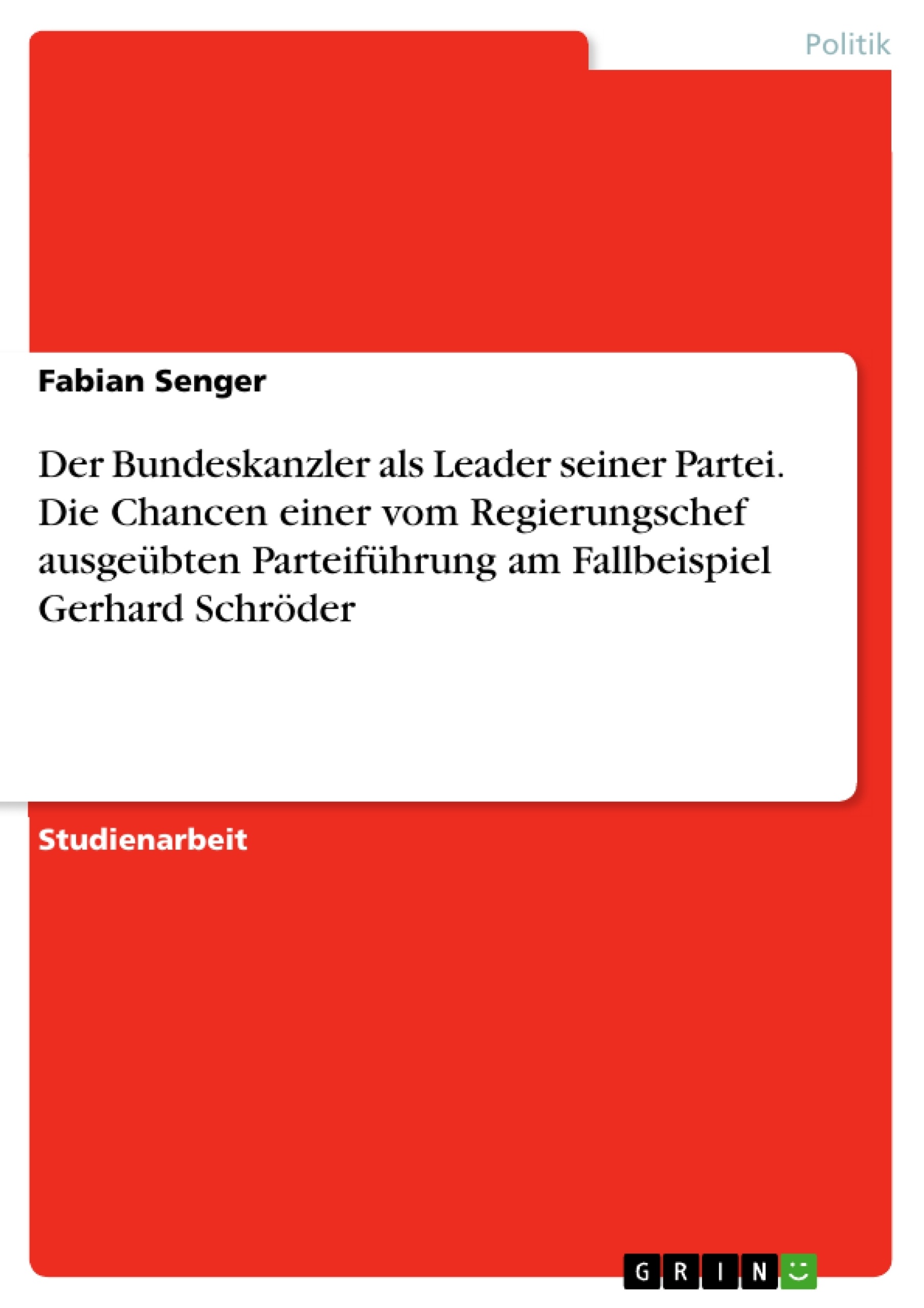Die Rolle des Bundeskanzlers in dem parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland ist herausragend. Seine Entwicklung von einem vergleichsweise schwachen Amt, das in der Weimarer Republik ohne Frage der Machtfülle des Reichspräsidenten nachstand, in eine maßgebende Position der Politikgestaltung ist prägend für die zweite deutsche Demokratie. Es verwundert daher kaum, dass in weiten Teilen der Politikwissenschaft die Rede von einer „Kanzlerdemokratie“ ist.
Doch auch wenn das Grundgesetz dem Regierungschef weitreichende Kompetenzen einräumt, so legt es ihm doch zugleich auch in der tagespolitischen Ausübung seines Amtes eine Handvoll Vetospieler in den Weg, die diesen Spielraum erneut einengen, sei es die Opposition im Bundestag oder seien es bindende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. In diesem Zusammenhang ist es dann entscheidend, auf welche Machtmittel sich die Kanzlerschaft stützt. Eine dieser Stützen ist die Partei des Regierungschefs. Sicher nicht grundlos erwähnt Korte in nahezu jeder seiner Schriften, dass „Kanzlermacht immer Parteimacht ist“.
Zudem werden Regierungschefs auch medial immer wieder unter dem Aspekt beobachtet, wie ihre Bindung zu der eigenen Parteibasis ist. Die Kanzlerschaft von Gerhard Schröder (1998-2005) dient hierfür als gutes Beispiel. Während er in dualer Führung mit Oskar Lafontaine zu Beginn seiner Regierungszeit als einer der Retter der Sozialdemokratie aus den Tiefen der Opposition erschien, wurde spätestens nach der Übernahme des Parteivorsitzes immer mehr innerparteiliche Kritik am Regierungsstil Schröders laut. Bemerkenswert ist hierbei, dass Schröder erst während seiner Regierungszeit den Parteivorsitz erlangte und noch vor seiner Abwahl als Regierungschef den Vorsitz wieder abgab. Im Anschluss daran bildet sich die Frage nach einem direkten Zusammenhang heraus. Hat Schröder als Folge des Verlustes seines Parteivorsitzes, und damit einhergehend der Parteimacht, seine Kanzlerschaft verloren? Was ist überhaupt Parteimacht? Ist es für den Kanzler zwingend notwendig, den Parteivorsitz seiner Regierungspartei innezuhaben? Existiert nicht vielmehr ein grundlegender repräsentativer Widerspruch zwischen beiden Ämtern? Gibt es vielleicht noch andere Machtmittel oder Optionen, die den Verlust der sogenannten Parteimacht kompensieren könnten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kanzlerdemokratie vs. Parteiendemokratie – Zwei Arten einer Spielweise?
- Kanzlerdemokratie unter der Vormacht der Partei?
- Die Parteiendemokratie als Spielball der Regierungschefs?
- Zwischenfazit
- Parteivorsitz als „,Chefsache“?
- Der Regierungsstil von Gerhard Schröder
- Die SPD als Kanzlerpartei?
- Die SPD und ihre Führung
- Schröder und die SPD
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Rolle des Bundeskanzlers als Parteiführer und untersucht, ob und inwiefern eine vom Regierungschef ausgeübte Parteiführung die Chancen einer erfolgreichen Regierungszeit beeinflusst. Dabei wird das Fallbeispiel Gerhard Schröder betrachtet, der während seiner Amtszeit den Parteivorsitz der SPD innehatte. Die Arbeit analysiert die spezifischen Rahmenbedingungen von Kanzlerdemokratie und Parteiendemokratie, um die Herausforderungen und Chancen einer dualen Führungsrolle zu beleuchten.
- Die Rolle des Bundeskanzlers im parlamentarischen System der Bundesrepublik Deutschland
- Die Beziehung zwischen Kanzlerdemokratie und Parteiendemokratie
- Die Chancen und Herausforderungen einer vom Regierungschef ausgeübten Parteiführung
- Die Kanzlerschaft von Gerhard Schröder und die SPD
- Die Bedeutung der Parteimacht für die Regierungsführung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen Parteimacht und Kanzlerschaft in den Vordergrund. Das erste Kapitel behandelt die Konzepte der Kanzlerdemokratie und der Parteiendemokratie und beleuchtet deren spezifische Rahmenbedingungen. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Kanzlerschaft von Gerhard Schröder und analysiert seine Rolle als Parteivorsitzender der SPD. Es untersucht, wie sein Regierungsstil die Beziehung zur Partei beeinflusste und welche Auswirkungen die Parteimacht auf seine Regierungszeit hatte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Kanzlerdemokratie, Parteiendemokratie, Parteimacht, Regierungsführung, Regierungsstil, Gerhard Schröder, SPD, Interessenkonflikt, dualer Führung, politische Macht, Bundeskanzler, Bundesrepublik Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine „Kanzlerdemokratie“?
Dieser Begriff beschreibt die herausragende Machtstellung des Bundeskanzlers im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland.
Warum ist der Parteivorsitz für einen Kanzler wichtig?
Kanzlermacht stützt sich oft auf Parteimacht. Der Vorsitz sichert den Rückhalt in der eigenen Partei und erleichtert die Durchsetzung politischer Ziele im Parlament.
Wie veränderte sich Gerhard Schröders Verhältnis zur SPD?
Schröder begann als „Retter“ der SPD, sah sich aber später massiver innerparteilicher Kritik an seinem Regierungsstil ausgesetzt, was schließlich zur Abgabe des Parteivorsitzes führte.
Gibt es einen Widerspruch zwischen Staatsamt und Parteiamt?
Ja, es kann ein repräsentativer Widerspruch bestehen, da der Kanzler das ganze Volk vertreten soll, während der Parteivorsitzende primär die Interessen seiner Partei vertritt.
Was sind „Vetospieler“ im politischen System?
Vetospieler sind Akteure, die politische Entscheidungen blockieren oder beeinflussen können, wie die Opposition, der Bundesrat oder das Bundesverfassungsgericht.
- Quote paper
- Fabian Senger (Author), 2015, Der Bundeskanzler als Leader seiner Partei. Die Chancen einer vom Regierungschef ausgeübten Parteiführung am Fallbeispiel Gerhard Schröder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342546