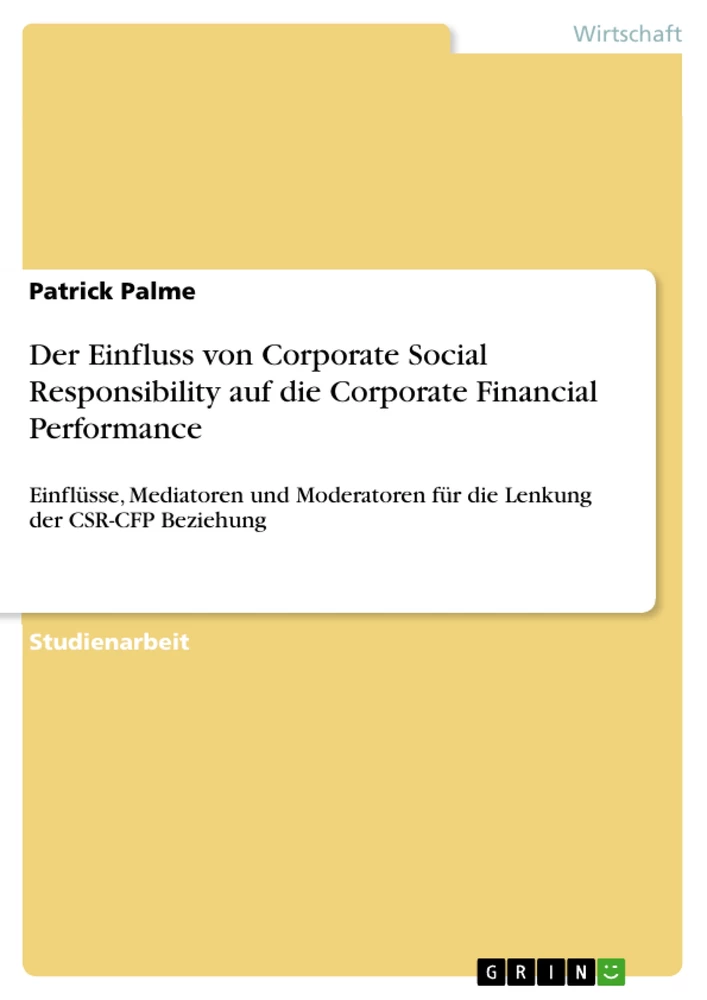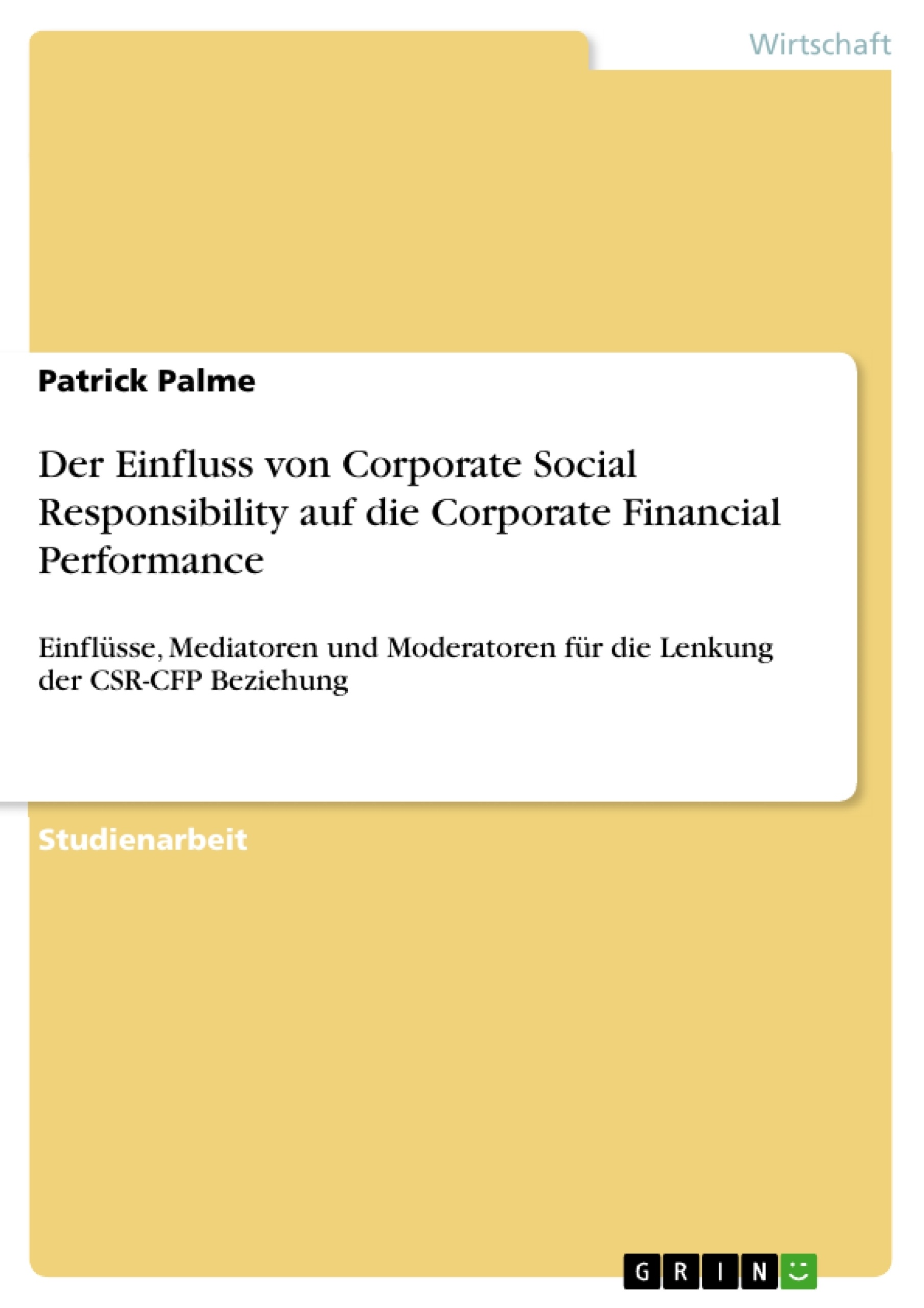Unternehmen stehen in der heutigen Zeit neben dem Erhalt der Wirtschaftlichkeit und dem Erzielen von Gewinnen einem weiteren Faktor, nämlich der sozialen Verantwortung für Mensch, Umwelt und Moral, gegenüber. Die Zusammenhänge der Corporate Social Responsibility (CSR) und der Corporate Financial Performance (CFP) sind bereits seit einigen Jahren ein stark diskutiertes Thema in diversen Wirtschafts-, Ethik- und Fachstudien sowie verschiedenen Untersuchungen und Fachschriften.
Politik und Wirtschaft stellen sich darauf ein und implementieren Strategien, die pro-moralische Anreize schaffen und auf Unternehmensseite dem steigenden Interesse an sozialer Verantwortung nachkommen sollen. Einer Umfrage der Dr. Grieger & Cie. Marktforschung (2016) nach ist ein Großteil der Kunden bereit, mehr für Produkte auszugeben, die aus sozial engagierten Unternehmen kommen und gleichwertig mit denen von rein profitorientierten Unternehmen sind.
Aus ökonomischer Sichtweise gilt es zu bewerten, ob sich das Engagement in soziale Projekte lohnt und inwiefern die Beziehung zwischen CSR und CFP durch verschiedene Aspekte beeinflusst und bestimmt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzeptionelle Grundlagen
- 2.1 Begriffserklärung
- 2.1.1 Corporate Social Responsibility
- 2.1.2 Corporate Financial Performance
- 2.2 Theorieansatz
- 2.1 Begriffserklärung
- 3. CSR-CFP Beziehung
- 3.1 Vorliegende Erkenntnisse
- 3.2 Lenkende Mediatoren und Moderatoren der CSR-CFP Beziehung
- 3.2.1 Mediatoren
- 3.2.2 Moderatoren
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Corporate Social Responsibility (CSR) auf die Corporate Financial Performance (CFP) und analysiert die Faktoren, die diese Beziehung beeinflussen. Das Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen sozialem Engagement und wirtschaftlichem Erfolg zu entwickeln.
- Definition und Abgrenzung der Konzepte CSR und CFP
- Analyse der empirischen Forschungsergebnisse zur CSR-CFP Beziehung
- Identifizierung von Mediatoren und Moderatoren, die die CSR-CFP Beziehung beeinflussen
- Diskussion der Implikationen der Ergebnisse für Unternehmen und die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Relevanz des Themas CSR und CFP vor und beleuchtet die aktuelle Debatte um die Verbindung zwischen sozialem Engagement und wirtschaftlicher Performance. Es werden die Forschungsfragen und die Struktur der Arbeit vorgestellt.
- Kapitel 2: Konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe CSR und CFP und beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze, die die Beziehung zwischen CSR und CFP erklären können.
- Kapitel 3: CSR-CFP Beziehung: Dieses Kapitel analysiert die empirische Forschung zur CSR-CFP Beziehung und diskutiert die wichtigsten Erkenntnisse. Es werden verschiedene Mediatoren und Moderatoren identifiziert, die die Beziehung zwischen CSR und CFP beeinflussen können.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Financial Performance (CFP), Nachhaltigkeit, Stakeholder-Engagement, Reputation, Wettbewerbsvorteil, Mediatoren, Moderatoren, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR bezeichnet die soziale und ökologische Verantwortung von Unternehmen gegenüber der Gesellschaft, die über gesetzliche Anforderungen hinausgeht.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen CSR und finanziellem Erfolg (CFP)?
Die Forschung zeigt oft eine positive Korrelation: Soziales Engagement kann die Reputation verbessern, Kunden binden und langfristig die finanzielle Performance steigern.
Was sind Mediatoren in der CSR-CFP-Beziehung?
Mediatoren sind Faktoren, durch die CSR wirkt, wie zum Beispiel eine verbesserte Reputation, höhere Mitarbeiterzufriedenheit oder gesteigerte Innovationskraft.
Sind Kunden bereit, für CSR-Produkte mehr zu zahlen?
Umfragen zufolge ist ein Großteil der Kunden bereit, einen Aufpreis für Produkte von sozial engagierten Unternehmen zu zahlen, sofern die Qualität gleichwertig ist.
Welche Rolle spielen Stakeholder für die CSR?
Stakeholder (Kunden, Mitarbeiter, Investoren) fordern heute vermehrt moralisches Handeln. Unternehmen, die diese Erwartungen erfüllen, können Wettbewerbsvorteile erzielen.
- Quote paper
- Patrick Palme (Author), 2016, Der Einfluss von Corporate Social Responsibility auf die Corporate Financial Performance, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342578