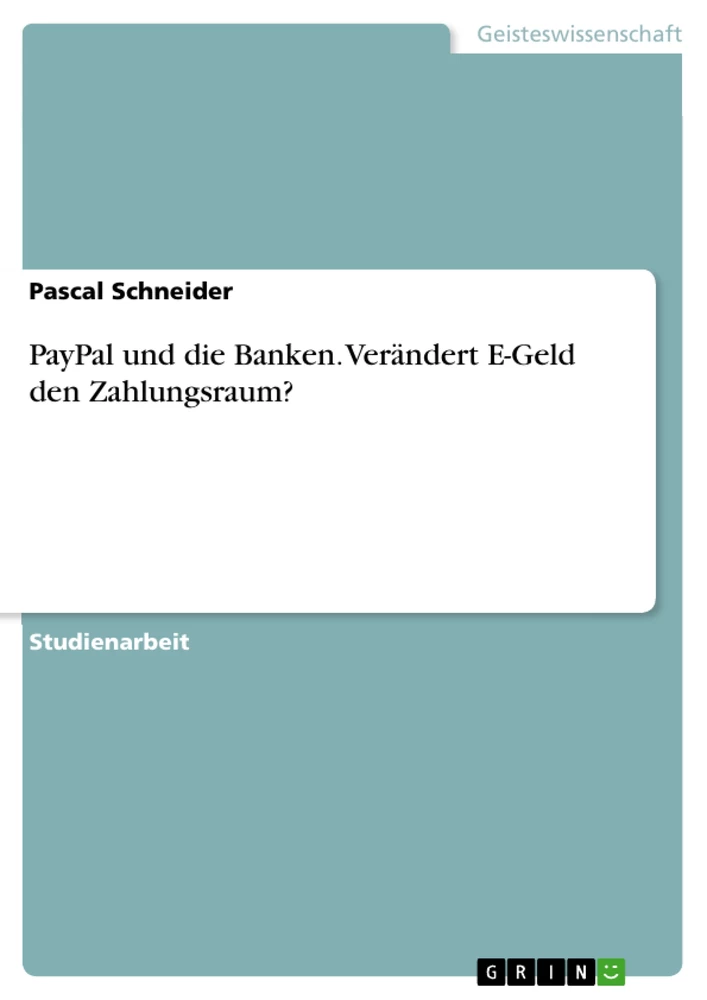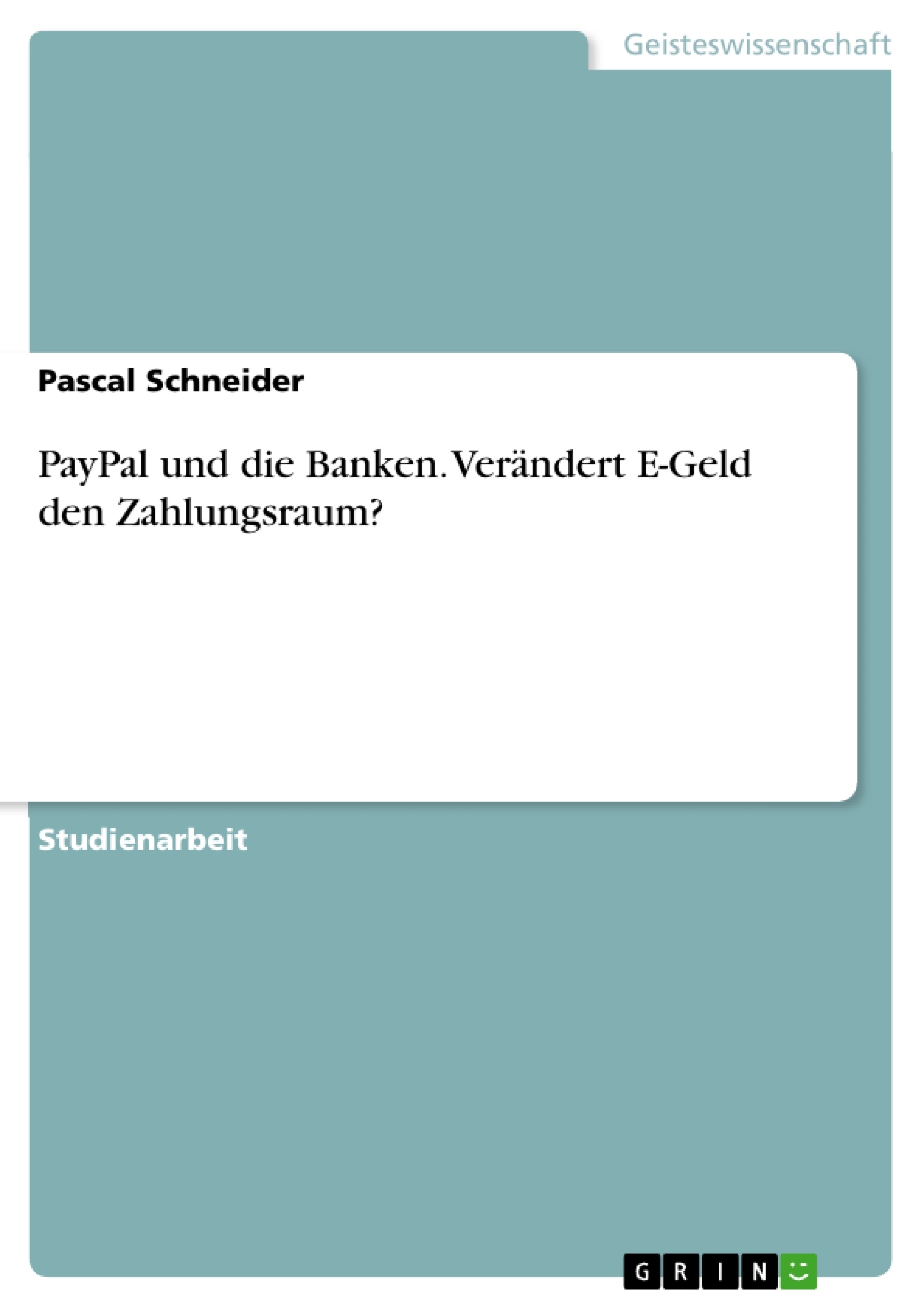PayPal ermöglicht seit einigen Jahren schon einfache Zahlungen im Internet. Die Banken versuchen mittlerweile mehr oder weniger ungeschickt, selbst einfachere Lösungen anzubieten, etwa mit Paydirekt. Auch die EU drängt mit SEPA und der neuen Zahlungsdiensterichtlinie PSD II zum Handeln der Banken. Nicht nur Zahlungsdienstleister wie PayPal oder auch direktüberweisung.de, sondern auch viele andere, auf die vielfältigsten Finanzbereiche spezialisierte Fintechs bedrohen das Geschäft der Banken.
Der finanzsoziologischen Arbeit dient die Systemtheorie von Niklas Luhmann und Dirk Baecker als Orientierung in der komplexen Finanzwelt. Was sind Zahlungen? Wie laufen sie ab? Und wie kann dem Finanzsystem Vertrauen geschenkt werden? Eine soziologische Arbeit, die Spuren von Jura und Ökonomie enthalten kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problematik und Fragestellung
- 1.1 PayPal - Auf dem Weg zum Monopolisten
- 1.2 E-Geld und Guthaben
- 1.3 Fragestellung
- 2 Zahlungen
- 2.1 Vertrauen und Risiko
- 2.2 Auswirkungen auf Banken
- 2.3 Zwischenfazit
- 3 Empirie
- 3.1 Zahlungen
- 3.2 Vertrauen und Risiko
- 3.3 Auswirkungen auf Banken
- 3.4 Zwischenfazit
- 4 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von PayPal auf den europäischen Zahlungsraum. Ziel ist es, die Motive für die zunehmende Nutzung von PayPal zu ergründen und die daraus resultierenden Veränderungen im bestehenden, politisch gestalteten System zu analysieren. Die Arbeit betrachtet dabei den Aufstieg von PayPal im Kontext der Digitalisierung und der Rolle von E-Geld.
- Der Aufstieg von PayPal als dominierender Online-Zahlungsdienstleister.
- Die Bedeutung von E-Geld und dessen Auswirkungen auf das traditionelle Bankensystem.
- Die Rolle von Vertrauen und Risiko im Zusammenhang mit E-Geld-Zahlungen.
- Die Veränderungen im europäischen Zahlungsraum durch die Nutzung von PayPal.
- Das Verhältnis von Staat und Wirtschaft im Kontext von digitalen Zahlungsmitteln.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problematik und Fragestellung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet den Aufstieg von PayPal im Kontext des Online-Handels und der unzureichenden Reaktion der traditionellen Banken auf die Digitalisierung. Es wird die zunehmende Dominanz von PayPal im Markt für Online-Zahlungen hervorgehoben und die Notwendigkeit einer Untersuchung der Auswirkungen auf den Zahlungsraum begründet. Die wachsende Popularität von PayPal wird durch statistische Daten belegt, und der Vergleich mit dem deutschen Konkurrenten paydirekt verdeutlicht die eingeschränkten Funktionen und den begrenzten Anwendungsbereich letzterer im Gegensatz zum globalen Angebot von PayPal. Die Einführung des Begriffs des E-Geldes und dessen Relevanz im Kontext von PayPal werden ebenfalls angesprochen. Das Kapitel legt den Grundstein für die darauffolgenden Kapitel, in denen die Auswirkungen von PayPal auf verschiedene Bereiche näher untersucht werden.
2 Zahlungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Funktionsweise von Zahlungen über PayPal und analysiert die damit verbundenen Aspekte von Vertrauen und Risiko sowie die Auswirkungen auf das traditionelle Bankensystem. Es wird der Unterschied zwischen E-Geld und Giralgeld herausgestellt, und die Konsequenzen der unternehmensinternen Abwicklung von PayPal-Transaktionen für die etablierten Zahlungssysteme wie SEPA und TARGET2 werden diskutiert. Das Kapitel vergleicht die Effizienz und die Vereinfachung von grenzüberschreitenden Zahlungen mit PayPal im Vergleich zu traditionellen Bankprozessen. Die Nähe zu einem Girokontoersatz und die fehlende Einlagensicherung stellen zentrale Risiken dar, die im Kontrast zu den Vorteilen einer schnelleren und einfacheren Zahlungsabwicklung stehen.
3 Empirie: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die empirische Analyse von Zahlungen, Vertrauen, Risiko und den Auswirkungen auf die Banken im Kontext von PayPal. Es vertieft die Ergebnisse aus den vorherigen Kapiteln und liefert vermutlich detaillierte Daten und Analysen zu den einzelnen Aspekten. Hier werden wahrscheinlich quantitative und qualitative Daten präsentiert, um die Behauptungen aus den vorherigen Kapiteln zu unterstützen und ein umfassenderes Bild der Auswirkungen von PayPal zu zeichnen. Es wird erwartet, dass dieses Kapitel eine detaillierte Untersuchung der empirischen Befunde enthält und die Schlussfolgerungen für das Verständnis des Einflusses von PayPal auf den europäischen Zahlungsraum festigt.
Schlüsselwörter
PayPal, E-Geld, Online-Zahlungen, Zahlungsraum, Banken, Digitalisierung, Vertrauen, Risiko, SEPA, TARGET2, Einlagensicherung, Europäisches Zahlungssystem, Finanzinstitute, Marktmacht, Währung, Geldtheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Auswirkungen von PayPal auf den europäischen Zahlungsraum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von PayPal auf den europäischen Zahlungsraum. Sie analysiert den Aufstieg von PayPal als dominierenden Online-Zahlungsdienstleister, die Bedeutung von E-Geld und dessen Auswirkungen auf das traditionelle Bankensystem, sowie die Rolle von Vertrauen und Risiko im Zusammenhang mit E-Geld-Zahlungen. Ein weiterer Fokus liegt auf den Veränderungen im europäischen Zahlungsraum durch die Nutzung von PayPal und dem Verhältnis von Staat und Wirtschaft im Kontext digitaler Zahlungsmittel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Problematik und Fragestellung) führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 (Zahlungen) beleuchtet die Funktionsweise von PayPal-Zahlungen, Vertrauen, Risiko und Auswirkungen auf Banken. Kapitel 3 (Empirie) präsentiert die empirische Analyse der vorherigen Kapitel mit detaillierten Daten und Analysen. Kapitel 4 (Fazit und Ausblick) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Aufstieg von PayPal, die Bedeutung von E-Geld, Vertrauen und Risiko bei E-Geld-Zahlungen, die Veränderungen im europäischen Zahlungsraum durch PayPal, und das Verhältnis von Staat und Wirtschaft im Kontext digitaler Zahlungsmittel. Ein Vergleich mit dem deutschen Konkurrenten paydirekt wird ebenfalls angestellt.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit kombiniert qualitative und quantitative Methoden. Kapitel 1 und 2 analysieren den Aufstieg von PayPal und die Funktionsweise des Systems. Kapitel 3 beinhaltet eine detaillierte empirische Analyse, die vermutlich quantitative und qualitative Daten verwendet, um die Behauptungen aus den vorherigen Kapiteln zu stützen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
PayPal, E-Geld, Online-Zahlungen, Zahlungsraum, Banken, Digitalisierung, Vertrauen, Risiko, SEPA, TARGET2, Einlagensicherung, Europäisches Zahlungssystem, Finanzinstitute, Marktmacht, Währung, Geldtheorie.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Motive für die zunehmende Nutzung von PayPal zu ergründen und die daraus resultierenden Veränderungen im bestehenden, politisch gestalteten System zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von PayPal auf den europäischen Zahlungsraum im Kontext der Digitalisierung und der Rolle von E-Geld.
Wie wird der Aufstieg von PayPal dargestellt?
Der Aufstieg von PayPal wird im Kontext des Online-Handels und der unzureichenden Reaktion der traditionellen Banken auf die Digitalisierung dargestellt. Die Arbeit hebt die zunehmende Dominanz von PayPal im Markt für Online-Zahlungen hervor und belegt die wachsende Popularität durch statistische Daten. Ein Vergleich mit paydirekt verdeutlicht die eingeschränkten Funktionen des deutschen Konkurrenten.
Welche Rolle spielt E-Geld in der Arbeit?
E-Geld spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht die Bedeutung von E-Geld und dessen Auswirkungen auf das traditionelle Bankensystem. Der Unterschied zwischen E-Geld und Giralgeld wird herausgestellt, ebenso die Konsequenzen der unternehmensinternen Abwicklung von PayPal-Transaktionen für etablierte Zahlungssysteme wie SEPA und TARGET2.
Wie werden Vertrauen und Risiko behandelt?
Vertrauen und Risiko werden im Zusammenhang mit E-Geld-Zahlungen analysiert. Die Nähe zu einem Girokontoersatz und die fehlende Einlagensicherung werden als zentrale Risiken im Kontrast zu den Vorteilen einer schnelleren und einfacheren Zahlungsabwicklung dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Pascal Schneider (Autor:in), 2016, PayPal und die Banken. Verändert E-Geld den Zahlungsraum?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342624