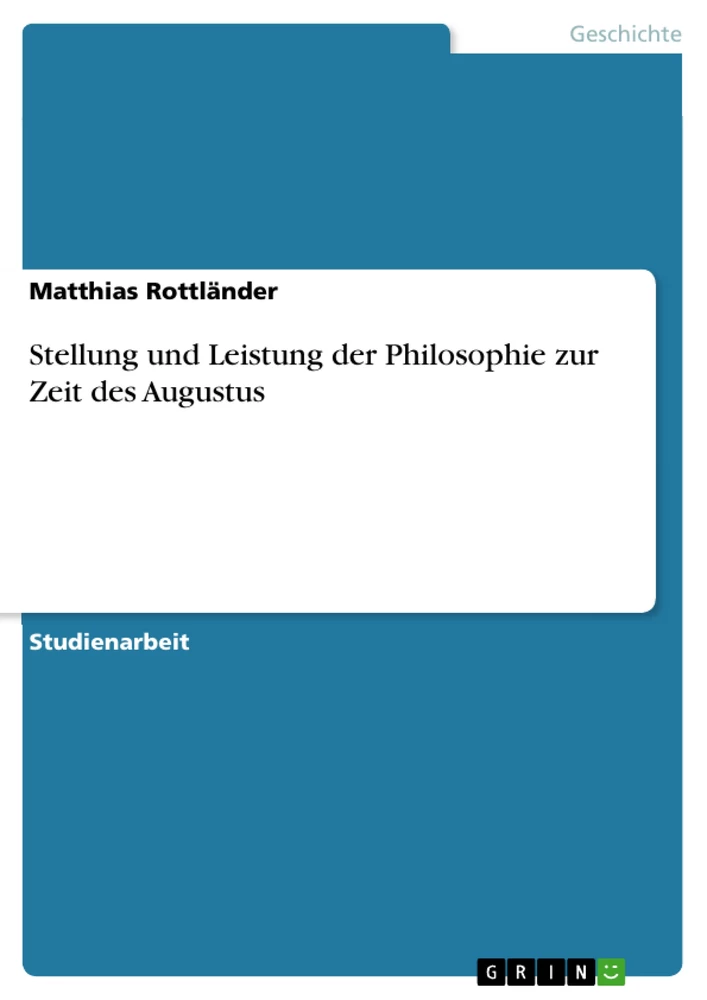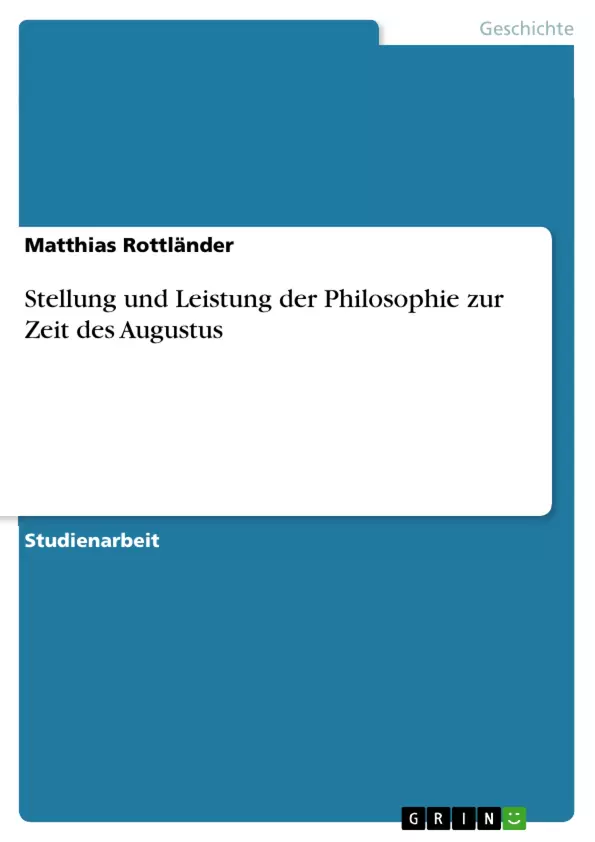Im Gegensatz zur westlichen, säkularisierten Staatenwelt der Moderne zeichnet die antike Weltordnung ein völlig anderes Bild in Bezug auf ihre kulturellen, religiösen und philosophischen Lebensbereiche. Statt einer strikten Trennung, wie sie uns aus unserer heutigen Lebenswelt bekannt ist, muss bei der Analyse antiker gesellschaftlicher Verhältnisse immer die starke Verzahnung verschiedenster Kulturphänomene betrachtet werden.
Die unverkennbare Zäsur zwischen der so genannten libera res publica und der Etablierung der Alleinherrschaft des Augustus hatte Auswirkungen in allen gesellschaftlichen Bereichen und damit auch auf die Stellung der Philosophie. Was kann bzw. darf die Philosophie unter dem Monarchen Augustus noch leisten? Wird sie überhaupt noch gebraucht? Wie werden philosophische (und damit immer auch religiöse, politische und soziale) Diskurse von der Festigung des Prinzipats durch Augustus beeinflusst? Kann die Philosophie immer noch geistiger Vorbereiter und Ideengeber für Politik sein?
Vor allem für die gebildeten Kreise bot die Philosophie Grundsätze des moralisch-richtigen Handelns, sie übernahm die Funktion des mos maiorum. Dieser Anspruch wurde nun auch auf das neu eingerichtete Prinzipat übertragen. Der Monarch sollte in seiner Regierungspolitik ethisch überzeugend vorgehen und ein Vorbild an moralischer Sittlichkeit und Tugend für das Volk darstellen. Hier spiegeln sich die Leitideen römischer Geschichtsauffassung wider: Wohl und Unwohl des römischen Volkes sind immer von seinem moralischen Verhalten abhängig. Tugendhaftes Handeln eines jeden Einzelnen ist „gutes“ Handeln und Voraussetzung für das Wohlergehen des römischen Staates im Laufe von Tradition und Geschichte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Entwicklung der Fragestellung
- Augustus und die Philosophie
- Die Etablierung des Prinzipats im öffentlichen Diskurs
- Pythagoreer, Epikureer, Stoiker und der princeps-Begriff
- ein „tugendhafter“ Philosoph? Der princeps und sein philosophisches Umfeld
- Die,,Hausphilosophen“ des Augustus
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Stellung und Leistung der Philosophie zur Zeit des Augustus, während der Konsolidierung des Prinzipats. Sie untersucht, wie die Philosophie in den politischen, sozialen und religiösen Diskursen der Zeit eingebunden war und welche Rolle sie im Kontext der Etablierung der Alleinherrschaft des Augustus spielte.
- Der Einfluss der Philosophie auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung des römischen Reiches unter Augustus.
- Die Rolle der Philosophie als moralische Richtschnur und Ideengeber für das Prinzipat.
- Die Auswirkungen der Etablierung des Prinzipats auf die Freiheit der philosophischen Diskurse.
- Die Beziehung zwischen Augustus und den Philosophen seiner Zeit.
- Die Rolle der Philosophie in der Legitimation des Prinzipats.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Fragestellung ein und erläutert die Bedeutung der Philosophie im antiken Kontext. Sie beleuchtet die besondere Situation im Zeitalter des Augustus, das durch den Übergang von der Republik zum Prinzipat geprägt war.
Kapitel 2 befasst sich mit der Rolle der Philosophie im Kontext der Etablierung des Prinzipats. Es beleuchtet die strategischen Vorgehensweisen des Augustus und die Auswirkungen auf die philosophischen Diskurse.
Das Resümee fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Philosophie, Augustus, Prinzipat, Römisches Reich, Republik, Politik, Gesellschaft, Religion, moralische Richtschnur, Ideengeber, Legitimation, Diskurs, Einfluss, „tugendhafter“ Herrscher, „Hausphilosophen“, mos maiorum.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte die Philosophie zur Zeit des Augustus?
Die Philosophie diente als moralische Richtschnur für das richtige Handeln und übernahm die Funktion des „mos maiorum“ (Sitten der Vorfahren), um das neue Prinzipat ethisch zu legitimieren.
Was versteht man unter dem Begriff „Prinzipat“?
Das Prinzipat bezeichnet die von Augustus etablierte Herrschaftsform, die formal die Republik wahrte, faktisch aber eine Alleinherrschaft (Monarchie) darstellte.
Welche philosophischen Schulen waren unter Augustus bedeutend?
Die Arbeit untersucht insbesondere die Einflüsse der Pythagoreer, Epikureer und Stoiker auf den Begriff des „princeps“.
Wer waren die „Hausphilosophen“ des Augustus?
Dies waren Gelehrte im direkten Umfeld des Kaisers, die ihn berieten und dazu beitrugen, ihn als „tugendhaften“ Herrscher und Vorbild für das Volk darzustellen.
Inwiefern beeinflusste das Prinzipat die Freiheit der Philosophie?
Die Arbeit analysiert, wie philosophische Diskurse durch die Festigung der Macht beeinflusst wurden und ob die Philosophie weiterhin als unabhängiger Ideengeber für die Politik fungieren konnte.
Warum war die moralische Tugend des Herrschers so wichtig?
Nach römischer Auffassung hingen Wohl und Unwohl des Volkes vom moralischen Verhalten ab. Ein tugendhafter Herrscher war daher die Voraussetzung für das Wohlergehen des gesamten Staates.
- Quote paper
- Matthias Rottländer (Author), 2008, Stellung und Leistung der Philosophie zur Zeit des Augustus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342642