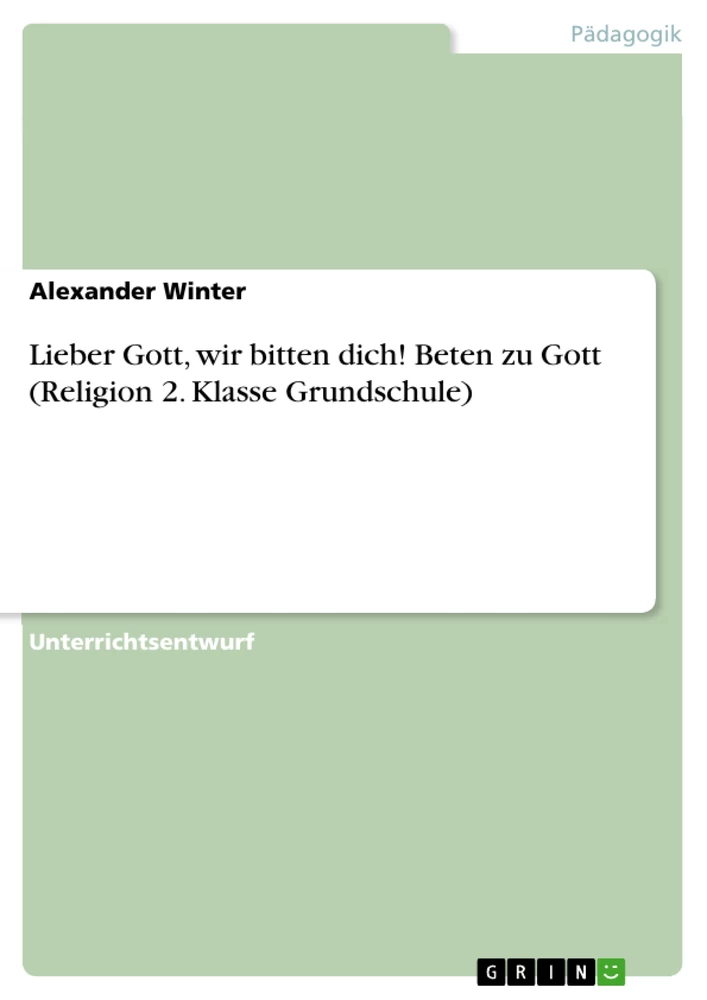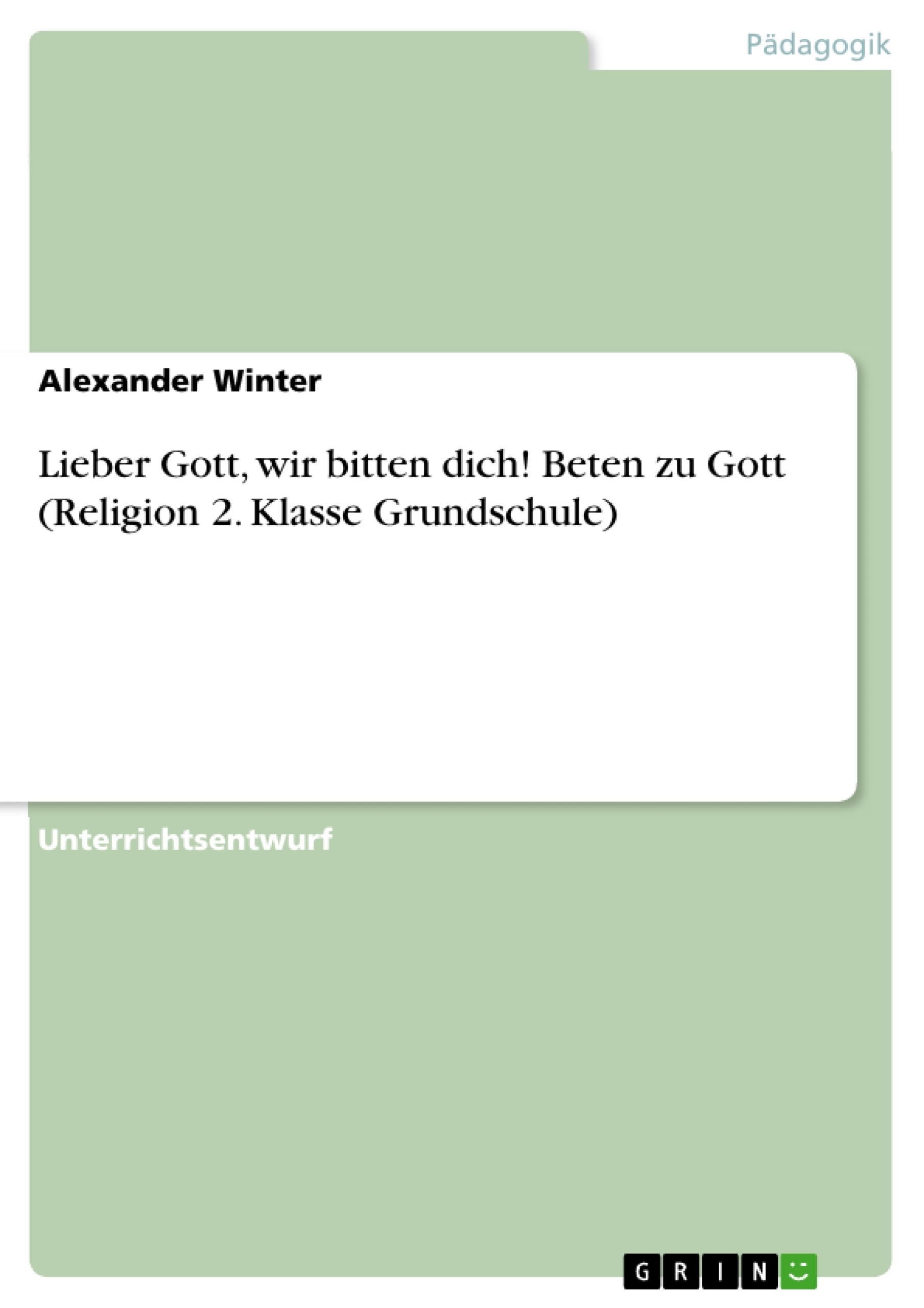Vollständige didaktische Analyse zur Unterrichtsstunde "Lieber Gott, wir bitten dich!" in der 2. Klasse im Katholischen Religionsunterricht.
Beim Thema „Lieber Gott, wir bitten dich“ lernen die Schüler eine Geschichte kennen, bei der es einem Kind nicht so gut geht. Sie berichten von ihren eigenen Erlebnissen und wissen, dass sie immer mit Gott reden dürfen. Die Kinder können ihn darum bitten, dass er sie beschützt oder ihn für andere Menschen bitten. Am Ende verfassen sie ihr eigenes Bittgebet und tragen es vor.
Inhaltsverzeichnis
- Ziele
- Lehrplanbezug
- Beten mit Herz, Mund und Händen
- Stundenziel
- Feinziele
- Sequenzschilderung
- Sachstruktur
- Schülersituation
- Inhaltlicher Schwerpunkt
- Geplanter Unterrichtsverlauf
- Einstimmung
- Motivation
- Begegnung
- Erarbeitung
- Vertiefung
- Reflexion
- Gemeinschaftsarbeit
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtssequenz „Auf vielfältige Weise beten“ soll Kinder der 2. Klasse an verschiedene Gebetsformen und -situationen heranführen. Dabei sollen sie die Bedeutung des Gebets als Ausdruck von Gedanken und Gefühlen vor Gott sowie die vertrauensvolle Grundhaltung des Betens erfahren. Das Vaterunser als zentrales Gebet der Christen soll den Kindern vorgestellt und in seiner Bedeutung erschlossen werden.
- Verschiedene Gebetsformen und -situationen
- Bedeutung des Gebets als Ausdruck von Gedanken und Gefühlen
- Vertrauensvolle Grundhaltung des Betens
- Das Vaterunser als zentrales Gebet der Christen
- Entwicklung eigener Gebetsformen und respektvoller Umgang mit Gebetsformen anderer Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
- Stille suchen: Die Schüler lernen durch verschiedene Wahrnehmungsübungen Stille auf sich wirken zu lassen, um einen Raum der Stille für spätere Gebetsformen zu schaffen.
- Lieber Gott, wir danken dir: Die Schüler erinnern sich an schöne Erlebnisse und danken Gott dafür. Sie begegnen verschiedenen Dankesgebeten und schreiben anschließend ihr eigenes Gebet.
- Lieber Gott, wir bitten dich: Die Schüler lernen eine Geschichte kennen, in der ein Kind Hilfe benötigt, und berichten von eigenen Erlebnissen. Sie erkennen, dass sie Gott um Hilfe bitten können und formulieren eigene Bittgebete.
- Vertrauen können und geliebt werden: Die Schüler lernen die Bedeutung von Vertrauen kennen und beschreiben Situationen, in denen sie auf ihre Eltern angewiesen sind. Sie erkennen, dass Gott sich um sie kümmert wie ein guter Vater oder eine gute Mutter.
- Brot zum Leben haben: Die Schüler erkennen, dass viele Dinge zum Leben notwendig sind, wie Wasser, Brot, Liebe und Rückhalt durch die Familie. Sie lernen, dankbar für das zu sein, was sie haben.
- Bewegtes Vaterunser: Die Schüler lernen das Vaterunser als zentrales Gebet der Christen kennen und entwickeln gemeinsam Bewegungen dazu.
- Unser tägliches Brot gib uns heute: Die Schüler vertiefen die Brotbitte und danken Gott für seine reichlichen Gaben.
- Wie Menschen anderer Religionen beten: Die Schüler begegnen Menschen anderer Kulturen mit Achtung und Ehrfurcht und betrachten Fotos von Muslimen und Juden in ihrer Gebetshaltung.
Schlüsselwörter
Gebet, Gebetsformen, Beten, Vaterunser, Vertrauen, Dankbarkeit, Liebe, Familie, Religionen, Kulturen, Stille, Ausdruck, Gedanken, Gefühle, Gott.
Häufig gestellte Fragen
Was lernen Schüler in der Einheit „Lieber Gott, wir bitten dich“?
Schüler lernen verschiedene Gebetsformen kennen und erfahren, dass sie Gott um Hilfe und Schutz für sich und andere bitten können.
Welche Rolle spielt das Vaterunser im Unterricht?
Es wird als zentrales Gebet der Christen vorgestellt und durch Bewegungen (bewegtes Vaterunser) für die Kinder erschlossen.
Wie wird das Thema „Andere Religionen“ behandelt?
Die Kinder lernen mit Achtung, wie Menschen im Judentum oder Islam beten, um einen respektvollen Umgang mit anderen Kulturen zu fördern.
Was ist das Ziel der „Stille-Übungen“?
Die Schüler sollen lernen, Stille auf sich wirken zu lassen, um einen inneren Raum für das Gebet zu schaffen.
Schreiben die Kinder eigene Gebete?
Ja, die Schüler verfassen sowohl eigene Dankesgebete als auch Bittgebeten basierend auf ihren Erlebnissen.
- Quote paper
- Alexander Winter (Author), 2016, Lieber Gott, wir bitten dich! Beten zu Gott (Religion 2. Klasse Grundschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342680