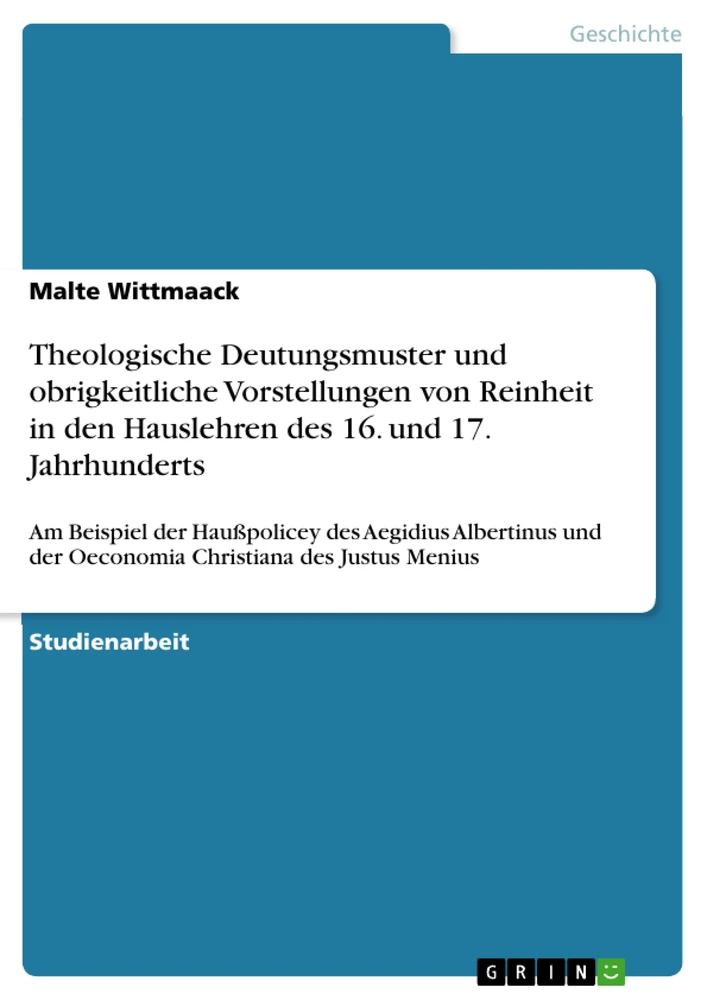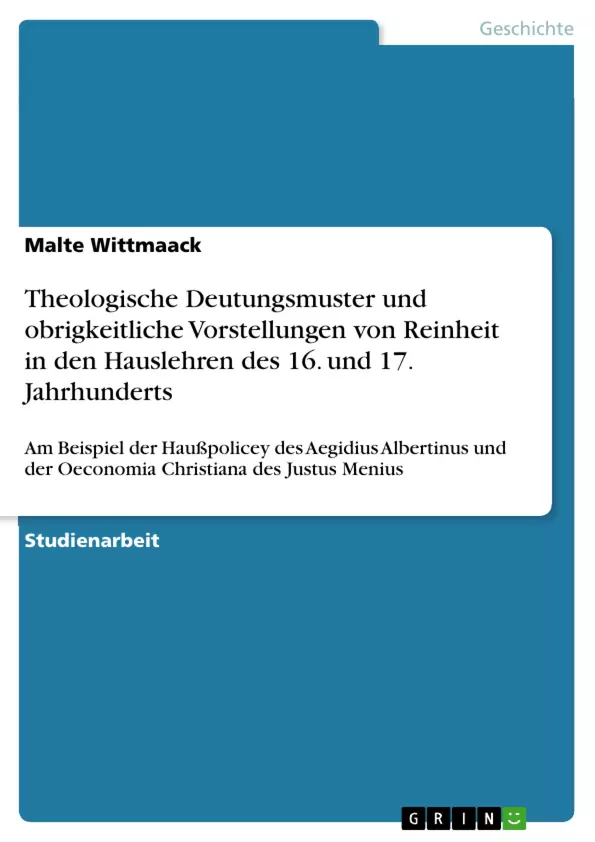Betrachtet man einen Auszug aus der Eheordnung der Fürstentums Neuburg aus dem Jahr 1577, so mag man sich doch etwas wundern. Die weltliche Obrigkeit sieht sich aufgrund ihrer Stellung und ihrer christlichen Aufgabe dazu veranlasst, eine Eheordnung aufzusetzen, um die Beziehung zwischen den Geschlechtern zu regeln. Was in diesem kurzen Ausschnitt aus der Quelle jedoch in den Vordergrund zu treten scheint, ist die Unterbindung der Unzucht.
Die Frage danach zu stellen, wie und vor allem wo die Unzucht zu unterbinden und die Reinheit zu finden sei, damit stand die Obrigkeit in Neuburg keineswegs allein. Die Eheordnung reihte sich in eine lange Reihe von Ordnungen und Erlässen in verschieden Territorien ein, die das Geschlechterverhältnis auf der normativen Ebene neu beschreiben und ordnen sollten. Die Historikerin Susanna Burghartz hat in ihrem Aufsatz „Umordnung statt Unordnung?“ darauf hingewiesen, dass „[die] Regelung der Geschlechterverhältnisse von der Gesellschaft als grundlegende Ordnungsaufgabe verstanden [wurde]“. Bei der Beschäftigung mit diesem Thema stößt man auch auf andere Abhandlungen und Schriften, die sich mit eben diesem Ordnungssystem beziehungsweise mit der Konstruktion einer Ordnung beschäftigen, in der das Geschlechterverhältnis geregelt wird.
Zu diesen Schriften gehören auch die sogenannten Hauslehren oder die Hausväterliteratur. Im Rückgriff auf die antike Traditionen der Ökonomie und Landwirtschaftsliteratur sollten die Ausführungen Auskunft darüber geben, „Warauff die haushaltung zu richten sey.“. Dies leisten sie auch, doch sie beschränken sich nicht auf die Problemstellungen des christlichen Haushaltes, sondern sind gleichzeitig Spiegel der konfessionellen Vorstellungen in Hinsicht auf die Weltauffassung und die Idealvorstellungen der Geschlechterordnung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hausväterliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts
- Kirchenzucht und Reinheitsdiskurs in der Reformationszeit
- Die Konstruktion von Ehe und Jungfrauenschaft in den Hauslehren des 15. und 16. Jahrhunderts am Beispiel von Aegidius Albertinus und Justus Menius.
- Die Jungfrauenschaft in der Haußpolicey des Aegidius Albertinus
- Aegidius Albertinus (1560-1620)
- Die Haußpolicey
- Dedicatio
- Die Jungfrauenschaft bei Albertinus
- Die Ehe in der Oeconomia Christiana des Justus Menius
- Justus Menius (1499-1558)
- Die Oeconomia Christiana
- Dedicatio
- Die Ehe bei Justus Menius
- Die Jungfrauenschaft in der Haußpolicey des Aegidius Albertinus
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Konzepten von Sexualität und Geschlechterverhältnissen in zwei Hauslehren: der katholischen „Haußpolicey“ von Aegidius Albertinus und der protestantischen „Oeconomia Christiana“ von Justus Menius. Ziel ist es, die Konstruktion von Jungfrauenschaft bei Albertinus und der Ehe bei Menius zu analysieren und zu untersuchen, welche Rolle die Hausväterliteratur im Kontext der Sozialdisziplinierung gespielt hat.
- Die Konstruktion von Jungfrauenschaft und Ehe in den Hauslehren
- Die Rolle der Hausväterliteratur in der Sozialdisziplinierung
- Die Bedeutung von Reinheitsdiskursen in der Reformationszeit
- Die Legitimationsfiguren und Weltanschauungen der Autoren
- Die Auseinandersetzung zwischen katholischer und protestantischer Sicht auf Sexualität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den historischen Kontext, indem sie die Regulierung der Geschlechterverhältnisse in der frühen Neuzeit und die Bedeutung der Hausväterliteratur beleuchtet. Die Quellenbasis der Arbeit – „Haußpolicey“ von Aegidius Albertinus und „Oeconomia Christiana“ von Justus Menius – wird vorgestellt und die Forschungslücke zu den Konzepten von Jungfrauenschaft und Ehe in diesen Schriften aufgezeigt.
- Die Hausväterliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung und den Inhalten der Hausväterliteratur. Es werden die wichtigsten Aspekte der Hausväterliteratur beleuchtet, wie zum Beispiel die Orientierung an der antiken Tradition der Ökonomie und Landwirtschaftsliteratur, der Fokus auf die „richtige“ Gestaltung des Haushaltes und die Vermittlung von konfessionellen Vorstellungen.
- Kirchenzucht und Reinheitsdiskurs in der Reformationszeit: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung des Reinheitsdiskurses in der Reformationszeit. Es wird beleuchtet, wie sich die Konfessionen in der Frage der Sexualität und Reinheit auseinandersetzten und welche Rolle die Kirchenzucht in diesem Kontext spielte.
- Die Konstruktion von Ehe und Jungfrauenschaft in den Hauslehren des 15. und 16. Jahrhunderts am Beispiel von Aegidius Albertinus und Justus Menius: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der Konzepte von Jungfrauenschaft und Ehe in den beiden Hauslehren. Es wird die jeweilige Weltordnung, die die Autoren konstruieren, untersucht und die Rolle der Legitimationsfiguren und Weltanschauungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Hausväterliteratur, Reinheitsdiskurs, Geschlechterordnung, Jungfrauenschaft, Ehe, Sozialdisziplinierung, Aegidius Albertinus, Haußpolicey, Justus Menius und Oeconomia Christiana. Die Untersuchung beleuchtet die Bedeutung dieser Konzepte im Kontext der Reformationszeit und untersucht die Auswirkungen der Hausväterliteratur auf die Gestaltung von Sexualität und Geschlechterverhältnissen im 16. und 17. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Hausväterliteratur?
Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts, die Anweisungen zur Führung eines christlichen Haushalts, zur Ökonomie und zur moralischen Ordnung gaben.
Wie unterschieden sich katholische und protestantische Hauslehren?
Die Arbeit vergleicht Aegidius Albertinus (katholisch), der die Jungfrauenschaft betont, mit Justus Menius (protestantisch), der die Ehe als zentrale Ordnung sieht.
Was bedeutet „Reinheitsdiskurs“ in der Reformationszeit?
Es bezeichnet die gesellschaftliche Debatte und Normierung von Keuschheit und die Unterbindung von Unzucht zur Sicherung der sozialen Ordnung.
Welche Rolle spielte die Sozialdisziplinierung?
Hauslehren dienten der Obrigkeit als Instrument, um das Verhalten der Untertanen im Privatbereich zu regulieren und konfessionelle Werte zu festigen.
Wer war Aegidius Albertinus?
Ein bedeutender katholischer Autor (1560-1620), bekannt für sein Werk „Haußpolicey“, in dem er moralische und religiöse Lebensregeln aufstellte.
- Quote paper
- Malte Wittmaack (Author), 2016, Theologische Deutungsmuster und obrigkeitliche Vorstellungen von Reinheit in den Hauslehren des 16. und 17. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342833