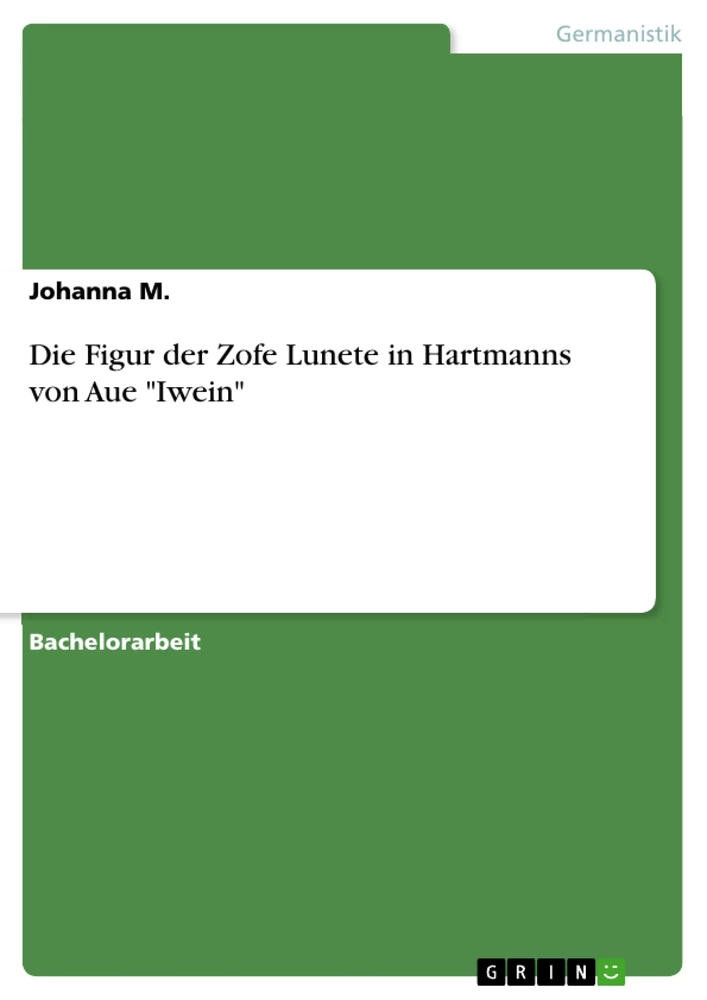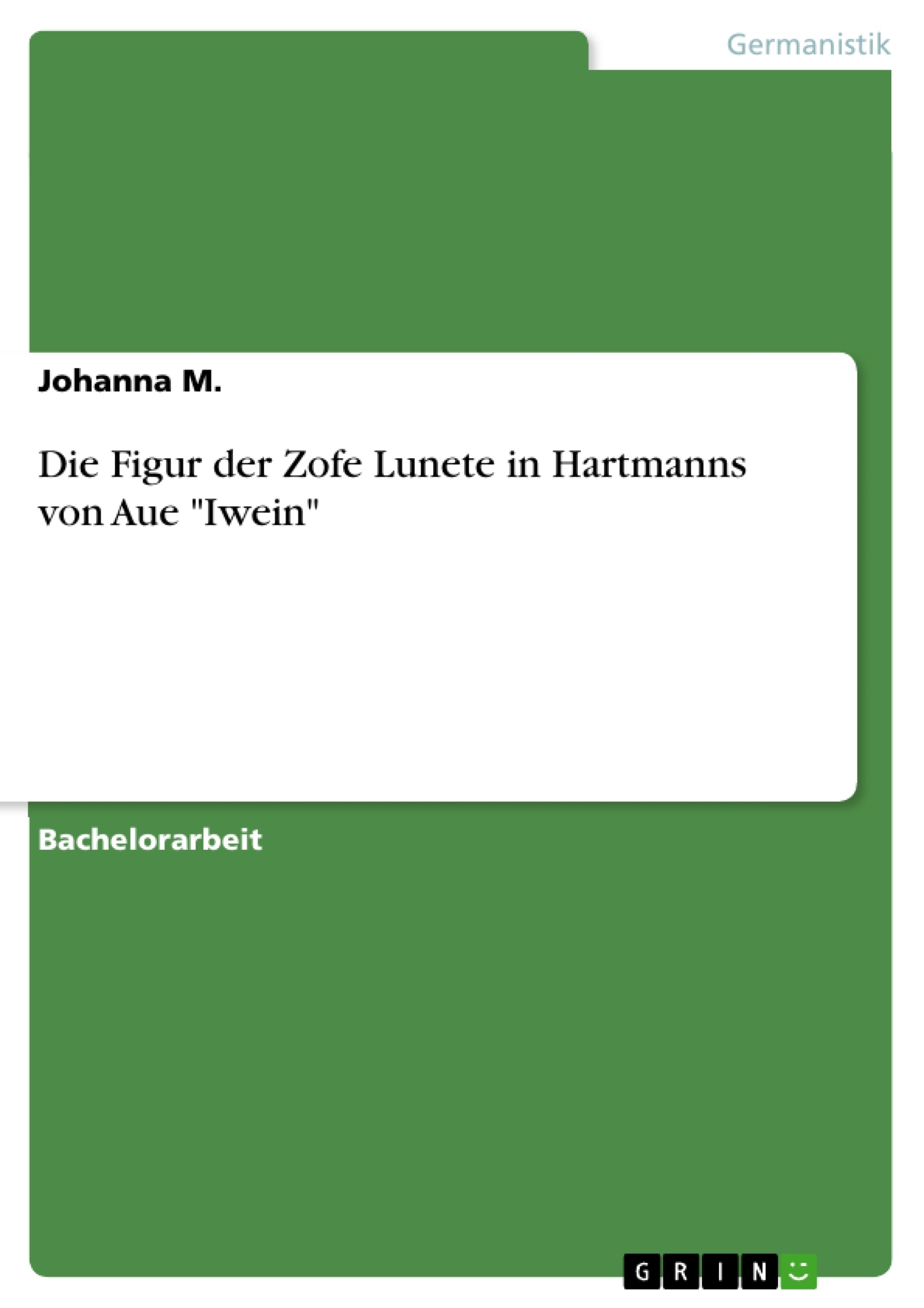Das höfische Epos „Iwein“ Hartmanns von Aue, um das Jahr 1200 verfasst, „prägt zusammen mit dem Erec das Bild des arthurischen Romans“ auf dem Zenit mittelhochdeutscher Literatur. Als Begründer des ‚Genres Artusroman‘ um 1165/70 gilt der französische Dichter Chrétien de Troyes, der mit seinen Romanen „Erec et Enide“ und „Yvain“ die Vorlagen für Hartmanns Werke schuf. Der Artusstoff gehört zur matière de Bretagne. In der fiktionalen Welt des Artusromans ist nicht, wie es die Gattungsbezeichnung vermuten lässt, König Artus Protagonist des Geschehens, sondern einer seiner Gefolgsmänner; auch „geht [es] [...] nicht um historisch relevante Angelegenheiten“. Im roman courtois „wird ein Ausschnitt aus dem Lebens- und Bewährungsweg eines ‚Ritters in der Welt‘ präsentiert.“ Doch beständige sælde und êre zu erlangen, gelingt dem Helden nicht selbständig und ohne äußere Impulse.
Im „Erec“ ist es Enite, die Minnedame des Ritters, die diesen antreibt und begleitet auf seinem âventiure-Weg zur hövescheit. Iweins Geliebte hingegen, Königin Laudine, zeichnet in Hartmanns zweitem Artusroman ein beinah konträres Bild zur Heldin im „Erec“: Nach seiner Verfehlung verstößt sie Iwein, der sich allein ohne ihren Rückhalt auf âventiure-Fahrt begeben muss, um sich zu beweisen. Doch eine andere weibliche Figur nimmt, anstelle der Protagonistin, im „Iwein“ den Platz der Beistand leistenden Frau im Leben des sich auf dem Prüfungsweg zu idealer Höfischkeit befindenden Artusritters ein: die Nebenfigur Lunete, Laudines Zofe. Sie steht im Fokus dieser Arbeit und wird sowohl hinsichtlich ihrer charakterlichen Darstellung als auch ihrer Funktionen für das Romangeschehen, einen erfolgreichen Abschluss des ersten Kursus Iweins herbeizuführen und somit die weitere Handlung erst zu ermöglichen, den weiteren Verlauf des Geschehens zudem, ob aktiv oder passiv, in prägender Weise zu beeinflussen und ein ‚gutes Ende‘ herbeizuführen, analysiert.
Bei der Figurenuntersuchung der Lunete Hartmanns wird auch die Romanvorlage Chrétiens herangezogen, um vor allem Abweichungen vom französischen Original herauszustellen und entsprechend zu interpretieren. Zudem werden Parallelen zwischen Lunete und Brangäne aus Gottfrieds von Straßburg 'Tristan' beleuchtet, denn die Figur der handlungstragenden Zofe ist kein einmaliges Phänomen in der höfischen Literatur, was eine Untersuchung Lunetes, betrachtet als konkonkrete Ausformung eines eigenen Figurentypus der mittelhochdeutschen Epik, umso bedeutsamer macht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil: Charakter und Funktionen der Zofenfigur Lunete
- Warum eine zweite Frauengestalt neben der weiblichen Hauptfigur?
- Ermöglichung des Romangeschehens: Lunete als Lebensretterin
- Beeinflussung des Handlungsverlaufs durch die Dienerin
- Die Dienerin als Ehestifterin
- Einschub: Gaweins Lob
- Lunete als Anklägerin
- Lunete als Angeklagte
- Die Zofe als Versöhnerin - ir dienst was wol lôns wert
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figur der Lunete in Hartmanns von Aue "Iwein". Ziel ist es, Lunetes Charakter und ihre Funktionen innerhalb des Romangeschehens zu analysieren. Dabei wird auch der Vergleich mit anderen weiblichen Figuren, insbesondere Enite aus "Erec", gezogen.
- Lunetes Rolle im Handlungsverlauf des "Iwein"
- Vergleich zwischen Lunete und Enite
- Lunetes Beziehung zu Iwein und Laudine
- Die Figur der Zofe als eigenständiger Typus in der mittelhochdeutschen Epik
- Abweichungen in Hartmanns Darstellung von Lunete im Vergleich zur französischen Vorlage
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Artusromans ein, insbesondere in Bezug auf Hartmann von Aues "Iwein" und dessen Vergleich mit "Erec". Sie hebt die zentrale Rolle der weiblichen Figuren hervor und stellt die Nebenfigur Lunete als Fokus der Arbeit vor. Die unterschiedlichen Ausprägungen der weiblichen Figuren in "Erec" und "Iwein" werden als Ausgangspunkt für die Analyse Lunetes und ihrer Funktion im Roman genannt.
Hauptteil: Charakter und Funktionen der Zofenfigur Lunete: Dieser Hauptteil untersucht umfassend die Figur Lunete. Er analysiert ihre Funktion als Lebensretterin, ihren Einfluss auf den Handlungsverlauf des Romans, und ihre Rolle als Ehestifterin, Anklägerin, Angeklagte und Versöhnerin. Der Abschnitt beleuchtet Lunetes Beziehungen zu Iwein und Laudine sowie ihren Vergleich zu Enite aus "Erec", um ihre Bedeutung für die Handlung und die Entwicklung der Hauptfigur zu verdeutlichen. Der Vergleich mit anderen Figuren des Typus der handlungstragenden Zofe in der höfischen Literatur, insbesondere Brangäne aus Gottfrieds von Straßburg "Tristan", wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Hartmann von Aue, Iwein, Lunete, Artusroman, höfische Literatur, Minnedame, Zofe, Dienerin, Handlungsfunktion, Frauengestalt, Vergleich, Enite, Brangäne, Minne, Hövescheit.
Häufig gestellte Fragen zu Hartmann von Aues "Iwein" - Fokus Lunete
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figur der Lunete in Hartmanns von Aues Artusroman "Iwein". Im Fokus steht die Untersuchung von Lunetes Charakter und ihren verschiedenen Funktionen innerhalb des Romans. Die Analyse beinhaltet einen Vergleich mit anderen weiblichen Figuren, insbesondere Enite aus "Erec".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Lunetes Rolle im Handlungsverlauf, ihren Vergleich mit Enite, ihre Beziehung zu Iwein und Laudine, und ihre Bedeutung als eigenständiger Figurentypus in der mittelhochdeutschen Epik. Des Weiteren werden Abweichungen zu Lunetes Darstellung in der französischen Vorlage untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Der Hauptteil analysiert Lunetes Funktionen als Lebensretterin, Ehestifterin, Anklägerin, Angeklagte und Versöhnerin. Es werden Vergleiche zu anderen Figuren des Typus der handlungstragenden Zofe, wie Brangäne aus Gottfrieds von Straßburg "Tristan", gezogen.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden geboten?
Die Einleitung führt in die Thematik des Artusromans und die Rolle weiblicher Figuren ein. Der Hauptteil analysiert umfassend Lunete, ihre Funktionen und Beziehungen. Es wird auf den Vergleich mit Enite und anderen Figuren eingegangen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Hartmann von Aue, Iwein, Lunete, Artusroman, höfische Literatur, Minnedame, Zofe, Dienerin, Handlungsfunktion, Frauengestalt, Vergleich, Enite, Brangäne, Minne, Hövescheit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Lunetes Charakter und ihre Funktionen im Roman "Iwein" zu analysieren und ihren Stellenwert innerhalb der mittelhochdeutschen Epik zu bestimmen. Der Vergleich mit anderen weiblichen Figuren dient der Kontextualisierung und Vertiefung der Analyse.
Warum wird Lunete als zentrale Figur betrachtet?
Lunete, obwohl Nebenfigur, nimmt eine entscheidende Rolle im Handlungsverlauf von "Iwein" ein. Ihre Handlungen beeinflussen das Geschehen maßgeblich und tragen zur Entwicklung der Hauptfigur bei. Ihre Rolle ist vielschichtig und komplex und somit besonders analytisch interessant.
Welche Bedeutung hat der Vergleich mit Enite?
Der Vergleich mit Enite aus "Erec" ermöglicht es, Lunetes Charakter und Funktion im Kontext anderer weiblicher Figuren in Hartmanns Werk zu betrachten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Dies trägt zum Verständnis der Entwicklung der weiblichen Figuren in Hartmanns Werk bei.
Wie wird die Funktion von Lunete im Roman beschrieben?
Lunete wird als Lebensretterin, Ehestifterin, Anklägerin, Angeklagte und Versöhnerin beschrieben. Ihre Funktionen sind vielschichtig und beeinflussen den Handlungsverlauf auf entscheidende Weise. Sie ist keine passive Figur, sondern eine aktive Gestalterin des Geschehens.
- Quote paper
- Johanna M. (Author), 2016, Die Figur der Zofe Lunete in Hartmanns von Aue "Iwein", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342876