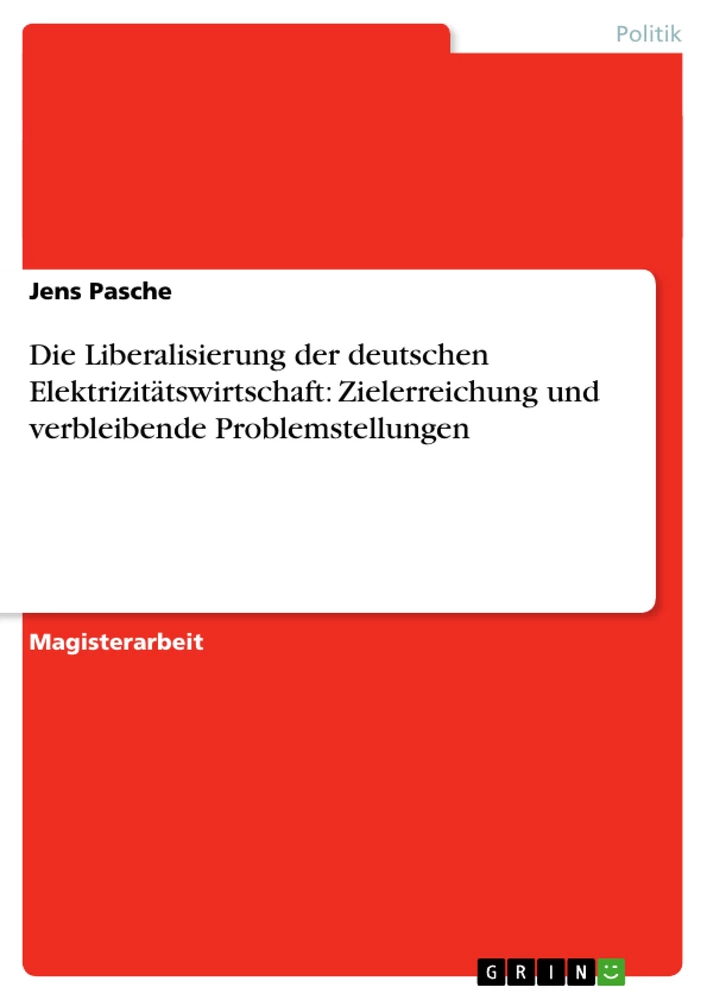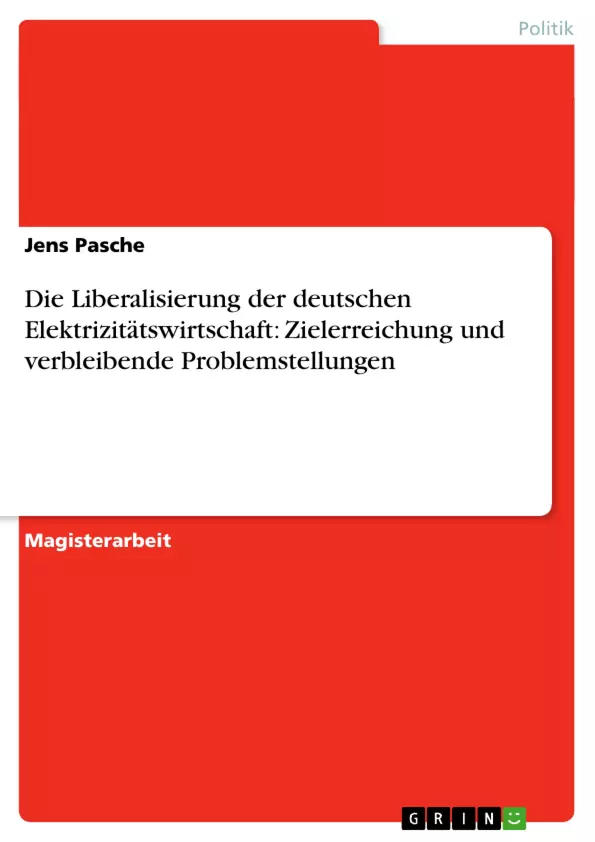Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom April 1998 vollzieht sich die Veränderung des deutschen Strommarktes mit hoher Geschwindigkeit. Die Überführung in den Wettbewerb war ein Schnitt in der bis dato über hundertjährigen Geschichte der deutschen Elektrizitätswirtschaft, die bislang monopolistisch strukturiert war. Zwar wurde seit den siebziger Jahren über eine grundlegende institutionelle Reform diskutiert, 1 da der wirtschaftliche Protektionismus mit Wohlfahrtsverlusten verbunden war. Doch erwies sich der Ordnungsrahmen bis zur Liberalisierung des Strommarktes als weitgehend reformresistent. 2
„Die Liberalisierung der deutschen Elektrizitätswirtschaft ist gescheitert“. 3 Dieser ernüchternde Befund ist vielfach zu lesen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dies zu überprüfen, indem die Erwartungen und Zielvorstellungen an einen liberalisierten Strommarkt erfasst und bezüglich ihrer Zielerreichung untersucht werden. Mithin soll eine Bestandsaufnahme aus übergreifender Perspektive unternommen werden. Zunächst scheint es angezeigt, einen Rückblick auf die deutsche Elektrizitätswirtschaft vor der Liberalisierung zu werfen, um die Veränderungen und deren Ausmaß verstehen zu können. Folgend sollen der europäische und nationale Politikverlauf und dessen Ergebnisse - die EU- Richtlinie „betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt“ und die Novellierung des Energiewirtschaftsrechts - dargestellt werden, wobei die Erwartungen, aber auch die Bedenken der wirtschaftlichen und politischen Akteure an die Liberalisierung erfasst werden. Anschließend werden die tatsächlichen Auswirkungen, die sich herausbildende Praxis bis Ende 2002, in Relation zu den Zielvorstellungen an die Liberalisierung einer kritischen Betrachtung unterzogen. Der Versuch, ein Fazit der bisherigen Liberalisierung zu ziehen, wird die Arbeit abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Die deutsche Elektrizitätswirtschaft vor der Liberalisierung
- 2.1 Technisch-ökonomische Besonderheiten als Rechtfertigung für die wettbe-werbliche Sonderstellung der Elektrizitätswirtschaft
- 2.2 Der rechtliche Ordnungsrahmen
- 2.2.1 Energiewirtschaftsgesetz
- 2.2.2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- 2.2.3 Demarkations- und Konzessionsverträge
- 2.2.4 Kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht
- 2.3 Verbände der deutschen Elektrizitätswirtschaft
- 2.4 Marktstrukturen der deutschen Elektrizitätswirtschaft
- 2.4.1 Marktstufen
- 2.4.2 Eigentumsverhältnisse in der Elektrizitätswirtschaft
- 2.4.3 Konzentration in der Elektrizitätswirtschaft
- 2.5 Der Reformenbedarf der deutschen Elektrizitätswirtschaft
- 2.6 Fazit
- 3. Elektrizitätswirtschaftliche Reformdiskussion der Europäischen Gemeinschaft und in Deutschland, die EU-Richtlinie und die nationale Gesetzgebung
- 3.1 Die Binnenmarktpolitik der EG
- 3.1.1 Das Arbeitsdokument „Der Binnenmarkt für Energie“
- 3.1.2 Die Richtlinienvorschläge der Kommission
- 3.1.3 Die Verhandlungen im Ministerrat
- 3.1.4 Die Binnenmarktrichtlinie für Elektrizität 1996
- 3.2 Die Reform des Energiewirtschaftsrechts
- 3.2.1 Von der kleinen zur großen Reform
- 3.2.2 Die Wiederaufnahme des Gesetzesprojekts
- 3.2.3 Das Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
- 3.2.4 Fazit
- 4. Wettbewerb in der deutschen Elektrizitätswirtschaft
- 4.1 Verbändevereinbarungen und Netznutzungsentgelte
- 4.1.1 Erste Verbändevereinbarung
- 4.1.2 Zweite Verbändevereinbarung
- 4.1.3 Verbändevereinbarung II plus
- 4.1.4 Fazit
- 4.2 Konzentration
- 4.2.1 Verbundebene
- 4.2.2 Regionale und kommunale Ebene
- 4.2.3 Fazit
- 4.3 Neue Anbieter
- 4.4 Die Entwicklung der Strompreise
- 4.4.1 Nationale Rahmenbedingungen
- 4.4.2 Strompreise für Industriekunden
- 4.4.3 Strompreise für Haushaltskunden
- 4.4.4 Fazit
- 4.5 Stromhandel
- 4.5.1 Bilateraler Handel
- 4.5.2 Börsenhandel
- 4.5.3 Fazit
- 4.6 Kommunale Versorgungsunternehmen
- 4.6.1 Kraft-Wärme-Kopplung
- 5. Zusammenfassende Bewertung und Ausblick: erfüllte und enttäuschte Erwartungen an die Liberalisierung der Elektrizitätswirtschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Liberalisierung der deutschen Elektrizitätswirtschaft von 1998 bis Ende 2002 und untersucht dabei die Zielerreichung und die verbleibenden Problemstellungen.
- Entwicklung des deutschen Strommarktes nach der Liberalisierung
- Analyse der Auswirkungen der EU-Richtlinien auf die deutsche Elektrizitätswirtschaft
- Bewertung des Wettbewerbs in der deutschen Elektrizitätswirtschaft
- Untersuchung der Entwicklung von Strompreisen und Stromhandel
- Beurteilung der Rolle kommunaler Versorgungsunternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der deutschen Elektrizitätswirtschaft vor der Liberalisierung und analysiert die technischen und ökonomischen Besonderheiten, die den rechtlichen Ordnungsrahmen und die Marktstrukturen. Kapitel 3 beleuchtet die EU-Reformdiskussion und die Entwicklung der EU-Richtlinie sowie die nationale Gesetzgebung. Das vierte Kapitel fokussiert auf den Wettbewerb in der deutschen Elektrizitätswirtschaft, untersucht Verbändevereinbarungen, Konzentrationsprozesse, neue Anbieter, die Strompreisentwicklung sowie den Stromhandel.
Schlüsselwörter
Liberalisierung, Elektrizitätswirtschaft, Energiewirtschaftsrecht, EU-Richtlinie, Wettbewerb, Konzentration, Strompreise, Stromhandel, Kommunale Versorgungsunternehmen.
Häufig gestellte Fragen
War die Liberalisierung der deutschen Elektrizitätswirtschaft erfolgreich?
Die Arbeit zieht eine kritische Bilanz bis Ende 2002 und untersucht, ob die Erwartungen an Wettbewerb und sinkende Preise erfüllt oder enttäuscht wurden.
Wie sah der Strommarkt vor der Liberalisierung 1998 aus?
Der Markt war über hundert Jahre lang monopolistisch strukturiert, geprägt durch Demarkationsverträge und eine wettbewerbliche Sonderstellung der Energieversorger.
Welchen Einfluss hatte die EU auf die deutsche Stromreform?
Die EU-Binnenmarktrichtlinie für Elektrizität von 1996 zwang die Mitgliedsstaaten zur Marktöffnung und zur Novellierung des nationalen Energiewirtschaftsrechts.
Wie haben sich die Strompreise für Haushalte und Industrie entwickelt?
Die Analyse betrachtet die Preisentwicklung nach 1998 und stellt fest, dass die erhofften Entlastungen oft durch Steuern und Netznutzungsentgelte relativiert wurden.
Was sind die verbleibenden Problemstellungen im liberalisierten Markt?
Zentrale Probleme bleiben die hohe Marktkonzentration auf der Verbundebene, der Zugang neuer Anbieter zu den Netzen und die Rolle kommunaler Versorgungsunternehmen.
- Arbeit zitieren
- Jens Pasche (Autor:in), 2004, Die Liberalisierung der deutschen Elektrizitätswirtschaft: Zielerreichung und verbleibende Problemstellungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34289