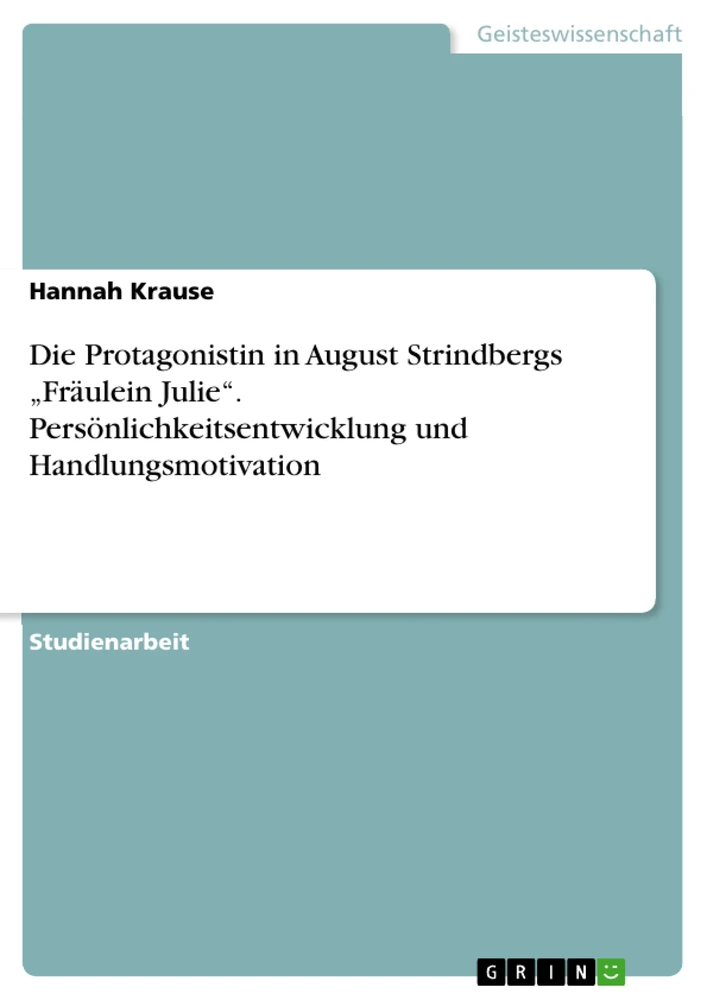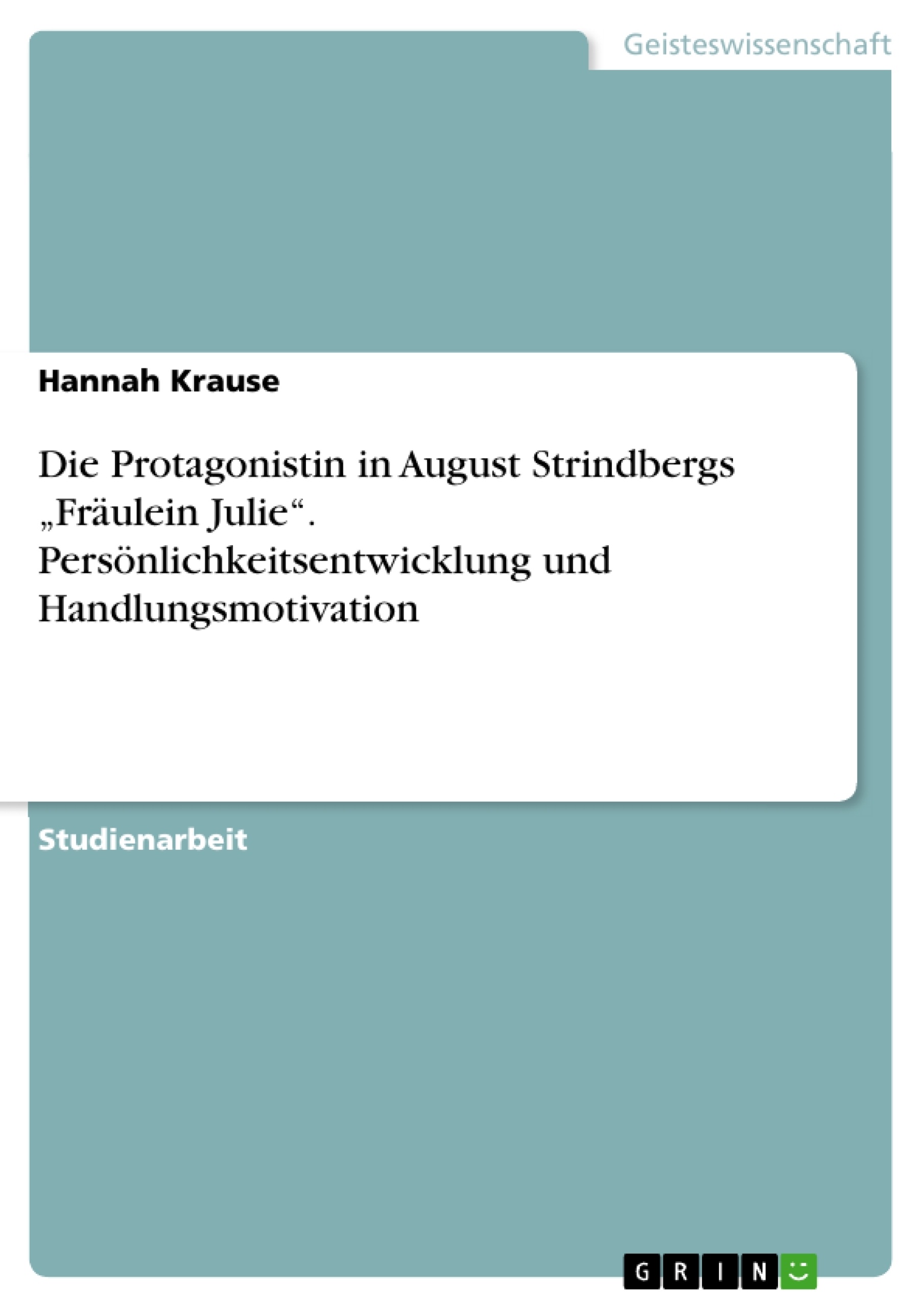Strindbergs 1888 verfasstes Drama „Fräulein Julie – Ein naturalistisches Trauerspiel“ erregte aufgrund seiner Thematik zunächst großes Aufsehen und Kritik. So wurde eine Aufführung in seinem Heimatland von der dänischen Zensur verhindert, welche das Stück als unsittlich bewertete. Es kam erst sechzehn Jahre später zu einer Premiere in Schweden.
In der Tat war das Stück seiner Zeit voraus, denn die Gesellschaft war noch nicht bereit dazu, sich mit der Thematik des Stückes in derartiger Art und Weise auseinander zu setzen. Betrachtet man den Inhalt des Stückes, scheint die anfängliche Ablehnung geradezu bezeichnend für Strindbergs gesellschaftskritisches Drama. Handelt es doch von einer Grafentochter, welche an den gerade erst aufkeimenden neuen Ideologien ihrer Zeit zugrunde geht. Sie zerbricht an Theorien, die noch in einem Widerspruch zur damaligen gesellschaftlichen Situation standen und somit als unausgereift bzw. als verfrüht zum Einsatz gekommen bezeichnet werden könnten. Fräulein Julie, die Tochter eines Grafen, verbringt die Mittsommernacht in der Küche des gräflichen Anwesens mit den Bediensteten. Im Laufe der Nacht entwickelt sich zwischen Julie und Jean, dem Diener des Grafen, eine Beziehung, die schließlich im Geschlechtsakt gipfelt. Die Fragen nach „höher oder niedriger, nach besser oder schlechter, nach Mann oder Frau“ bestimmen den anschließenden Machtkampf der Geschlechter, welcher für Julie tragisch endet.
Strindberg bearbeitet in diesem Drama die in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts aufgekommenen Theorien über die Stellung der Frau innerhalb der Gesellschaft, sowie die Ständeproblematik, welche vor allem auf der Grundlage von Darwins Entwicklungstheorien erörtert wurden. In dieser Arbeit möchte ich untersuchen, welche Gründe zu Julies Fall geführt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strindberg und die Frauenfrage
- Merkmale des Naturalismus in „Fräulein Julie“
- Welche Gründe führen zu Julies Fall?
- Der Einfluss der Mutter
- Der Einfluss des Vaters
- Gleichheit der Menschen
- Schlussfolgerung
- Wie wirken sich die Grundlagen von Julies Psyche auf den Verlauf der Handlung aus?
- Teil 1: „Vor dem Fall“
- Teil 2: „Nach dem Fall“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für den Untergang der Protagonistin Julie in August Strindbergs „Fräulein Julie“. Der Fokus liegt auf der Analyse der psychischen Motivationen und der Einflüsse, die zu Julies Entwicklung und ihrem Handeln beigetragen haben. Dabei werden die im Stück behandelten neuen Ideologien der Frauenfrage und der Gleichheit der Menschen im Kontext des ausgehenden 19. Jahrhunderts berücksichtigt.
- Die Rolle der Frauenfrage in Strindbergs Werk
- Die Darstellung des Naturalismus in „Fräulein Julie“
- Die psychischen Motivationen Julies und deren Einfluss auf die Handlung
- Der Einfluss von Julies Eltern auf ihre Persönlichkeitsentwicklung
- Die gesellschaftlichen und ideologischen Hintergründe des Dramas
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert Strindbergs Kommentar aus dem Vorwort zu „Fräulein Julie“, der die zentrale Problematik des Stücks – den sozialen Aufstieg und Fall, die Frage nach Mann und Frau – zusammenfasst. Sie beschreibt die anfängliche Ablehnung des Stücks aufgrund seiner Thematik und hebt die gesellschaftliche Brisanz des Dramas hervor, das vom Untergang einer Grafentochter handelt, welche an neuen, noch nicht gesellschaftlich akzeptierten Ideologien scheitert. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der Gründe für Julies Fall unter Berücksichtigung der damaligen Ideologien zur Frauenfrage und der Gleichheit der Menschen.
Strindberg und die Frauenfrage: Dieses Kapitel beleuchtet Strindbergs ambivalente Haltung zur Frauenfrage. Während er in früheren Werken die Rechte der Frau vertrat, sieht er sie in „Fräulein Julie“ als dem Mann unterlegen, basierend auf darwinistischen Theorien. Die Arbeit argumentiert jedoch, dass Strindbergs eigene Ansichten nicht im Vordergrund stehen, sondern die gesellschaftlichen und ideologischen Entwicklungen des späten 19. Jahrhunderts. Sie betont die Aktualität des Stücks und dessen vorausschauende Natur, die auch Strindberg selbst nicht vollständig erfasst haben könnte.
Merkmale des Naturalismus in „Fräulein Julie“: Dieses Kapitel beschreibt die naturalistischen Elemente in Strindbergs Drama. Die begrenzte Anzahl der Charaktere, der einzige Handlungsort (die Küche), und die psychologisch detaillierte Charakterzeichnung, die durch diverse Hintergründe motiviert ist, werden analysiert. Strindbergs Fokus auf natürliche Dialoge und die Darstellung moderner Charaktere, die von gesellschaftlichen und ideologischen Umbrüchen beeinflusst sind, werden herausgestellt. Die Bedeutung der psychologischen Nachvollziehbarkeit der Situation und die Rolle der Dialogstruktur werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
August Strindberg, Fräulein Julie, Naturalismus, Frauenfrage, Gleichheit der Menschen, Gesellschaftskritik, Persönlichkeitsentwicklung, Handlungsmotivation, Darwinismus, Sozialer Aufstieg und Fall, Machtkampf der Geschlechter.
Häufig gestellte Fragen zu August Strindbergs "Fräulein Julie"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert August Strindbergs Drama "Fräulein Julie" mit Fokus auf die Gründe für den Untergang der Protagonistin. Es werden die psychischen Motivationen Julies, die Einflüsse ihrer Eltern und der gesellschaftliche Kontext des späten 19. Jahrhunderts, insbesondere die Frauenfrage und die Ideologie der Gleichheit der Menschen, untersucht. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Strindbergs Sicht auf die Frauenfrage, dem Naturalismus im Stück, den Einflüssen auf Julies Psyche und eine Schlussfolgerung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle der Frauenfrage in Strindbergs Werk, der Darstellung des Naturalismus in "Fräulein Julie", den psychischen Motivationen Julies und deren Einfluss auf die Handlung, dem Einfluss von Julies Eltern auf ihre Persönlichkeitsentwicklung und den gesellschaftlichen und ideologischen Hintergründen des Dramas. Die ambivalente Haltung Strindbergs zur Frauenfrage und die Aktualität des Stücks im Kontext der damaligen gesellschaftlichen und ideologischen Umbrüche werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik und Strindbergs Kommentar), Strindberg und die Frauenfrage (Analyse von Strindbergs ambivalenter Haltung und dem gesellschaftlichen Kontext), Merkmale des Naturalismus in „Fräulein Julie“ (Analyse der naturalistischen Elemente des Dramas), Kapitel über die Gründe für Julies Fall (Analyse der Einflüsse von Mutter, Vater und der Ideologie der Gleichheit) und ein Kapitel zu Julies Psyche und dem Einfluss auf den Handlungsverlauf, gefolgt von einem Fazit.
Wie wird der Naturalismus in "Fräulein Julie" dargestellt?
Die Arbeit analysiert die naturalistischen Elemente des Dramas, wie die begrenzte Anzahl der Charaktere, den einzigen Handlungsort (die Küche), die detaillierte psychologische Charakterzeichnung und die naturalistischen Dialoge. Der Fokus liegt auf der Darstellung moderner Charaktere, die von gesellschaftlichen und ideologischen Umbrüchen beeinflusst sind, und der psychologischen Nachvollziehbarkeit der Situation.
Welche Rolle spielt die Frauenfrage in der Analyse?
Die Frauenfrage ist ein zentraler Aspekt der Analyse. Die Arbeit untersucht Strindbergs ambivalente Haltung zur Frauenfrage und wie diese im Kontext des Dramas und der gesellschaftlichen Verhältnisse des späten 19. Jahrhunderts zu verstehen ist. Die Arbeit betont die gesellschaftlichen und ideologischen Entwicklungen als Einflussfaktoren auf Julies Schicksal, anstatt Strindbergs persönliche Ansichten in den Vordergrund zu stellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
August Strindberg, Fräulein Julie, Naturalismus, Frauenfrage, Gleichheit der Menschen, Gesellschaftskritik, Persönlichkeitsentwicklung, Handlungsmotivation, Darwinismus, Sozialer Aufstieg und Fall, Machtkampf der Geschlechter.
- Quote paper
- Hannah Krause (Author), 2009, Die Protagonistin in August Strindbergs „Fräulein Julie“. Persönlichkeitsentwicklung und Handlungsmotivation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342961