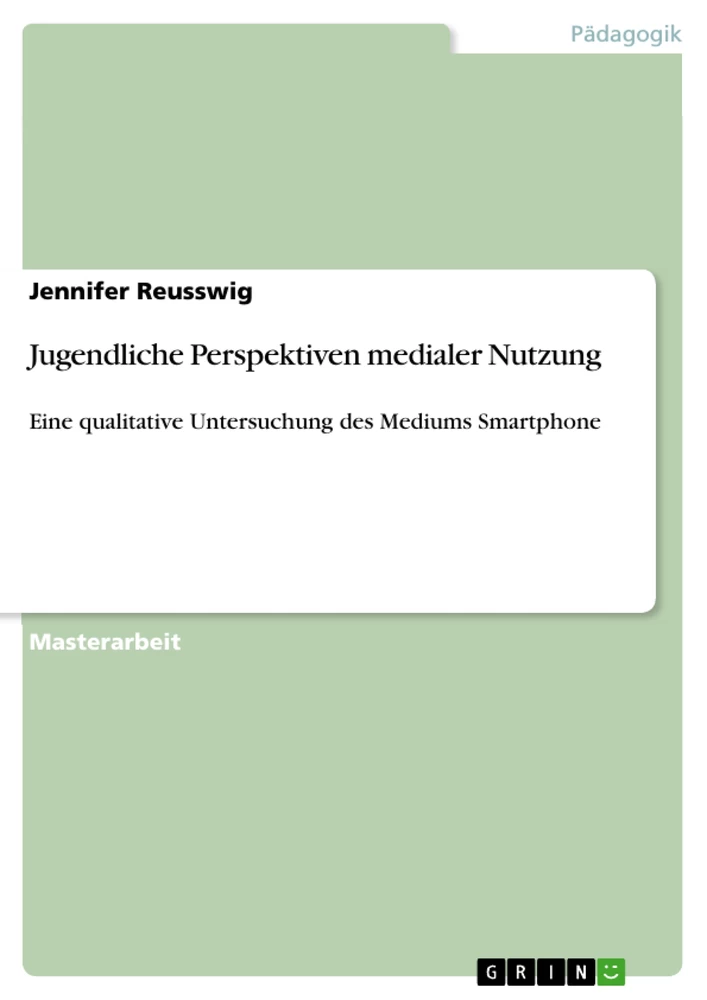Wie der medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (MPFS) im Vergleich der veröffentlichten JIM-Studien zwischen 1998 und 2013 feststellt, „ist das Handy seit etwa zehn Jahren ein fester Bestandteil der Jugendkultur“. Jedoch zeige sich seit der Verbreitung von Smartphones eine maßgebliche Veränderung. Die Ausstattung dieser Geräte bewirke eine stärkere Vernetzung über die mobile Nutzung von sozialen Netzwerken und Messengern und bestimme das moderne Kommunikationsverhalten von Jugendlichen. Durch die technischen Entwicklungen der Handyindustrie und die sinkenden Preise der Anbieter scheint die Mediennutzung nun orts- und zeitunabhängig möglich. Der MPFS nennt das Smartphone zudem ein „praktisches Werkzeug“, der das alltägliche Leben mit all seinen Funktionen bereichere und vielfältige Möglichkeiten zum Zeitvertreib biete. Somit organisiere das Smartphone den Alltag von Jugendlichen und sei aus deren Leben nicht mehr wegzudenken (vgl. MPFS 2013, 28-31).
Dieser Vergleich der medialen Entwicklungen der letzten Jahre verdeutlicht die gewonnene Präsenz und die Besonderheiten des Mediums Smartphone im Alltag von Jugendlichen. Die Nutzung unterschiedlichster medialer Angebote scheint sich durch die rasante Verbreitung dieser Geräte grundlegend geändert zu haben. Smartphones treten auf als allgegenwärtige Begleiter von Jugendlichen (und Erwachsenen) und deren vermeintlich ununterbrochener Online-Status trägt zu Besorgnis von Eltern und Pädagogen bei. Entwickelte App-Angebote, wie beispielsweise Menthal (vgl. Söldner 2014), die die Nutzungsdauer des Smartphonebesitzers messen und rückmelden und der öffentliche Diskurs um "Digitale Demenz", der beispielhaft von Manfred Spitzer angeführt wird, verdeutlichen eine allgemein vorherrschende kritische Haltung der kontemporären Gesellschaft zu einer als übermäßig empfundenen Nutzungsfrequenz dieser Geräte (Spitzer 2012, zit. n. Krotz & Schulz 2014, 32).
Die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel „Jugendliche Perspektiven medialer Nutzung“ will sich daher näher mit diesem Thema beschäftigen und empirisch untersuchen, was Jugendliche tatsächlich, und aus subjektiver Perspektive dieser Kohorte betrachtet, mit ihren Smartphones machen und inwiefern diese Nutzung ihre Sozialisation unter Berücksichtigung anderer Sozialisationsinstanzen mitbestimmt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Persönliche Vorannahmen und Intention der Autorin
- 1.3 Überblick
- 2 Terminologien
- 2.1 Jugend - interdisziplinäre Definitionsansätze und historische Entwicklungen
- 2.2 Generation Social Media?
- 2.3 Mediennutzung im Jugendalter
- 3 Zentrale theoretische Konzepte
- 3.1 Sozialisationstheorie - theoretischer Abriss zur produktiven Verarbeitung der Realität
- 3.2 Sozialisationsräume Jugendlicher
- 3.3 Konzept der Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
- 3.4 Theoretische Strömungen zum Paradigmenwechsel der Forschungsansätze
- 3.5 Konzept der Mediensozialisation
- 3.6 Jugend und Medien aus sozialisationstheoretischer Perspektive
- 3.7 Medienpädagogischer Bezug
- 4 Forschungsstand
- 4.1 Mobilkommunikation und Internet - Entwicklungen
- 4.2 Empirischer Forschungsstand zu Smartphone-Nutzung
- 5 Zusammenfassung Theorie und Forschungsstand
- 6 Methodik
- 6.1 Untersuchungsdesign
- 6.2 Erhebungsmethodik - problemzentrierte Interviews
- 6.2.1 Instrumentarium
- 6.2.2 Kommunikationsstrategien
- 6.2.3 Anmerkungen zur Durchführung
- 6.3 Auswertungsmethodik - Umsetzung nach Witzel und Eingrenzung
- 7 Fallanalysen
- 7.1 Mustafa
- 7.1.1 Falldarstellung
- 7.1.2 Dossier
- 7.1.3 Auswertung
- 7.1.4 vorläufige Deutungshypothesen
- 7.2 Ali
- 7.2.1 Falldarstellung
- 7.2.2 Dossier
- 7.2.3 Auswertung
- 7.2.4 vorläufige Deutungshypothesen
- 7.3 Lena
- 7.3.1 Falldarstellung
- 7.3.2 Dossier
- 7.3.3 Auswertung
- 7.3.4 vorläufige Deutungshypothesen
- 8 Kontrastierender Fallvergleich
- 8.1 Variationsbreite fallübergreifender zentraler Themen
- 8.2 Diskrepanzen fallspezifischer Themen
- 9 Ergebnisse
- 9.1 Diskussion empirischer Ergebnisse und theoretischer Vorannahmen
- 9.2 Medienpädagogische Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit „Jugendliche Perspektiven medialer Nutzung“ untersucht die Nutzung von Smartphones durch Jugendliche und deren Einfluss auf deren Sozialisation. Die Arbeit will herausfinden, wie Jugendliche Smartphones im Alltag einsetzen, welche Bedeutung diese Geräte für sie haben und wie die Nutzung im Kontext anderer Sozialisationsinstanzen zu betrachten ist.
- Smartphone-Nutzung im Alltag Jugendlicher
- Subjektive Wahrnehmung der Mediennutzung
- Bedeutung des Smartphones im Kontext anderer Sozialisationsinstanzen
- Reflexions- und Informationsbedarf aus Sicht Jugendlicher und aus pädagogischer Perspektive
- Medienpädagogische Perspektiven zur Förderung sicherer und verantwortungsvoller Smartphone-Nutzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Thematik und die Forschungsfrage formuliert. Im Anschluss werden wichtige Begriffe wie „Jugend“, „Generation Social Media“ und „Mediennutzung im Jugendalter“ definiert und erläutert. Anschließend werden zentrale theoretische Konzepte vorgestellt, die für die Analyse der Smartphone-Nutzung relevant sind, darunter Sozialisationstheorie, Sozialisationsräume, Entwicklungsaufgaben im Jugendalter und Mediensozialisation. Das Kapitel „Forschungsstand“ beleuchtet die Entwicklungen in der Mobilkommunikation und im Internet sowie den empirischen Forschungsstand zur Smartphone-Nutzung. Die Methodik des Projekts wird im sechsten Kapitel vorgestellt, das sich mit dem Untersuchungsdesign, der Erhebungsmethodik und der Auswertungsmethodik befasst. Die darauf folgenden Kapitel präsentieren Fallanalysen von drei Jugendlichen, die detailliert ihre Smartphone-Nutzung, ihre subjektive Wahrnehmung und ihre Erfahrungen mit dem Gerät beleuchten. Der kontrastierende Fallvergleich analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Fälle und leitet zu den Ergebnissen der Studie über. Die Ergebnisse werden im letzten Kapitel diskutiert, wobei die empirischen Ergebnisse mit den theoretischen Vorannahmen verknüpft werden. Abschließend werden medienpädagogische Perspektiven zur Förderung einer sicheren und verantwortungsvollen Smartphone-Nutzung aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Mediennutzung, Smartphone, Jugend, Sozialisation, Mediensozialisation, Entwicklungsaufgaben, Medienkompetenz, Empirische Forschung, Qualitative Forschung, Fallanalyse, Medienpädagogik.
- Citation du texte
- Jennifer Reusswig (Auteur), 2015, Jugendliche Perspektiven medialer Nutzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342969