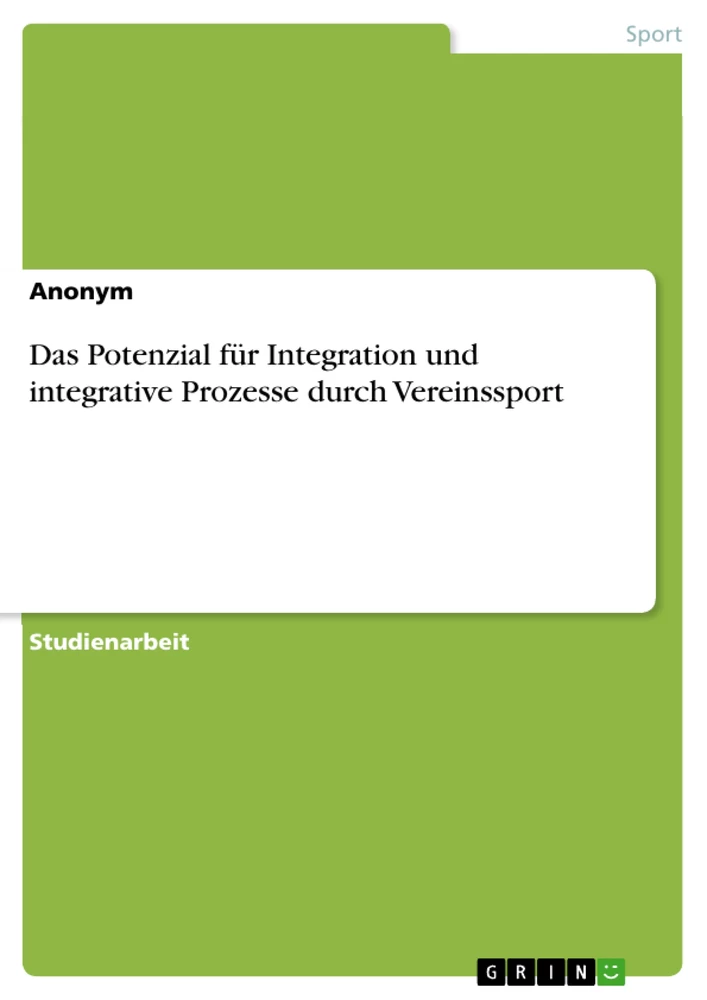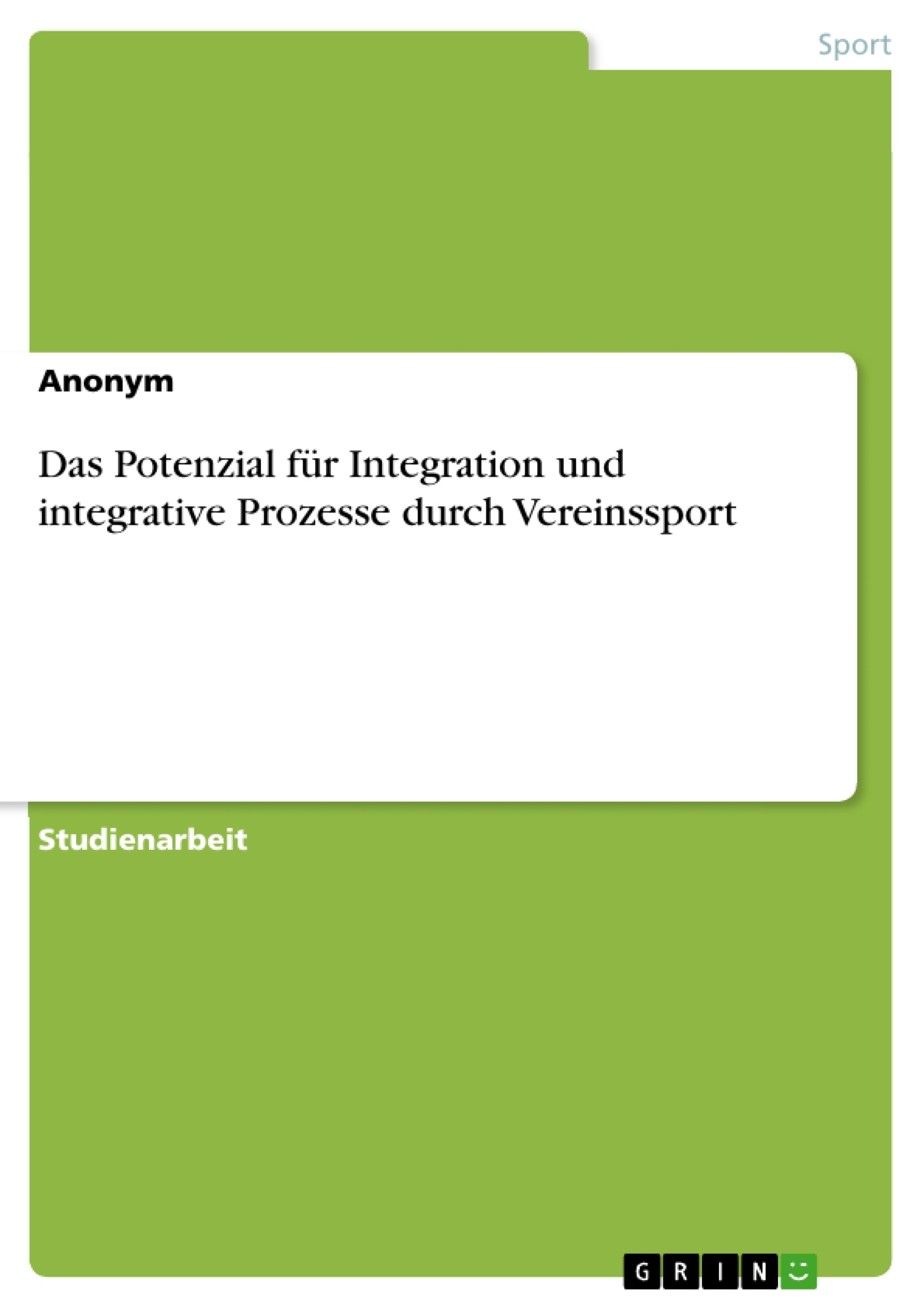Der sogenannte olympische Gedanke und die implizierte Vorstellung von Sport stellen das gesellschaftliche Potenzial dar, welches mit sportlichem Miteinander in Zusammenhang steht. Sport gilt auch über den Rahmen der olympischen Bewegung hinaus als ein Verbindungsstück, das als ein Raum, in dem Begegnungen möglich sind, verstanden werden kann. In diesem Raum werden jegliche Hintergründe (sprachliche, kulturelle, religiöse, soziale) verdrängt, wodurch leichter Kontakt aufgebaut werden kann. Ausgehend davon wird Sport mit einer besonderen integrativen Wirkung verbunden, die ein Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Bildungsstandeses ermöglicht und fördert.
Insbesondere der Vereinssport kann als Plattform verstanden werden, auf der besondere Möglichkeiten integrativer Prozesse gegeben sind. Dies ist insbesonder der Fall, da im Prinzip jedem der Zugang zu Sportvereinen möglich ist. Da der Zugang in die Breitensportvereine keinerlei Leistungsnachweis benötigt, kann hierbei von Niedrigschwelligkeit gesprochen werden. Dies stellt einen wichtigen Unterschied zu anderen klassischen Feldern dar, in denen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Positionierung gegeben sind.
Darüber hinaus können sich über die Aktivität in Sportvereinen kommunikative und soziale Kompetenzen sowie Wissensbestände angeeignet werden, dies es erleichtern soziale Kontakte zu knüpfen. Dies hat vor allem positive Auswirkungen auf weiterführende Integrationsprozesse, die auch über den Sport hinausgehen.
Die zum Teil kommunizierte These einer uneingeschränkten, integrativen Wirkung des Vereinssports ist undifferenziert und idealisierend. Auf Einschränkungen solcher integrativer Möglichkeiten wird auch im wissenschaftlichen Diskurs in den letzten Jahren deutlich hingewiesen.
Die Argumentation dabei findet insbesondere auf den Umstand statt, dass Personen mit Migrationshintergrund in Sportvereinen sowohl als Mitglieder als auch als ehrenamtlich engagierte Individuen unterrepräsentiert sind.
Zugangsmöglichkeiten im Sport sind also offensichtlich nicht für alle in gleichberechtigter Art und Weise gegeben. Vielmehr sind diese für Personen mit Migrationshintergrund mit Barrieren verbunden. Außerdem stellen sich alltägliche interkulturelle Situationen im Vereinssport keineswegs immer integrativ dar, sondern beinhalten auch großes Konfliktpotenzial.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Hinführung zu Integration und Sport
- Der Integrationsbegriff
- Diskussion des Integrationsbegriffs
- Vereinssport als Plattform zur Integration
- Integrative Potenziale
- Binnenintegrative Wirkung
- Außenintegrative Wirkung
- Betrachtung der Sozialintegration
- Kulturation
- Platzierung
- Interaktion
- Identifikation
- Vereinssport als Möglichkeit zur Integration
- Umgang mit Körperkontakt
- Vertrautheit mit Vereinswesen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen Vereinssport das Potenzial zur Integration eröffnet. Sie untersucht die Voraussetzungen für eine gleichberechtigte integrative Teilhabe in Sportvereinen und beleuchtet die Rolle des Vereinssports als Plattform für Integrationsprozesse. Dabei werden mögliche integrative Wirkungen des Vereinssports analysiert, aber auch Faktoren, die diesen Effekten entgegenstehen können, berücksichtigt.
- Der Integrationsbegriff im Kontext von Migrations- und Integrationsforschung
- Die Rolle des Vereinssports als Plattform für Integration
- Integrative Potenziale des Vereinssports
- Herausforderungen und Barrieren für Integration im Vereinssport
- Forschungsstand der sportbezogenen Integrationsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Rolle des Sports als Verbindungsstück und Raum für Begegnungen, wobei die besondere integrative Wirkung des Vereinssports hervorgehoben wird. Kapitel 2 widmet sich der Definition und Diskussion des Integrationsbegriffs, wobei das Modell von Hartmut Esser als theoretische Grundlage dient. In Kapitel 3 wird der Vereinssport als Plattform für Integration analysiert, wobei die integrative Wirkung auf verschiedenen Ebenen betrachtet wird, einschließlich der Sozialintegration. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Integration, Vereinssport, Sozialintegration, integrative Potenziale, Migrationshintergrund, Sportvereine, Kulturation, Platzierung, Interaktion, Identifikation, Körperkontakt, Vereinswesen und Forschungsstand der sportbezogenen Integrationsforschung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Das Potenzial für Integration und integrative Prozesse durch Vereinssport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343126