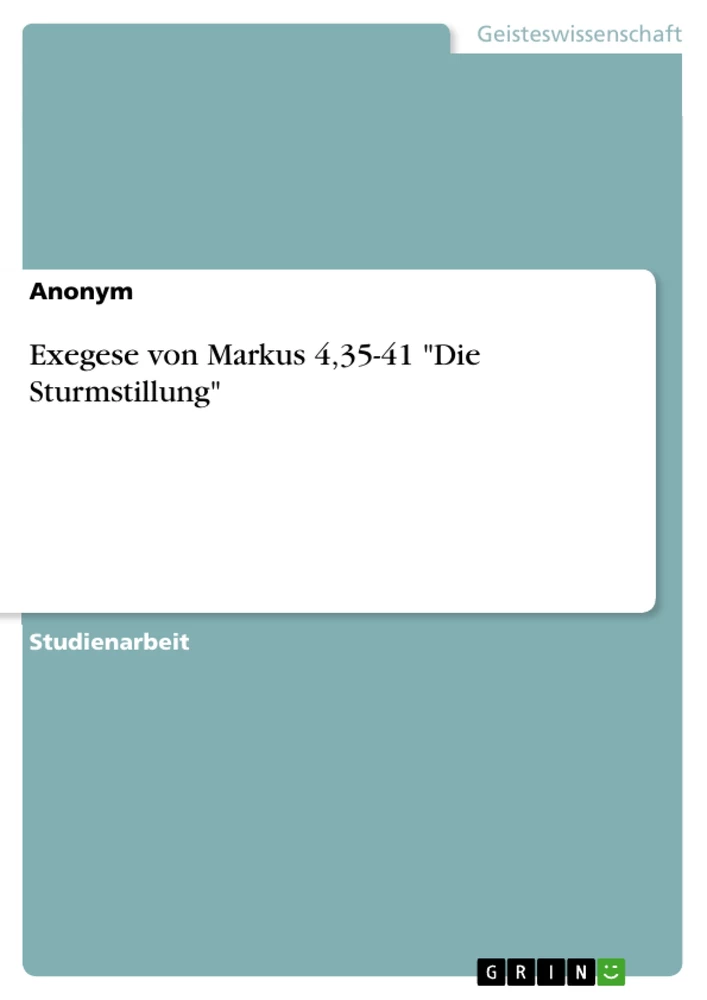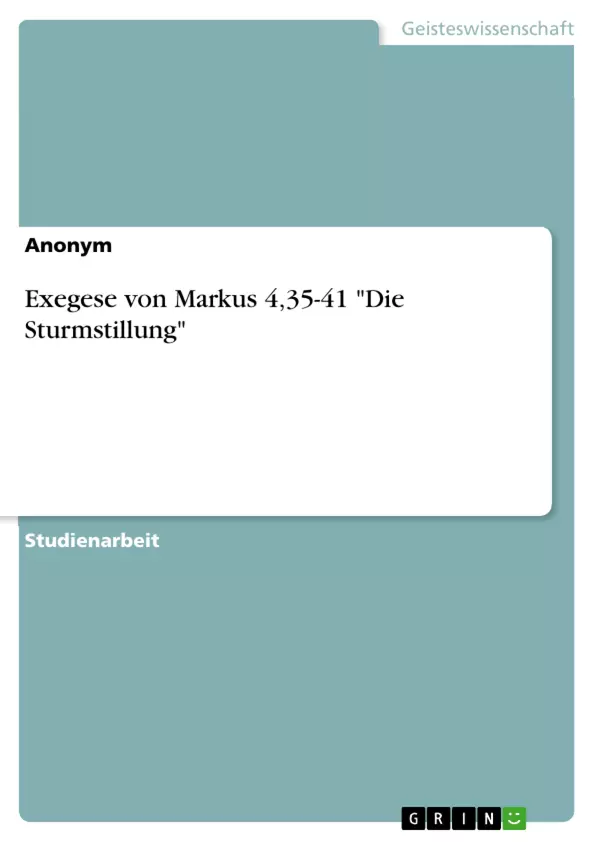Die vorliegende Perikope des Markusevangeliums thematisiert die Stillung des Sturmes. Sie befindet sich zwischen einer Gleichnisrede (Mk 4,1-34) und einer Wundergeschichte (Mk 5,1-20) und ist in den Kontext des Evangeliums gut eingebunden, da der Verfasser eine gelungene Verbindung zu dem vorangehenden und dem nachfolgenden Geschehen geschaffen hat. Auffällig ist dies an der Wortwahl in 4,35f, da die Handlung direkt an die im Vorfeld bereits berichteten Ereignisse anknüpft. Die agierenden Personen werden bei dem Einstieg in das Geschehen lediglich mit 'er' und 'ihnen' benannt und erhalten im weiteren Verlauf des Textauszuges keine explizite Namenszuweisung. Bei einer näheren Betrachtung der vorangehenden Verse ist deutlich zu erkennen, dass mit 'ihnen' die Jünger und mit 'er' Jesus gemeint sind. Somit wird die Kenntnis ihrer Namen anhand des bereits ereigneten Geschehens vorausgesetzt.
Im Vorfeld der Sturmstillungserzählung hatte Jesus am Ufer des Sees Genezareth zu lehren begonnen und der sich versammelnden Menschenmenge und den Jüngern in Gleichnissen gepredigt. Da die Anzahl seiner Zuhörer stieg, musste er sich in ein Boot stellen (Mk 4,1). Anhand der Angabe 'am Abend desselben Tages' (V. 35) und der Tatsache, dass die Jünger das Volk entlassen und mit Jesus so lossegeln 'wie er im Boote war' (V. 36), deutet ebenfalls darauf hin, dass der Tag und der Schauplatz der Gleichnisrede mit dem beschriebenen Tag und Schauplatz des Textauszuges in Mk 4,1 übereinstimmt.
Die Geschichte endet mit einer Frage der Jünger, deren Beantwortung in Mk 8,29 bzw. Mk 15,39 erfolgt. Eine Verbindung zu der nachfolgenden Perikope von der Heilung eines besessenen Geraseners (Mk 5,1-20) vollzieht sich, indem an das zu Beginn erwähnte Vorhaben Jesu (V. 35), an das andere Ufer überzusiedeln, angeknüpft wird. Dies ist der Formulierung 'und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener' (Mk 5,1) zu entnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Abschrift des zugrundegelegten Textes...
- Analyse des Textes
- Abgrenzung und Kontext
- Gliederung des Textes.
- Abgrenzung von Tradition und Redaktion.
- Gattungsbestimmung der vormarkinischen Überlieferung
- Begriffsbestimmung bzw. religionsgeschichtliche Analyse........
- Interpretation
- Interpretation der vormarkinischen Überlieferung......
- Interpretation des markinischen Textes..
- Interpretation des Textes an sich
- Interpretation des Textes im theologischen Gesamtrahmen des Mk.
- Synoptischer Vergleich ...........
- Interpretation der mt. Parallele (Mt 8,23-27).
- Interpretation der lk. Parallele (Lk 8,22-25).
- Zusammenfassung und Bündelung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse und Interpretation der Stillung des Sturmes im Markusevangelium (Mk 4,35-41). Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung und die Bedeutung dieser Perikope im Kontext des Markusevangeliums zu beleuchten. Sie untersucht die verschiedenen Schichten der Überlieferung und analysiert die redaktionellen Eingriffe des Evangelisten Markus.
- Die Rolle von Tradition und Redaktion in der Entstehung der Perikope
- Die Interpretation der Stillung des Sturmes im Kontext des Markusevangeliums
- Die Bedeutung des Wunders für die Jünger und für das Verständnis der Person Jesu
- Der Vergleich der Parallelperikopen in Matthäus und Lukas
- Die Bedeutung der Perikope für die Theologie des Markusevangeliums
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Abschrift des zugrundeliegenden Textes, gefolgt von einer umfassenden Analyse der Perikope. In diesem Abschnitt werden der Kontext und die Abgrenzung der Perikope, ihre Gliederung und die Unterscheidung zwischen Tradition und Redaktion untersucht. Zudem wird die Gattungsbestimmung der vormarkinischen Überlieferung und eine religionsgeschichtliche Analyse des Textes vorgenommen.
Im dritten Kapitel erfolgt die Interpretation der Perikope, sowohl der vormarkinischen Überlieferung als auch des markinischen Textes. Die Interpretation des Textes an sich und im theologischen Gesamtrahmen des Markusevangeliums stehen im Fokus.
Das vierte Kapitel widmet sich einem synoptischen Vergleich der Parallelperikopen in Matthäus und Lukas. Die Interpretation der mt. Parallele (Mt 8,23-27) und der lk. Parallele (Lk 8,22-25) werden hier genauer betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Stillung des Sturmes, Markusevangelium, Tradition und Redaktion, Wundergeschichte, Jüngergeschichte, Jesus Christus, Vollmacht, Gottesreich, Synoptische Evangelien, Vergleichende Bibelauslegung, Theologie des Markusevangeliums.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Perikope Markus 4,35-41?
Das zentrale Thema ist die Stillung des Sturmes durch Jesus auf dem See Genezareth.
In welchem Kontext steht die Sturmstillung im Markusevangelium?
Die Erzählung steht zwischen einer Gleichnisrede (Mk 4,1-34) und der Heilung eines Besessenen (Mk 5,1-20) und ist eng mit dem vorangehenden Geschehen verknüpft.
Wie unterscheiden sich Tradition und Redaktion in diesem Text?
Die Arbeit untersucht, welche Teile aus der mündlichen oder schriftlichen Überlieferung (Tradition) stammen und wie der Evangelist Markus diese redaktionell bearbeitet und theologisch gedeutet hat.
Welche Rolle spielen die Jünger in dieser Geschichte?
Die Jünger werden als Zeugen der Vollmacht Jesu dargestellt, reagieren aber mit Furcht und Unverständnis, was durch ihre abschließende Frage deutlich wird.
Was zeigt der synoptische Vergleich mit Matthäus und Lukas?
Der Vergleich analysiert, wie die Parallelstellen (Mt 8,23-27 und Lk 8,22-25) eigene Akzente setzen und das Wunder im Vergleich zur Markus-Vorlage interpretieren.
Welche Gattung wird dem Text zugeschrieben?
Der Text wird primär als Wundergeschichte bzw. Rettungswunder eingestuft, enthält aber auch Elemente einer Jüngergeschichte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Exegese von Markus 4,35-41 "Die Sturmstillung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343256