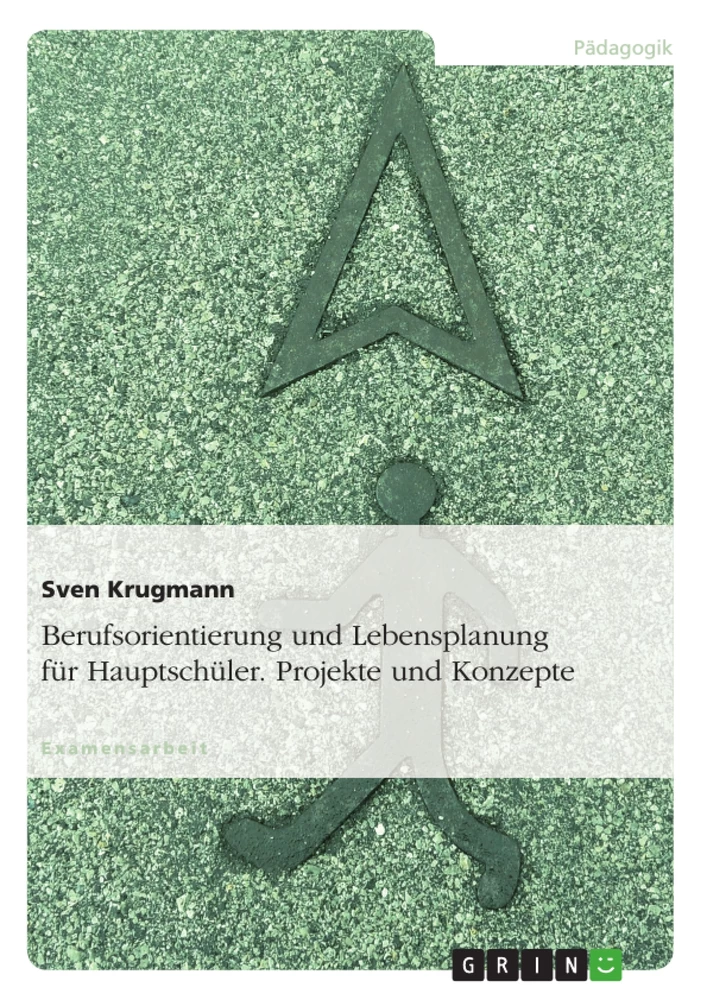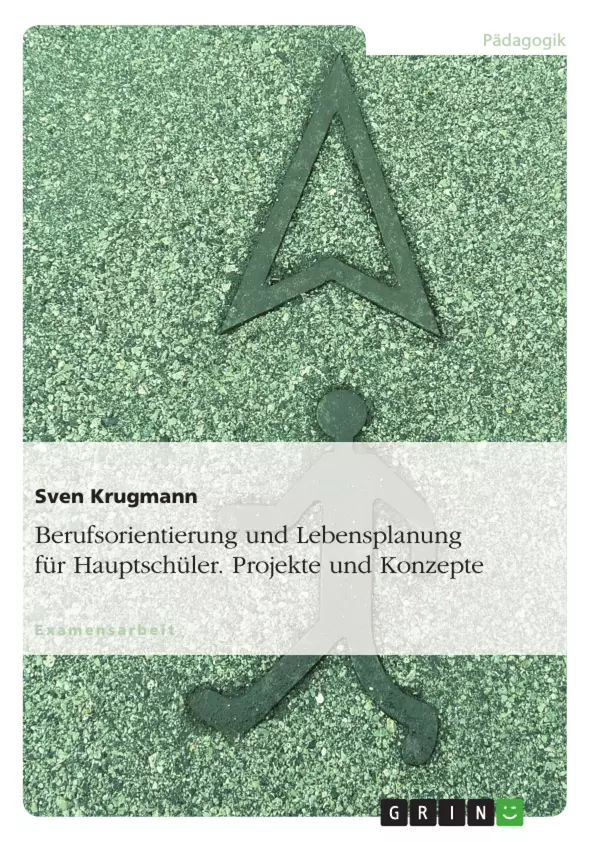Die aktuelle Diskussion im Deutschen Bildungswesen hat nach der PISA-Studie, durch die sich schwer wiegende Mängel des deutschen Schulwesens auftaten, die Hauptschule erreicht. So stellte etwa Kahl (2004a) heraus:
„23 Prozent der 15-Jährigen gehören zur so genannten Risikogruppe, bei denen es fraglich ist, ob sie je einen Beruf bekommen ... Während die OECD-Länder durchschnittlich 12,7 Prozent der öffentlichen Haushalte für Bildung aufwenden (Tendenz steigend), verharrt Deutschland seit 1995 unverändert bei 9,7 Prozent.“
Betroffen von dieser Situation sind die Schüler aller in Deutschland existierenden Schulformen, vor allem aber Hauptschulabgänger. Lehmann und Füller stellen fest: „Auf der Strecke bleiben immer noch sozial Schwache.“ (Lehmann, A.; Füller, C. 2004b, S. 3) Während in allen Ländern sowohl bei der PISA als auch der OECD-Studie 2004 die Länder Spitzenpositionen belegen, in denen ein Gesamtschulsystem existiert, welches die Schülerinnen bis zur neunten oder zehnten Klasse vereinigt, hält Deutschland an seinem dreigliedrigen Schulsystem fest. Die ehemalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn geht sogar so weit, es als siebengliedrig zu bezeichnen, indem sie neben Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen auch diverse Sonderschulformen und Förderstufen mit einbezieht (vgl. ebd.). Hieraus, so Lehmann und Füller, ergebe sich ein echtes „Schulwirrwar“. Jutta Almendinger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung stellt fest:
„Die Ausleseverfahren, die wir uns in unserem dreigliedrigen Schulsystem leisten, führen weder zu einer breiten Spitze von Eliteschülern, noch verhindern sie, dass wir beinahe 25 Prozent gering Gebildeter produzieren.“ (Füller, C. 2004a, S. 18.)
Welche Perspektiven ergeben sich daraus für eine hoch entwickelte Industrienation wie die Bundesrepublik Deutschland? Wie können 25 Prozent, also ein Viertel eines Altersjahrgangs, in die Gesellschaft unseres Landes integriert werden und wie kann man sie auf diesen Prozess vorbereiten? Einen zentralen Stellenwert nimmt der Beruf bei der Teilhabe an der Gesellschaft ein. Der Zugang aber wird von den Leistungen, welche in der Schule erbracht wurden, also vom Schulabschluss bestimmt. Zudem macht der aktuelle Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft die Eingliederung von Absolventen der unteren Bildungsabschlüsse in die Wirtschafts- und Arbeitswelt schwierig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulische Berufsorientierung im historischen Kontext
- Berufsorientierung in der Schule nach 1945
- Die Hauptschule: Konzeption und Realität
- Zur Lebenswelt und Ausgangssituation von Hauptschülern
- Die Shell-Studie 2002: Werte und Wertetypen unter Jugendlichen
- Idealisten
- Unauffällige
- Macher
- Materialisten
- Demographische und soziale Struktur der Wertetypen
- Erwartungen der Wirtschaft an Hauptschüler
- Berufsorientierung in der Hauptschule
- Die Rolle der Bundesagentur für Arbeit
- Das Betriebspraktikum
- Berufsorientierung und Lebensplanung
- Berufsorientierung und Lebensplanung in der Grundschule
- Defizite der schulischen Berufsorientierung
- Lebensplanung als Erweiterung der Berufsorientierung
- ICH-Bildung
- Selbsterfahrung
- Erkundung der Arbeits- und Berufswelt
- Exkurs: Leben und arbeiten außerhalb der Erwerbsarbeit
- Lokales Kapital für Soziale Zwecke „LOS“
- Allgemeines
- LOS in Kassel-Oberzwehren
- Konzepte der Arbeitsgemeinschaften
- Voraussetzungen
- Die Durchführung
- Perspektiven des Projekts
- Berufsorientierungs- und Lebensplanungsseminare des Werra-Meißner-Kreises
- Allgemeines
- Exkurs: Warum Seminare zur Berufsorientierung und Lebensplanung außerhalb der Schule?
- Seminartypen
- Seminarablauf für eine achte Hauptschulklasse
- Wer bin ich?
- Fähigkeitenparcours
- Was will ich werden?
- Seminarablauf für eine neunte Hauptschulklasse
- Bewerbungstraining
- Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch
- Rollenspiele
- Vorstellungsgespräch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Hauptschule Schülerinnen und Schüler auf die Arbeits- und Wirtschaftswelt vorbereitet. Sie analysiert die Werte, Lebenswelt und Ausgangssituation von Hauptschülern sowie die Erwartungen der Wirtschaft an diese. Des Weiteren untersucht die Arbeit, ob die Berufsorientierung in der Hauptschule noch zeitgemäß ist und wie sie erweitert werden könnte.
- Analyse der Lebenswelt und der Ausgangssituation von Hauptschülern
- Bewertung der Berufsorientierung in der Hauptschule
- Identifizierung von Defiziten der schulischen Berufsorientierung
- Bedeutung der Lebensplanung im Kontext der Berufsorientierung
- Analyse von Programmen und Maßnahmen zur Berufsorientierung und Lebensplanung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Hauptschule im Kontext der Bildungsdiskussion in Deutschland dar und beleuchtet die aktuelle Situation von Hauptschulabgängern in Bezug auf die Arbeitswelt.
- Schulische Berufsorientierung im historischen Kontext: Dieses Kapitel bietet einen historischen Abriss der Entwicklung der Berufsorientierung in der Schule nach 1945, um den heutigen Stellenwert der Orientierungshilfe im Kontext des Strukturwandels in Wirtschaft und Gesellschaft zu betrachten.
- Die Hauptschule: Konzeption und Realität: Dieses Kapitel analysiert die Lebenswelt und Ausgangssituation von Hauptschülern anhand von Daten aus der Shell-Studie 2002. Es beleuchtet die Werte und Wertetypen unter Jugendlichen und untersucht die Erwartungen der Wirtschaft an Hauptschüler.
- Berufsorientierung in der Hauptschule: Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Bundesagentur für Arbeit in der Berufsorientierung sowie die Bedeutung des Betriebspraktikums für die Vorbereitung auf die Arbeitswelt.
- Berufsorientierung und Lebensplanung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Integration von Lebensplanung in die Berufsorientierung und beleuchtet die Defizite der schulischen Berufsorientierung. Es stellt zudem verschiedene Ansätze zur Erweiterung der Berufsorientierung durch Lebensplanung vor, wie z.B. ICH-Bildung, Selbsterfahrung und Erkundung der Arbeits- und Berufswelt.
- Lokales Kapital für Soziale Zwecke „LOS“: Dieses Kapitel beschreibt das Projekt „LOS“ in Kassel-Oberzwehren, welches sich für die Förderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus sozial benachteiligten Verhältnissen einsetzt.
- Berufsorientierungs- und Lebensplanungsseminare des Werra-Meißner-Kreises: Dieses Kapitel befasst sich mit den Seminaren des Werra-Meißner-Kreises zur Berufsorientierung und Lebensplanung, die sich an Hauptschülern richten. Es beschreibt den Seminarablauf und die Inhalte für verschiedene Klassenstufen und beleuchtet die Relevanz von Lebensplanung im Schulunterricht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Berufsorientierung in der Hauptschule. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen der Berufsorientierung in der heutigen Zeit, die Lebenswelt und die Ausgangssituation von Hauptschülern, die Defizite der schulischen Berufsorientierung sowie die Bedeutung der Lebensplanung im Kontext der Berufsorientierung. Weitere wichtige Themen sind die Rolle der Bundesagentur für Arbeit, das Betriebspraktikum, verschiedene Programme und Maßnahmen zur Berufsorientierung und Lebensplanung sowie die Bedeutung von Praxisbezug und individueller Förderung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Berufsorientierung für Hauptschüler besonders kritisch?
Laut Studien gehören 23-25 % der Jugendlichen zu einer Risikogruppe mit geringen Bildungschancen, was den Zugang zum Arbeitsmarkt massiv erschwert.
Was sind die Erwartungen der Wirtschaft an Hauptschüler?
Die Arbeit analysiert die Diskrepanz zwischen der schulischen Realität und den Anforderungen der Unternehmen an Absolventen.
Wie wird „Lebensplanung“ in die Berufsorientierung integriert?
Durch Ansätze wie ICH-Bildung, Selbsterfahrung und gezielte Seminare sollen Schüler lernen, ihren Berufsweg als Teil ihrer gesamten Lebensgestaltung zu sehen.
Welche Rolle spielt das Projekt „LOS“ in Kassel?
Das Projekt „Lokales Kapital für Soziale Zwecke“ fördert Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen durch praxisnahe Konzepte.
Was beinhalten die Berufsorientierungsseminare im Werra-Meißner-Kreis?
Die Seminare umfassen Fähigkeitsparcours, Bewerbungstraining und Rollenspiele für Vorstellungsgespräche außerhalb des normalen Schulunterrichts.
- Arbeit zitieren
- Lehrer für das Lehramt an Haupt- und Realschulen Sven Krugmann (Autor:in), 2004, Berufsorientierung und Lebensplanung für Hauptschüler. Projekte und Konzepte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34326