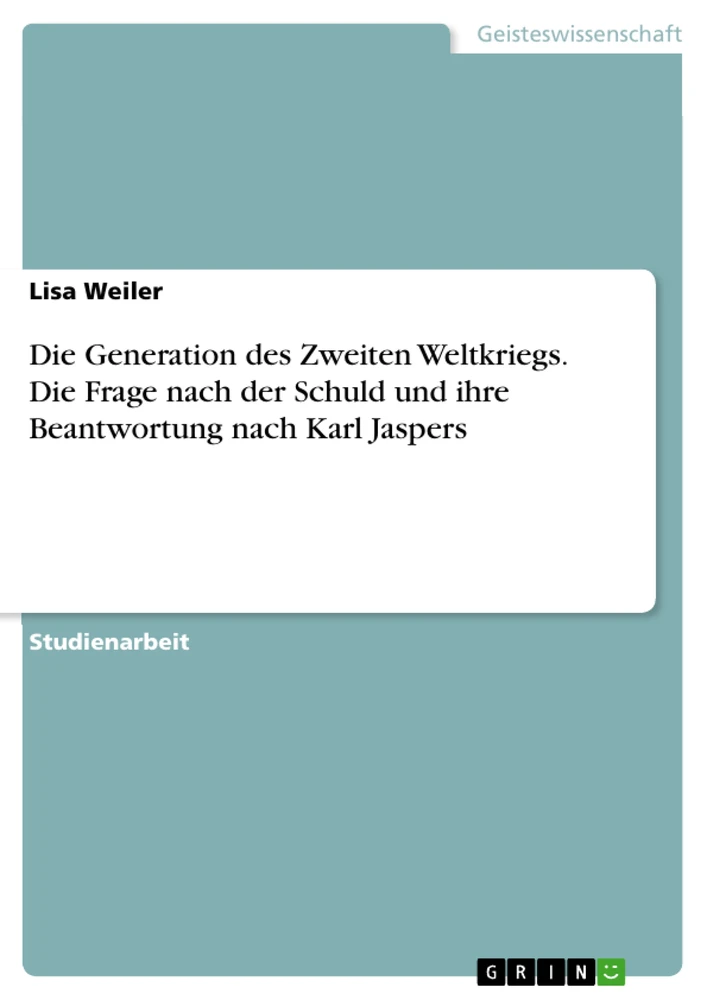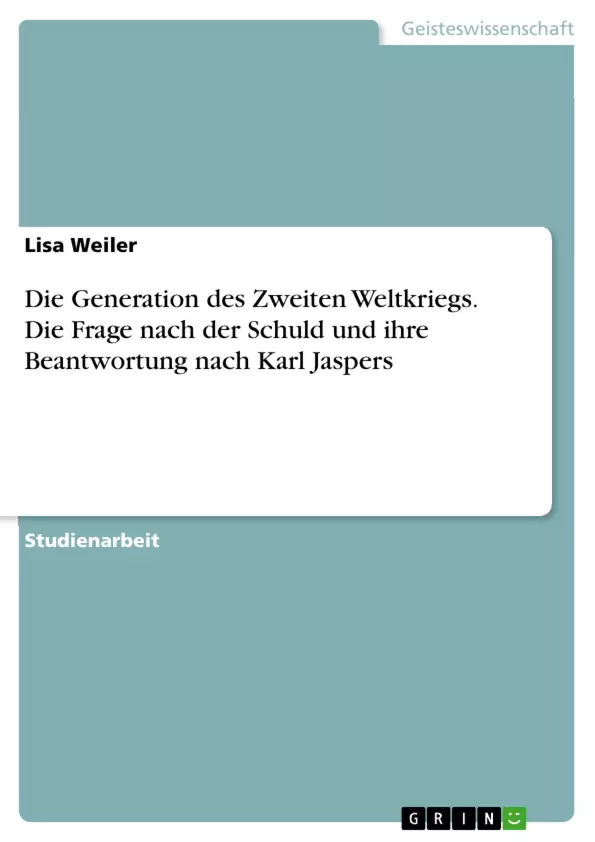Karl Jaspers veröffentlichte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Abhandlung über die Frage nach der Schuld am Krieg, doch berücksichtigte er dabei nicht die Kinder dieser Zeit. Nun stellt sich die Frage, inwiefern die zu Zeiten des Weltkrieges geborenen Kinder Schuld an diesem tragen oder nicht.
In dieser Arbeit wird ebendiese Frage, unter Berücksichtigung des zu Grunde liegenden Werkes "Die Schuldfrage" von Karl Jaspers, zu beantworten versucht. Begonnen wird mit einem sehr kurzen Einblick in die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs und die Situation der Neugeborenen bis Zehnjährigen dieser Zeit. Es folgt ein Kapitel zu „Die Schuldfrage“, in dem auf die vier Schuldbegriffe nach Jaspers eingegangen wird, die Wichtigkeit und Rechtmäßigkeit der Kollektivschuld erläutert und die Schuld der Kriegskinder näher skizziert werden. Dem schließen sich eine kurze Kritik an Jaspers Werk im Zusammenhang mit dieser Arbeit und ein abschließendes Fazit an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Zweite Weltkrieg – ein kurzer Einblick
- Die Generation Zweiter Weltkrieg – Kinder der Jahre 1935-1945
- Karl Jaspers Die Schuldfrage
- Die vier Schuldbegriffe
- Kriminelle Schuld
- Politische Schuld
- Moralische Schuld
- Metaphysische Schuld
- Die Kollektivschuld
- Die Schuldfrage im Zusammenhang mit den Kriegskindern
- Kritik an Jaspers' Werk
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage der Verantwortung der Generation Zweiter Weltkrieg, insbesondere der Kriegskinder, im Hinblick auf die Schuldfrage nach Karl Jaspers. Die Arbeit untersucht, inwiefern diese Menschen für den Krieg und die Folgen des Krieges verantwortlich gemacht werden können und ob sie Schuld am Geschehen tragen.
- Die Schuldfrage nach Karl Jaspers
- Die Situation der Kriegskinder im Zweiten Weltkrieg
- Die Verantwortung für historisches Unrecht
- Die vier Schuldbegriffe nach Jaspers
- Die Rolle der Kollektivschuld
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Situation von Kriegskindern in Seniorenheimen und stellt die zentrale Frage nach ihrer Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg. Sie führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den methodischen Ansatz, der auf den Werken von Karl Jaspers und Michael Schefczyk basiert.
Der Zweite Weltkrieg – ein kurzer Einblick
Dieses Kapitel bietet einen knappen Überblick über den Zweiten Weltkrieg, die Situation der Kriegskinder und die Folgen des Krieges für Deutschland.
Karl Jaspers Die Schuldfrage
Dieses Kapitel befasst sich mit den vier Schuldbegriffen nach Jaspers: kriminelle, politische, moralische und metaphysische Schuld. Es erläutert die Bedeutung der Kollektivschuld und untersucht die Schuldfrage im Kontext der Kriegskinder.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Kriegskinder, Zweiter Weltkrieg, Schuldfrage, Karl Jaspers, Kollektivschuld, Verantwortung, historisches Unrecht.
Häufig gestellte Fragen
Welche vier Schuldbegriffe unterscheidet Karl Jaspers?
Jaspers unterscheidet zwischen krimineller, politischer, moralischer und metaphysischer Schuld.
Tragen "Kriegskinder" eine Schuld am Zweiten Weltkrieg?
Die Arbeit untersucht, inwiefern die Generation, die zwischen 1935 und 1945 geboren wurde, nach Jaspers' Kriterien für das Geschehen verantwortlich gemacht werden kann.
Was bedeutet "Kollektivschuld" bei Jaspers?
Jaspers lehnt eine moralische Kollektivschuld ab, erkennt aber eine kollektive politische Haftung aller Bürger eines Staates für die Taten ihres Regimes an.
Was ist metaphysische Schuld?
Die Schuld, die daraus erwächst, dass man Zeuge von Unrecht wurde und überlebt hat, während andere starben, ohne dass man das Äußerste zur Hilfeleistung tat.
Warum ist Jaspers' Werk "Die Schuldfrage" heute noch relevant?
Es bietet ein differenziertes Gerüst für die Auseinandersetzung mit historischem Unrecht und persönlicher sowie staatlicher Verantwortung.
- Arbeit zitieren
- Lisa Weiler (Autor:in), 2016, Die Generation des Zweiten Weltkriegs. Die Frage nach der Schuld und ihre Beantwortung nach Karl Jaspers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343273