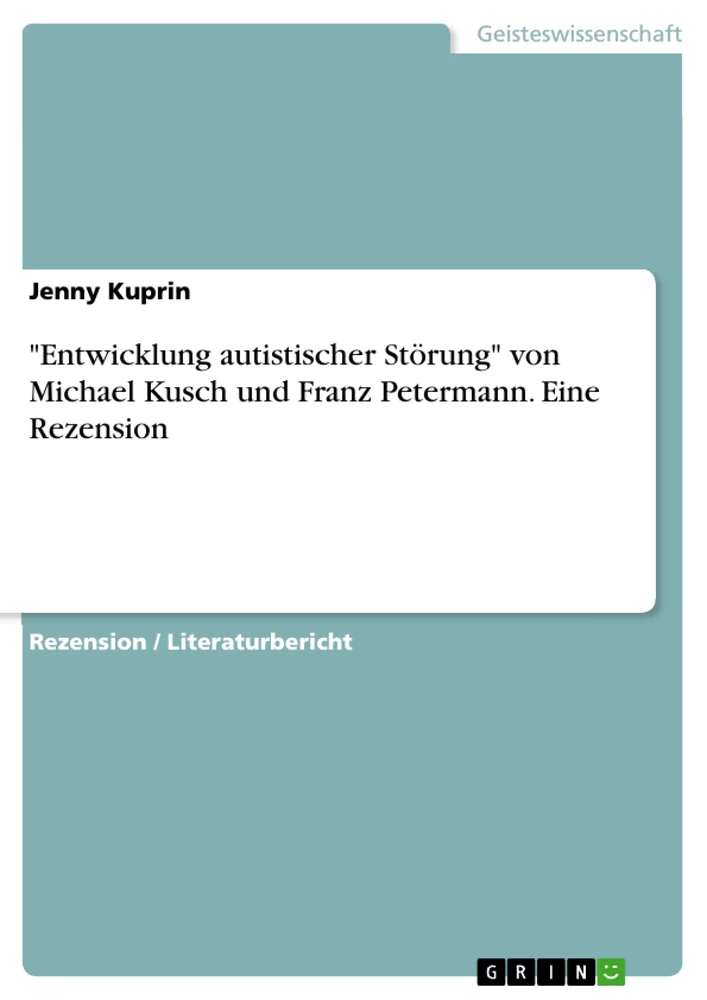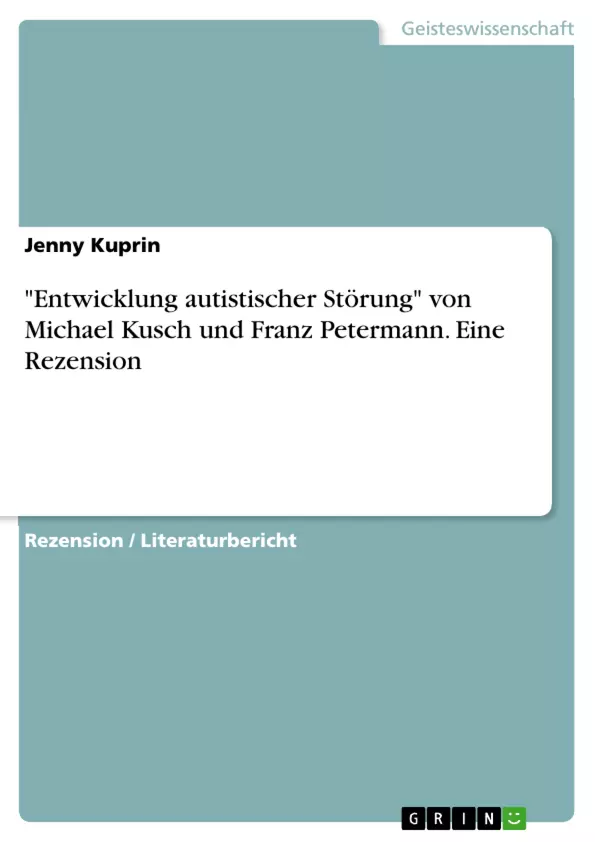Der Text ist eine Buchrezension der Veröffentlichung „Entwicklung autistischer Störung“ von Dr. Michael Kusch und Prof. Dr. Franz Petermann, erschienen im Hogrefe Verlag
Inhaltlich beschäftigt sich die Autorin mit den Autoren, dem Entstehungshintergrund, Aufbau und Inhalt des Buches, um mit einem Fazit zum gesamten Text zu enden.
Inhalt
Autoren
Entstehungshintergrund
Aufbau
Inhalt
Fazit
Literatur:
Autoren
Das Buch „ Entwicklung autistischer Störung“ wurde von zwei Autoren verfasst. Dr. Michael Kusch (geb. 1959) ist Absolvent des Studium der Psychologie in Bonn. Seine Schwerpunkte im Arbeitsbereich sind Versorgungspsychologie, -management und -forschung. Prof. Dr. Franz Petermann (geb.1953) hat sein Studium der Mathematik und Psychologie in Heidelberg abgeschlossen. Beide haben in verschieden Jahrgängen eine Leitungsposition im Psychosozialen Dienst, an dem Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn belegt.
Entstehungshintergrund
Die erste Auflage dieses Buches erschien Ende der 80er Jahre. Die Autoren hatten die Idee die internationale Literatur über Autismus „unter dem Blinkwinkel des Entwicklungsgedankens aufzuarbeiten“ (S.9). Näher analysiert wurden dabei die Entwicklung und Diagnostik der autistischen Störung besonders im ersten Lebensjahr.
Aufbau
Das Werk gliedert sich in sieben Kapitel:
1 Definition und Klassifikation
2 Epidemiologie
3 Differentialätiologische Betrachtung
4 Ätiopathogenetisches Modell der Entwicklung autistischer Störung
5 Entwicklungsstörungen autistischer Kinder
6 Diagnostik autistischer Störung
7 Entwicklungsbezogene Intervention bei autistischen Störung
Inhalt
In den ersten Kapiteln gehen die Autoren auf die Geschichte der Erforschung und Behandlung autistischer Störung ein, als noch im Vordergrund das „Psychokonzept“ stand. Es werden Ergebnisse von mehreren Langzeitstudien, vergleichende und psychologische Studien, sowie in den späteren 80er Jahren auch neuropsychologische Studien vorgestellt. Die Ergebnisse der Autismusforschung zeigten, dass „die Störung bereits von Geburt an besteht oder sich bereits in den ersten ein-einhalb Jahren entwickelt“ (S.18) Zudem nimmt die Entwicklung des Sozialverhaltens eine zentrale Stellung für das Verständnis des Autismus ein.
Eine tiefgreifende Begriffserklärung „infantiler oder Frühkindlicher Autismus“ ist grundsätzlich in DSM-III-R, DSM-IV und ICD-10 sehr unterschiedlich. Die Autoren stellen gemeinsam eine allgemeine Beschreibung der typischen autistischen Störung dar, jedoch deuten sie an, dass es typisches autistisches Kind nicht gibt. In ihrer Beschreibung gehen sie nicht nur auf die Verhaltensdefizite, sondern auch auf die Kompetenzen wie eine normale Intelligenz, eine rezeptive und expressive Sprachfähigkeit und eine funktionale Spielfähigkeit ein. „Der sozialen Interaktion und Kommunikation, des Verstehens und Äußerns von Gefühlen und des Kontaktverhaltens und der Anhänglichkeit“ werden aus den zentralen Störungsbereichen ausgelöst. (S.26)
Im zweiten Kapitel werden ganz kurz und allgemein die Ergebnisse aus verschiedenen Studien zu den Themen die Epidemiologie, den Bestand der Krankheitsfälle und Angaben zur Intelligenzverteilung berichtet.
In dem nächsten Kapitel versuchen die Autoren folgende Fragen zu beantworten: Wann kommt es zur neurologischen Störung? Wo ist diese Störung zu lokalisiert? Und wie ist die neurologische Funktion gestört? Es stellt sich heraus, dass das Geburtsereignis an sich und die entwicklungsbedingten psychischen Anforderungen des achten bis 14. Lebensmonats als auslösende Bedingungen gelten können. Es werden mehrere quantitative sowie qualitative Studien ab den Ende der 80er Jahre vorgestellt, die anhand standardisierter Videoanalysen zu diesen Ergebnissen führten.
Weitgehend werden die autistischen Störungen aus der Sicht zahlreicher Modelle und Theorien betrachtet und analysiert. Psychologische Erklärungsmodelle gehen davon aus, dass autistische Kinder immer dort Schwierigkeiten besitzen, wenn sie in irgendeiner Form in der Kommunikation mit anderen Menschen stehen. Eine besondere Stelle nimmt eine Logico – affektive Theorie von Hermelin und O`Connor. Bei der Durchführung einiger psychologischer Experimente stellten Hermelin und Q`Connor fest, dass die Ursache von Autismus in einer Störung des kognitiv – emotionalem Zustandes liegt. Ein logico – affektiver Zustand entsteht zwischen einer Handlungsabsicht und einer Handlung. Dadurch werden „Verhaltensbereiche beeinträchtigt, die aus der Interaktion der kognitiven und affektiven Funktionen resultieren“ (S.77) Die autistischen Störungen werden auch aus Sicht der sozialen Theorien (Modell von Dawson, Waterhouse und Fein), sozial – kognitive Theorien (nach Baron – Cohen, Theorie des sozialen Lernens nach Sternberg) und sozial- affektiven Theorien (nach Hobson, Intersubjektivitätstheorie nach Rogers und Pennington usw.) betrachtet.
In dem vierten Kapitel werden anhand mehrerer Studien verschiedene Hypothesen zur Entwicklung autistischer Störung vorgestellt. Zudem zählt ein transaktionales Entwicklungsmodell, in deren die Transaktion zwischen Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem eine wichtige Rolle spielt. Entwicklungspsychopathologische Konzepte und Modelle beschäftigen sich mit Genetik und Umweltfaktoren, die Möglicherweise in der Interaktion als Risikofaktoren für autistischer Störung verantwortlich sein können. Die Autoren diskutieren die biopsychosozialen Transaktionen. Aus diesen Überlegungen entsteht das Modell der Performanz- und Kompetenzentwicklung, die auf unterschiedlichen Ebenen die Entwicklung autistischer Störung beschreibt. Ein weiteres Modell ist das integrative Modell der Entwicklung im Säuglingsalter.
Die empirischen Arbeiten zur Entwicklung autistischer Störung werden in dem nächsten Kapitel diskutiert. Dabei wird der Fokus auf biopsychosoziale Wechselwirkungen gelegt, die in der Säuglingsentwicklung während der ersten 18 Lebensmonate in vier Perioden geteilt wird. Solche sind 0 bis 3., 3. bis 6., 6. bis 12. Und 12. bis 18. Lebensmonate. In dem Bereich biopsychosozialer Wechselwirkungen ist in biologische, psychologische, psychosoziale und sozial – interaktive Regulation zu unterscheiden. Die Autoren nehmen die biopsychosozialen Wechselwirkungen in jeweiligen Entwicklungsperioden sehr detailliert in den Fokus. In Mittelpunkt stehen solche Themen wie Sprache, verbale und non – verbale Kommunikation, kognitive Kontrolle, Aufmerksamkeitssteuerung, symbolisches Spiel usw.
Durch eine Diagnostik und eine Früherkennung autistischer Störung kann eine gezielte Frühförderung erfolgen, die die meisten anhaltenden positiven Effekte aufweist. Somit werden im sechsten Kapitel standardisierte Vorgehensweisen zur Diagnostik autistischer Störung vorgestellt. GARS (Gilliam Autism Rating Scale), PIA (Parent Interview for Autism), PDDST (Pervasive Developmental Disorder screening Test – Stage 2, VABS (Vineland Adaptive Behavior Scales), Hamburg Wechsler Intelligenztests für Kinder sind nur einige Verfahren, die in diesen Kapitel detailliert erklärt werden. Nach der Zusammenfassung von Annahmen, die für die Frühförderung autistischer Kinder zentral sind, werden mehrere Therapieverfahren vorgestellt, die auf den drei wesentlichen Modellen wie endogenetische, exogenetische und transaktionale Entwicklungsmodelle basieren.
Fazit
Das Buch von Kusch und Petermann entsteht aus dem Bereich der klinischen Kinderpsychologie. Vor allem das Thema „Autismus“ wird nur auf das Lebensjahr bezogen. Die Autoren gehen sehr detailliert mit jeglichen Grundbegriffen um, so dass sehr oft ein geschichtlicher Exkurs beschrieben wird, was zu deutlicherem Verständnis von Begriffen führt.
Diverse Theorien und Modellen werden nicht nur erklärt und vorgestellt, sondern auch mit mehreren Studien zu unterlegt. Um es handgreiflicher zu erklären, werden auch Beispiele eingebracht. Auch mehrere Tabellen, die einige Modelle bildlich darstellen, vereinfachen und das Verständnis verdeutlichen stehen zur Verfügung. Die Autoren bringen dem Leser deutlich rüber, dass die vorgestellten Theorien und Modelle nicht als einzige Erklärung von autistischen Störungen bei Kindern gelten und geben dabei einen Input an andere Theorien und Hypothesen mit dem Verweis auf Autoren.
Anbei muss man anmerken, dass dieses Buch nicht so einfach zu lesen ist. Die Autoren nutzen sehr oft eine Fachsprache, die an manchen Stellen eine extra Erklärung benötigt. Somit ist dieses Buch nur an Profis bzw. Fachleute gerichtet.
Im sechsten Kapitel werden zwar die diagnostischen Verfahren der Früherkennung von autistischer Störung sehr ausführlich mit Fragen zur Einschätzung, anhand klinischer Indikatoren und psychometrischer Verfahren vorgestellt, anbei muss man anmerken, dass diese Vorgehensweisen sehr standardisiert sind und keinen Freiraum für eigene Einschätzung von Kindern lassen, die möglicherweise eine autistischer Störung haben. Dies zeigt sich durch klare die Abgrenzung zwischen den Lebensabschnitten.
Literatur:
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Buch "Entwicklung autistischer Störung" von Kusch und Petermann?
Das Buch beschäftigt sich mit der Entwicklung und Diagnostik autistischer Störungen, insbesondere im frühen Kindesalter. Es beleuchtet die Geschichte der Autismusforschung, verschiedene Erklärungsmodelle und Theorien, sowie diagnostische Verfahren und Interventionsansätze.
Wer sind die Autoren des Buches?
Die Autoren sind Dr. Michael Kusch und Prof. Dr. Franz Petermann. Beide haben Psychologie studiert und waren in leitenden Positionen im psychosozialen Dienst am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn tätig.
Was war der Entstehungshintergrund des Buches?
Die Autoren wollten die internationale Literatur über Autismus aus der Perspektive des Entwicklungsgedankens aufarbeiten. Sie konzentrierten sich besonders auf die Entwicklung und Diagnostik autistischer Störungen im ersten Lebensjahr.
Wie ist das Buch aufgebaut?
Das Buch gliedert sich in sieben Kapitel: Definition und Klassifikation, Epidemiologie, Differentialätiologische Betrachtung, Ätiopathogenetisches Modell der Entwicklung autistischer Störung, Entwicklungsstörungen autistischer Kinder, Diagnostik autistischer Störung, und Entwicklungsbezogene Intervention bei autistischer Störung.
Welche Themen werden in den ersten Kapiteln behandelt?
Die ersten Kapitel behandeln die Geschichte der Autismusforschung, die Entwicklung des Sozialverhaltens, die unterschiedlichen Definitionen des frühkindlichen Autismus in DSM-III-R, DSM-IV und ICD-10, sowie epidemiologische Daten und Intelligenzverteilung bei Autismus.
Welche Fragen werden im dritten Kapitel beantwortet?
Die Autoren versuchen, folgende Fragen zu beantworten: Wann kommt es zur neurologischen Störung? Wo ist diese Störung lokalisiert? Und wie ist die neurologische Funktion gestört?
Welche psychologischen Erklärungsmodelle werden vorgestellt?
Es werden verschiedene psychologische Erklärungsmodelle vorgestellt, darunter die Logico-affektive Theorie von Hermelin und O'Connor, sowie soziale, sozial-kognitive und sozial-affektive Theorien.
Welche Modelle zur Entwicklung autistischer Störung werden diskutiert?
Diskutiert werden unter anderem ein transaktionales Entwicklungsmodell, entwicklungspsychopathologische Konzepte und Modelle, das Modell der Performanz- und Kompetenzentwicklung und das integrative Modell der Entwicklung im Säuglingsalter.
Worauf liegt der Fokus im fünften Kapitel?
Der Fokus liegt auf biopsychosozialen Wechselwirkungen in der Säuglingsentwicklung während der ersten 18 Lebensmonate, unterteilt in vier Perioden (0-3, 3-6, 6-12, 12-18 Monate).
Welche diagnostischen Verfahren werden im sechsten Kapitel vorgestellt?
Es werden standardisierte Vorgehensweisen zur Diagnostik autistischer Störung vorgestellt, darunter GARS (Gilliam Autism Rating Scale), PIA (Parent Interview for Autism), PDDST (Pervasive Developmental Disorder screening Test – Stage 2, VABS (Vineland Adaptive Behavior Scales) und Hamburg Wechsler Intelligenztests für Kinder.
An wen richtet sich das Buch?
Das Buch richtet sich primär an Fachleute und Experten im Bereich der klinischen Kinderpsychologie und Autismusforschung, da es eine hohe Fachsprache verwendet.
Was ist das Fazit des Buches?
Das Buch bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema Autismus, insbesondere im frühen Kindesalter. Es werden diverse Theorien und Modelle vorgestellt und mit Studien belegt. Allerdings ist das Buch aufgrund der Fachsprache nicht leicht zu lesen und richtet sich eher an Fachleute.
- Quote paper
- Jenny Kuprin (Author), 2016, "Entwicklung autistischer Störung" von Michael Kusch und Franz Petermann. Eine Rezension, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343502