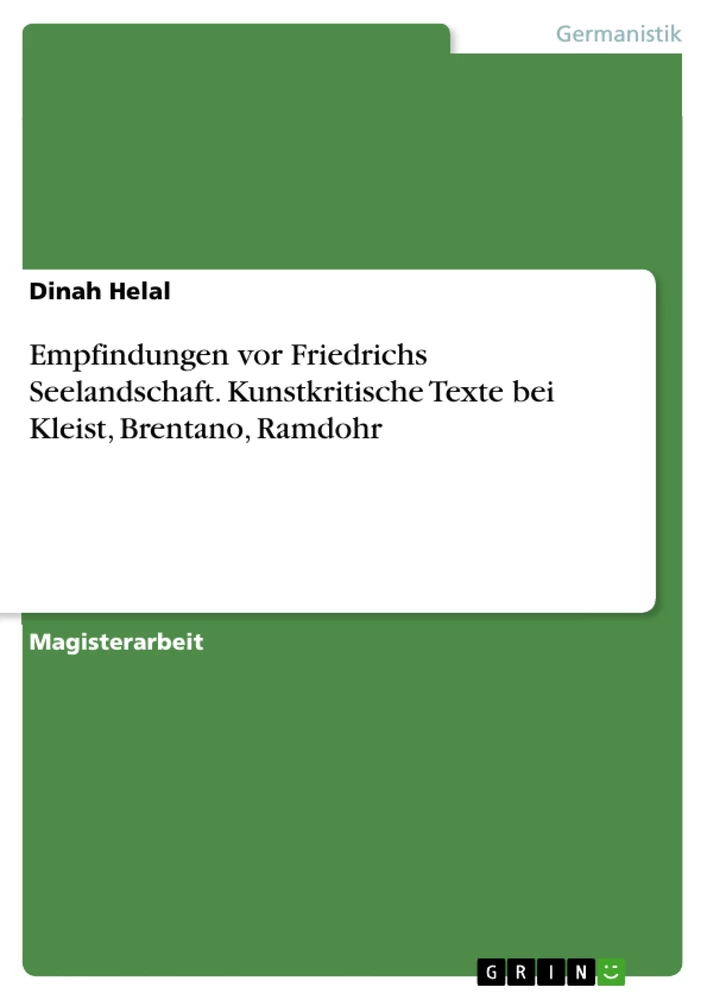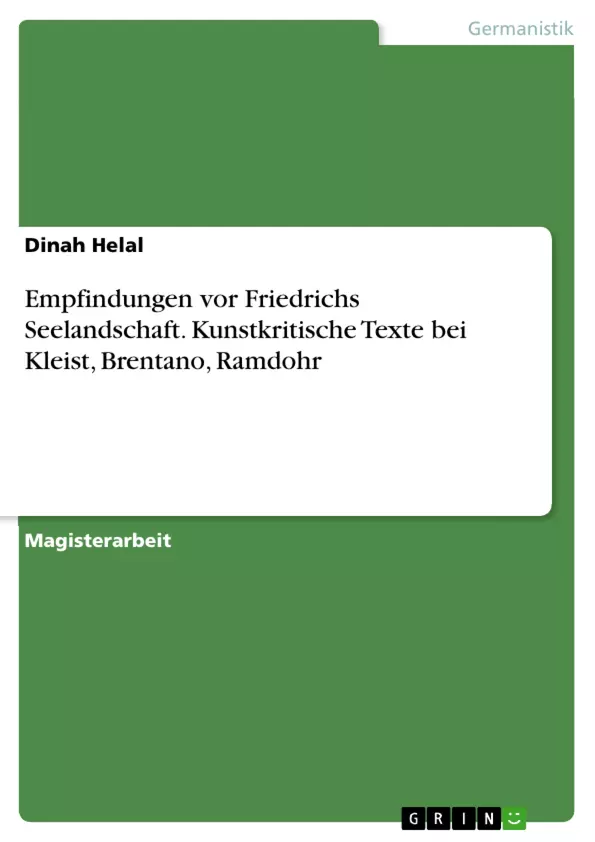Die vorliegende Magisterarbeit ist 2006 geschrieben worden und ihre komplexe Auslegung hat bis heute interpretatorische Überraschungen zu bieten. Seitdem ist es zu neu veröffentlichten Erkenntnissen gekommen, auf die in dieser Arbeit auch schon hingewiesen worden ist. Peter Bexte hat in einem Aufsatz im Kleist-Jahrbuch 2008/2009 auf die Quelle der Formulierung der weggeschnittenen Augenlider aufmerksam gemacht, ohne eine Interpretation anzubieten. Melanie Waldheim macht 2014 in "Kunstbeschreibungen in Ausstellungsräumen um 1800" auf einen Zusammenhang zwischen Ramdohr und Brentano aufmerksam, während Jost Hermand 2011 in "Politische Denkbilder" den patriotischen Gehalt des Gemäldes -Der Tetschener Altar- thematisiert.
Dennoch ist bisher keine Arbeit erschienen die einen ausführlichen Zusammenhang zwischen Ramdohr, Kleist und Brentano herstellt oder zur Erhellung des Konfliktes zwischen Kleist und Brentano beiträgt und die Konsequenzen für die Berliner Abendblätter beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Einleitung
- I. 1. Kleists Konflikt mit Brentano und Arnim
- II. Vorgeschichte
- II. 1. Entstehungsgeschichte des Tetschener Altar
- II. 2. Die Rezension Ramdohrs
- II. 2. 1. Zusammenfassung
- II. 3. Reaktionen auf die Rezension Ramdohrs
- II. 4. Berlin 1810 – Die Kunstausstellung
- II. 5. Die Berliner Abendblätter
- III. Clemens Brentanos und Achim von Arnims Reaktion auf eine Landschaft in Öl von Caspar David Friedrich
- III. 1. Verschiedene Empfindungen vor einer Seelandschaft von Friedrich, worauf ein Kapuziner, veröffentlicht 1826 in der Iris
- III. 1. 1. Die gestrichene Einleitung aus der Handschrift
- III. 2. Die Leseorientierung des Titels
- III. 2. 1. Abweichungen im Titel der Handschrift
- III. 3. Zur biblischen Referenz: Petrus, der über das Wasser gehen will
- III. 4. Die Landschaft als Allegorie erweckt Andacht
- III. 5. Das Landschaftsbild als Allegorie und Andachtsmotiv
- III. 5. 1. Abweichungen in der Handschrift
- III. 6. Publikumssatire statt Bildrezension
- III. 6. 1. Abweichung in der Handschrift
- III. 7. Die Auswahl und Umsetzung des Motivs
- III. 8. Zusammenfassung: Brentano/Arnims Deutung der Seelandschaft
- IV. Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft in den Berliner Abendblätter
- IV. 1. Kleists „Geist“ und „Verantwortlichkeit“
- IV. 2. Vergleich der Einleitung Kleists mit der Einleitung in der Iris von 1826
- IV. 2. 1. Abweichungen in der Handschrift
- IV. 3. Pathologische und ästhetische Rührung
- IV. 4. Die Bedeutung des Bildrahmens
- IV. 5. Zur historischen Referenz: Regulus
- IV. 6. „Eine ganz neue Bahn“
- IV. 7. Zusammenfassung: Kleists Deutung der Seelandschaft
- V. Die Konsequenzen
- V. 1. Zur Systematisierung der „Berliner Abendblätter“
- V. 2. Zur Chronologie der Ausstellungsbeiträge in den „Berliner Abendblätter“
- V. 3. Zusammenfassung
- VI. Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und den Verlauf des Konflikts zwischen Heinrich von Kleist, Clemens Brentano und Achim von Arnim, die im Oktober 1810 in einer Kontroverse um eine Rezension des Gemäldes „Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft“ gipfelte. Die Arbeit beleuchtet die Vorgeschichte des Konflikts, die unterschiedlichen Perspektiven der Autoren auf das Gemälde und die Auswirkungen der Kontroverse auf die Berliner Abendblätter.
- Die Entstehung des Konflikts zwischen Kleist, Brentano und Arnim
- Die unterschiedlichen Interpretationen des Gemäldes „Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft“
- Die Auswirkungen der Kontroverse auf die Berliner Abendblätter
- Die Rolle der Kunstkritik in der Frühromantik
- Die Verbindung von Literatur, Kunst und Politik im frühen 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Konflikt zwischen Kleist, Brentano und Arnim vor und gibt einen Überblick über die Forschungsgeschichte des Themas. Kapitel II beleuchtet die Vorgeschichte des Konflikts, beginnend mit der Entstehungsgeschichte des Tetschener Altars, der Rezension Ramdohrs und den Reaktionen auf diese. Kapitel III analysiert Brentano/Arnims Reaktion auf Friedrichs Seelandschaft und die verschiedenen Interpretationen, die sie in ihrem Aufsatz entwickeln. Kapitel IV betrachtet Kleists Deutung der Seelandschaft und die Veränderungen, die er an Brentano/Arnims Text vorgenommen hat. Kapitel V untersucht die Konsequenzen des Konflikts für die Berliner Abendblätter. Die Schlußbemerkung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Caspar David Friedrich, „Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft“, Heinrich von Kleist, Clemens Brentano, Achim von Arnim, Berliner Abendblätter, Kunstkritik, Frühromantik, Tetschener Altar, Ramdohr, Iris, Bildinterpretation, Literatur, Kunst, Politik, 19. Jahrhundert.
- Citar trabajo
- Dinah Helal (Autor), 2006, Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft. Kunstkritische Texte bei Kleist, Brentano, Ramdohr, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343542