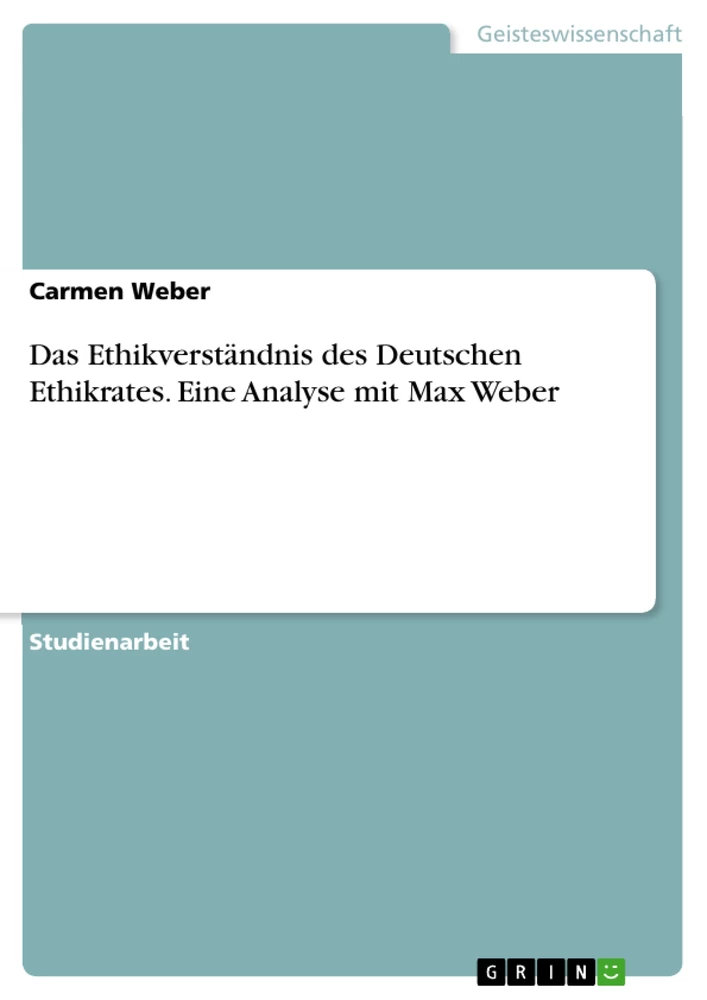Der Deutsche Ethikrat ist nicht nur eine relativ moderne Institution, sondern auch die Antwort auf ein modernes Phänomen. Mit seiner Hilfe soll eine Lösung gefunden werden, wie der permanente wissenschaftliche Fortschritt sich mit der Würde des Menschen vereinbaren lässt. Die Lösungsbemühungen besitzen die Form eines überprüfenden Austausches von Begründbarkeit der unterschiedlichen Positionen.
Max Weber hat sich in seinem Werk ausführlich mit unterschiedlichen Rationalisierungen beschäftigt, im Besonderen mit Rationalisierungen des ethischen Handelns wie des Rechts. Zudem ist bei Weber die Idee der Rationalisierung und der Ethik nicht trennbar von religionssoziologischen Überlegungen. Und diese Problemstellungen sind bei Weber immer auch in die Fragestellung nach der Besonderheit okzidentaler Kulturerscheinungen eingebettet.
Im Folgenden soll einleitend erörtert werden, wie sich das Ethikverständnis des Deutschen Ethikrates mit Webers Methodologie begreifen lassen könnte. Daran anschließend steht zur Frage, ob Webers Konzept der unterschiedlichen Rationalisierungen von Wertsphären einen anschaulichen Überblick über die Positionen und Konstellationen im Ethikrat Aufschluss geben kann. Als nächstes werde ich versuchen Überlegungen anzustellen, ob Webers Konzepte zu einer Gesinnungs- und Verantwortungsethik zu einem besseres Verständnis mancher Dissensproblemen im Ethikrat beitragen könnten. Und weil der Schwerpunkt des Deutschen Ethikrates unter anderem in der Formulierung von Gesetzesvorschlägen liegt, befasse ich mich im Weiteren mit der Frage, ob sich mithilfe von Weber verstehen lässt, was jene Tatsache letztlich für die Vorstellung von Rationalität im Ethikrat bedeutet und inwiefern dadurch der Praxis des Ethikrates Grenzen gesetzt werden.
Zuletzt interessiere ich mich für mögliche Voraussetzungen der Thematiken und Problematiken des Ethikrates, und versuche ihre Entstehung anhand Webers religionssoziologischer Rekonstruktion der Eigenart eines okzidentalen Rationalisierungsprozesses zu verstehen. Denn Weber hat die unterschiedliche Religionen nach der Rationalisierung und Systematisierung ihrer Glaubensinhalte untersucht und die These aufgestellt, dass diese Praktiken zwar heute ihrer nun als irrational empfundenen religiösen Ziele entkleidet wurden, doch selbst immer noch weiter leben und an andere Ziele geknüpft sind, möglicherweise an die Idee des permanenten Fortschrittes und das daran gebundene irrationales Erfolgstreben.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Deutsche Ethikrat.
- 2. Zum Verständnis von Ethik im Deutschen Ethikrat...
- 2.1 Rationalisierungen ethischen Handelns
- 2.2 Ethische Entscheidungsfindung im Deutschen Ethikrat und Webers Überlegungen zur Gesinnungs- und Verantwortungsethik.
- 2.3 Vom ethisch-rationalen Handeln zum Recht
- 3. Systematisierungsversuche zur okzidentalen Ethik als mögliche Voraussetzung des Deutschen Ethikrates....
- 4. Schlussbemerkung…...
- 5. Literaturverzeichnis..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen dem Deutschen Ethikrat und den Theorien von Max Weber. Sie analysiert, inwiefern Webers Ansätze zur Rationalisierung des ethischen Handelns und zur Gesinnungs- und Verantwortungsethik das Verständnis der Funktionsweise und der Herausforderungen des Deutschen Ethikrates verbessern können. Darüber hinaus wird untersucht, ob Webers religionssoziologische Rekonstruktion des Rationalisierungsprozesses Aufschluss über die Entstehung der Themen und Problematiken des Ethikrates geben kann.
- Die Bedeutung des Deutschen Ethikrates als Institution, die den permanenten wissenschaftlichen Fortschritt mit der Würde des Menschen vereinbaren soll
- Die unterschiedlichen Rationalisierungen des ethischen Handelns im Deutschen Ethikrat im Lichte von Max Webers Theorien
- Die Relevanz von Webers Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik für die Analyse von Entscheidungsfindungsprozessen im Ethikrat
- Die Rolle von Rationalität und Recht im Kontext der Arbeit des Ethikrates
- Der Einfluss von Religionssoziologie und okzidentaler Kultur auf die ethischen Fragestellungen des Ethikrates
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Deutschen Ethikrat als eine moderne Institution vor, die sich mit der Herausforderung auseinandersetzt, den wissenschaftlichen Fortschritt mit der Würde des Menschen in Einklang zu bringen. Sie führt Max Weber als Denker ein, dessen Ansätze zur Rationalisierung des ethischen Handelns und zur Religionssoziologie für das Verständnis des Ethikrates relevant sind.
- Der Deutsche Ethikrat: Dieses Kapitel beschreibt die institutionelle Einordnung des Deutschen Ethikrates, seine Aufgaben und seine Zusammensetzung. Es beleuchtet die Geschichte des Ethikrates und seine Entwicklung von einer Arbeitsgruppe zu einem unabhängigen Sachverständigenrat.
- Zum Verständnis von Ethik im Deutschen Ethikrat: Dieses Kapitel diskutiert die spezifische Bedeutung des Begriffs „Ethik“ innerhalb der Praxis des Deutschen Ethikrates. Es wird Weber als Ausgangspunkt für eine soziologische Begriffsbestimmung herangezogen und die Frage gestellt, ob Webers Konzept der unterschiedlichen Rationalisierungen von Wertsphären einen Einblick in die Positionen und Konstellationen im Ethikrat bieten kann.
Schlüsselwörter
Deutscher Ethikrat, Max Weber, Rationalisierung, ethisches Handeln, Gesinnungs- und Verantwortungsethik, Religionssoziologie, okzidentale Kultur, wissenschaftlicher Fortschritt, Würde des Menschen, Entscheidungsfindung, Recht, Gesetzesvorschläge
- Arbeit zitieren
- Carmen Weber (Autor:in), 2009, Das Ethikverständnis des Deutschen Ethikrates. Eine Analyse mit Max Weber, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343816