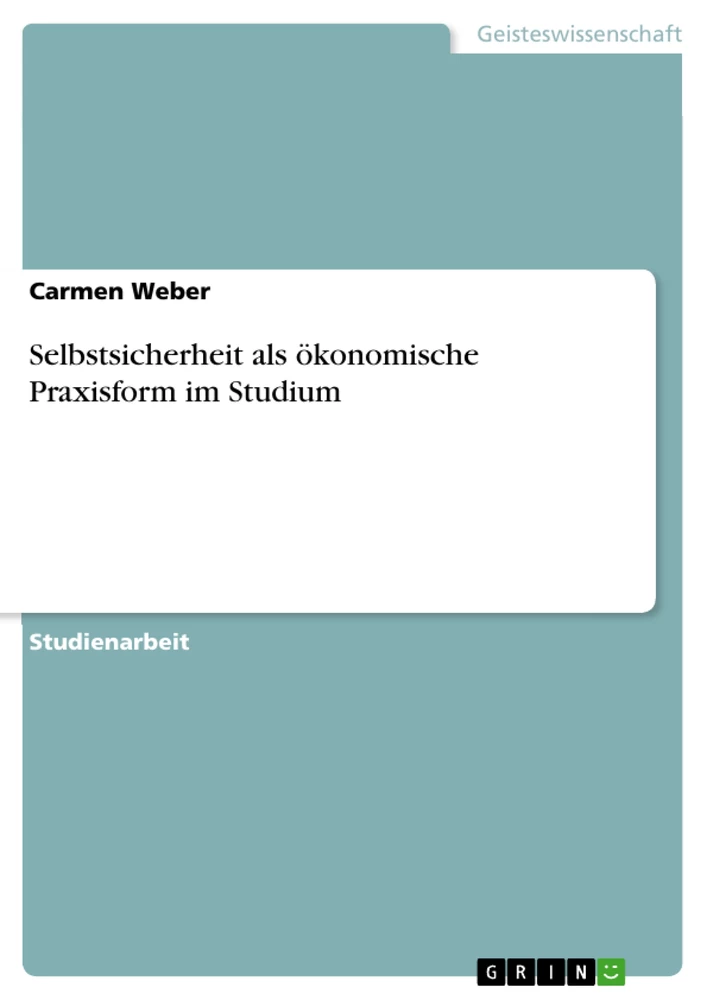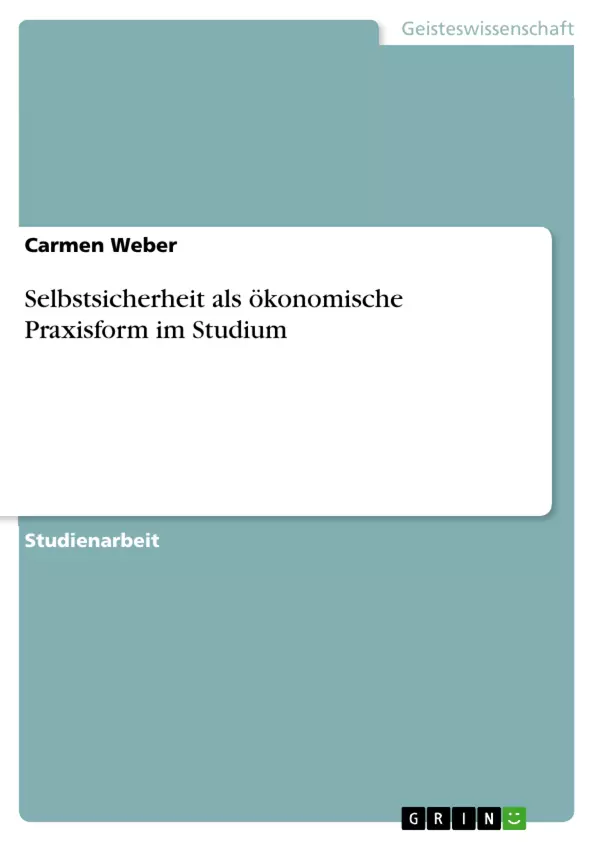Für die Bewältigung eines Studiums spielt das Ausmaß an studienbezogener Selbstsicherheit der Studierenden eine bedeutende Rolle. Sie müssen sich also zuerst mit ausreichend persönlicher Sicherheit für ein Studium entscheiden, wobei bereits eine große Selbstselektion stattfindet. Anschließend benötigen sie wieder ausreichend Selbstsicherheit um den Anforderungen wie dem Studienalltag ohne größere Schwierigkeiten zu überstehen. Und nicht zuletzt müssen sie ein erfolgreich abgeschlossenes Studium selbstsicher im Arbeitsmarkt präsentieren.
Für die studienbezogene Selbstsicherheit spielt unter anderem die persönliche Selbstsicherheit, also die allgemeine Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten eine Rolle. Und von diesen Fähigkeiten ebenso wie von deren subjektiver Einschätzung sollte man meinen, sie wären in allen gesellschaftlichen Schichten und Gruppen relativ gleich verteilt wiederzufinden. Wenn dies aber nicht der Fall ist, wenn vor allem die Sicherheit vorwiegend bei den höheren Schichten der Gesellschaft vertreten ist, dann stellt sich unumgänglich die Frage, ob die Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit nach der gesellschaftlichen Schicht variiert.
Studienbezogene Unsicherheit im universitären Bildungssystem lässt sich unter anderem auf Unvertrautheit mit der universitären Welt zurückführen. Schließlich handelt es bei der Universität um eine gesellschaftliche Bildungsinstitution, zu dem nur ein relativ geringer Teil der Bevölkerung Zugang hat. Und dieser kleine Teil setzt sich trotz Bildungsexpansion größtenteils aus Personen zusammen, deren Eltern ebenfalls zu dieser privilegierten Gruppe gehören. So haben 2005 in Baden-Württemberg „die meisten Studierenden ein „akademisches Elternhaus“ (59 %)“. Ein halbes Jahrhundert zuvor bemerkte Ralf Dahrendorf noch nachdrücklich, dass sich „aus den nach Einkommen, Prestige, Einfluss und Ausbildung oberen 1% [der Gesellschaft] [...] nicht viel weniger als ein Viertel aller Universitätsstudenten“ rekrutieren. Die soziale Ungleichheit bei den Chancen für ein Hochschulstudium haben sich somit noch verstärkt.
Es handelt sich dabei um eine vom leistungsorientierten Bildungssystem offiziell nicht beabsichtigte Übertragung der gesellschaftlichen Position der Eltern auf ihre Nachkommen. Nach Pierre Bourdieu findet über die Vererbung von im Bildungssystem ökonomisch verwertbaren Kapitalien wie Sprachcode, Geschmack und kulturelle Praktiken eine Reproduktion der sozialen Unterschiede statt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Theorie....
- Forschungsfragen, Variablen und Hypothesen......
- Die Datengrundlage.
- Ergebnisse und Interpretationen.....
- Schlussbemerkung.
- Literatur.......
- Anhang.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht, wie sich studienbezogene Selbstsicherheit als ökonomische Praxisform im Studium manifestiert und welche Rolle soziale Ungleichheit dabei spielt.
- Die Bedeutung von studienbezogener Selbstsicherheit für den Studienerfolg.
- Die Rolle des sozialen Kapitals nach Pierre Bourdieu für die Entwicklung von Selbstsicherheit.
- Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und studienbezogener Selbstsicherheit.
- Die Frage, ob Bildungsaufsteiger aus sozial benachteiligten Schichten hochkulturelles Kapital anhäufen können.
- Die Relevanz von institutionalisierten Kulturkapital im Kontext sozialer Ungleichheit.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt den Fokus auf die Bedeutung von studienbezogener Selbstsicherheit für den Studienerfolg und die Frage, ob diese Sicherheit in allen gesellschaftlichen Schichten gleich verteilt ist. Sie beleuchtet die soziale Ungleichheit im Bildungssystem und führt Pierre Bourdieus Theorie der Kapitalformen ein.
Das Kapitel "Theorie" vertieft Bourdieus Konzepte des sozialen Kapitals und der verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital). Es wird argumentiert, dass studiumsbezogene Selbstsicherheit Teil des sozialen Kapitals ist und dass die ungleiche Verteilung von Kapitalien zu ungleichen Machtverhältnissen führt.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Selbstsicherheit für den Studienerfolg?
Studienbezogene Selbstsicherheit ist entscheidend für die Entscheidung zum Studium, die Bewältigung des Alltags und die spätere Präsentation am Arbeitsmarkt.
Wie hängen soziale Herkunft und Selbstsicherheit zusammen?
Die Arbeit untersucht, ob Selbstsicherheit vorwiegend bei höheren sozialen Schichten vertreten ist und wie Bildungsbarrieren Unsicherheit erzeugen.
Was ist Bourdieus Theorie der Kapitalformen?
Pierre Bourdieu unterscheidet zwischen ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital. Diese werden vererbt und reproduzieren soziale Ungleichheit im Bildungssystem.
Was versteht man unter „institutionalisiertem Kulturkapital“?
Dazu gehören Bildungstitel und Abschlüsse, die im System als Währung fungieren, aber oft denjenigen leichter zugänglich sind, die bereits kulturelles Kapital mitbringen.
Warum haben Kinder aus Akademikerhaushalten Vorteile?
Sie sind oft vertrauter mit dem „Sprachcode“ und den kulturellen Praktiken der Universität, was zu einer höheren studienbezogenen Selbstsicherheit führt.
- Quote paper
- Carmen Weber (Author), 2011, Selbstsicherheit als ökonomische Praxisform im Studium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343818