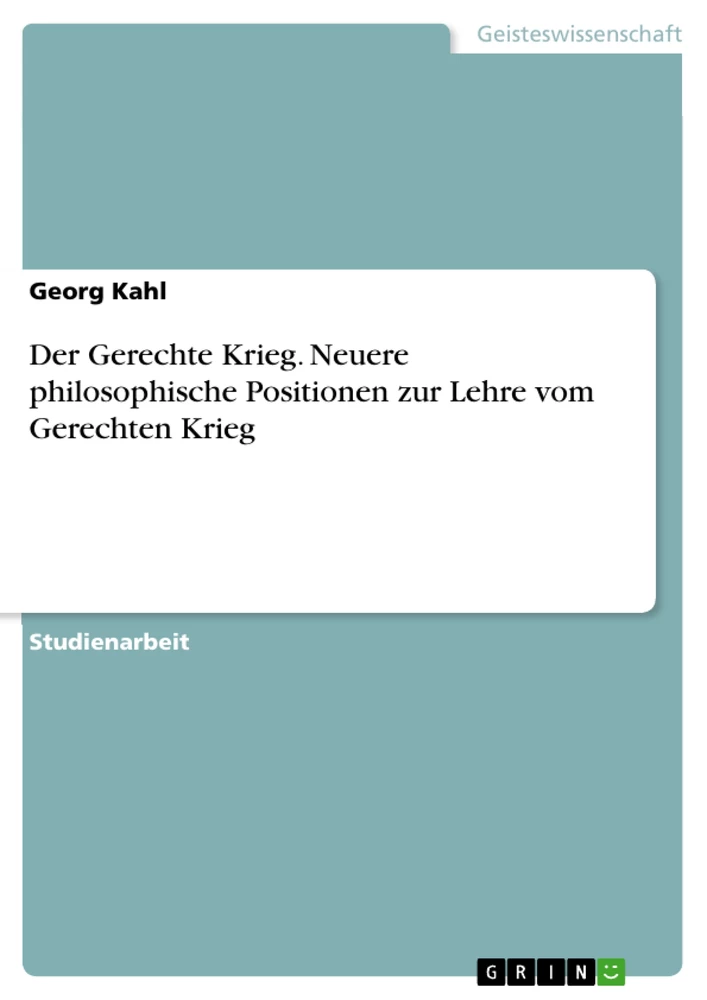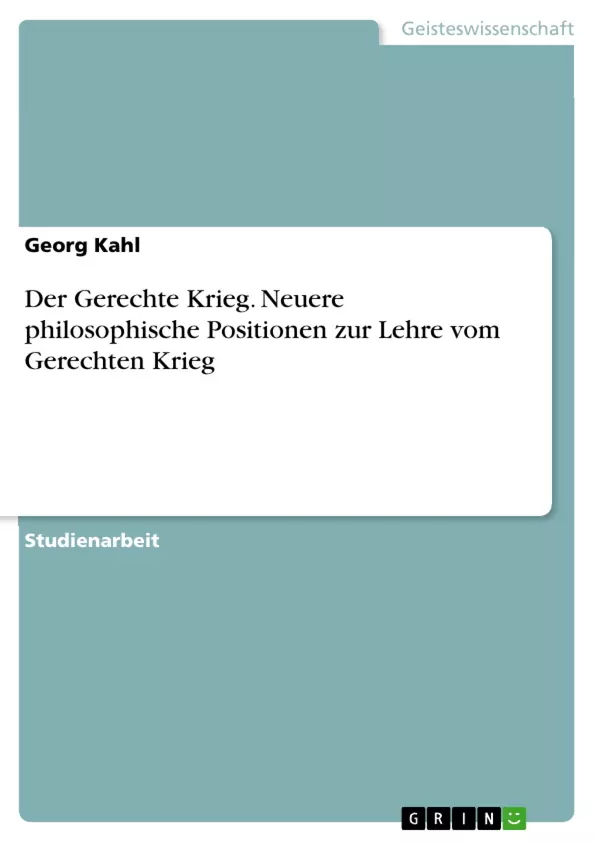Gewaltsame Konflikte und Kriege begleiten die menschliche Zivilisation seit ihrem Bestehen. Ob politische Auseinandersetzungen zwischen Staaten, der Kampf um Macht zwischen zwei Organisationen innerhalb eines Staates oder auch Kriege zwischen einer kriminellen Organisation und der Regierung, die nicht aus ideologischen oder politischen Motiven geführt werden, sind in unserer heutigen Zeit weit verbreitet. Die Anzahl der Kriege ist in diesem Jahr leicht von 20 auf 21 gestiegen. Allerdings betreffen diese Kriege immer mehr Länder wie beispielsweise der vom IS geführte Krieg, der sich von Irak über Syrien bis in den Libanon erstreckt. Zu den 21 Kriegen kommen weltweit noch 424 politische Konflikte dazu.
Doch was sind die Motive um einen Krieg zu führen? Die meisten dieser Konflikte werden aus machtpolitischen oder ideologischen Gründen geführt. Können diese Motive einen Krieg rechtfertigen? Gibt es einen gerechten Krieg? Die christliche Friedensethik stellt sich diese Frage seit Jahrhunderten und beschäftigt sich intensiv mit der Lehre vom gerechten Krieg. Gerade in Zeiten von humanitären Interventionen durch die UN oder die NATO wird die Debatte über die Lehre vom gerechten Krieg wieder angeheizt.
Ich möchte mich im Rahmen dieser Hausarbeit mit der Entwicklung der Theorie vom gerechten Krieg innerhalb der christlichen Friedensethik beschäftigen. Dazu werde ich zunächst die Entwicklung dieser Lehre aufzeigen. Anschließend betrachte ich die heutigen Kriterien für einen gerechten Krieg und verdeutliche unterschiedliche Positionen und Interpretationsmöglichkeiten in Bezug auf militärische und humanitäre Interventionen. Zum Abschluss fasse ich meine Ergebnisse zusammen und erkläre, inwieweit die humanitären Interventionen gerechtfertigt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung des gerechten Krieges
- Biblische Ansicht
- Entwicklung der Lehre vom gerechten Krieg
- Kriterien des gerechten Krieges in der Gegenwart
- Der gerechte Grund
- Die legitime Autorität
- Die aufrechte Absicht
- Ultima ratio
- Aussicht auf Erfolg
- Verhältnismäßigkeit
- Kombattanten und Nicht-Kombattanten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Theorie des gerechten Krieges innerhalb der christlichen Friedensethik. Sie verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung dieser Lehre aufzuzeigen und die heutigen Kriterien für einen gerechten Krieg zu beleuchten. Dabei werden unterschiedliche Positionen und Interpretationsmöglichkeiten im Kontext militärischer und humanitärer Interventionen berücksichtigt.
- Die historische Entwicklung der Lehre vom gerechten Krieg
- Die biblische Perspektive auf Frieden und Krieg
- Die Kriterien für einen gerechten Krieg in der Gegenwart
- Die Anwendung der Lehre auf humanitäre Interventionen
- Die Herausforderung der Gewalt im menschlichen Leben und der Weg zum Frieden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext gewaltsamer Konflikte in der heutigen Welt und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rechtfertigung von Kriegen im Lichte der christlichen Friedensethik. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die historische Entwicklung der Lehre vom gerechten Krieg und deren Anwendung auf aktuelle Debatten um humanitäre Interventionen umfasst. Die Einleitung verortet die Arbeit in der aktuellen politischen und ethischen Diskussion um Krieg und Frieden und betont die Relevanz der Fragestellung.
Entwicklung des gerechten Krieges: Dieses Kapitel analysiert die biblische Sicht auf Frieden und Krieg, indem es die Ambivalenz des Verhältnisses von Gewalt und Frieden in der Bibel beleuchtet und die Schwierigkeit einer direkten Übertragung biblischer Aussagen auf die heutige Zeit herausstellt. Es zeigt die unterschiedlichen Interpretationen von Kriegsstellen im Alten Testament und diskutiert deren Verwendung in kriegerischen Kontexten. Der Abschnitt betont die Notwendigkeit, die Neigung des Menschen zu Gewalt offen anzusprechen, ohne jedoch in eine pazifistische Utopie zu verfallen. Die Bedeutung des "Schwerter zu Pflugscharren"-Motivs im Kontext der Hoffnung auf Frieden wird ebenfalls diskutiert, ebenso wie die Interpretation des "Du sollst nicht töten"-Gebots im Kontext von Mord und Tötung.
Schlüsselwörter
Gerechter Krieg, Friedensethik, Christliche Theologie, Gewalt, Frieden, Humanitäre Intervention, Bibel, Kriegstheorie, Militärische Intervention, Pazifismus, Feindesliebe.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Entwicklung des gerechten Krieges"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und die Kriterien des gerechten Krieges im Kontext christlicher Friedensethik. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Text analysiert die historische Entwicklung der Lehre vom gerechten Krieg, beginnend mit der biblischen Perspektive und gefolgt von einer Betrachtung der heutigen Kriterien für einen gerechten Krieg. Besondere Aufmerksamkeit wird der Anwendung der Lehre auf humanitäre Interventionen gewidmet.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind die historische Entwicklung der Lehre vom gerechten Krieg, die biblische Sicht auf Krieg und Frieden, die Kriterien eines gerechten Krieges (gerechter Grund, legitime Autorität, aufrechte Absicht, Ultima Ratio, Aussicht auf Erfolg, Verhältnismäßigkeit, Kombattanten und Nicht-Kombattanten), die Anwendung der Lehre auf humanitäre Interventionen und die Herausforderung der Gewalt im menschlichen Leben.
Wie wird die biblische Perspektive auf Krieg und Frieden dargestellt?
Der Text beleuchtet die Ambivalenz des Verhältnisses von Gewalt und Frieden in der Bibel und die Schwierigkeiten, biblische Aussagen direkt auf die heutige Zeit zu übertragen. Er diskutiert unterschiedliche Interpretationen von Kriegsstellen im Alten Testament und deren Verwendung in kriegerischen Kontexten. Die Bedeutung des „Schwerter zu Pflugscharren“-Motivs und die Interpretation des „Du sollst nicht töten“-Gebots werden ebenfalls thematisiert.
Welche Kriterien werden für einen gerechten Krieg in der Gegenwart genannt?
Der Text nennt folgende Kriterien für einen gerechten Krieg in der Gegenwart: gerechter Grund, legitime Autorität, aufrechte Absicht, Ultima Ratio (letztes Mittel), Aussicht auf Erfolg, Verhältnismäßigkeit und die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten.
Welche Rolle spielen humanitäre Interventionen im Text?
Humanitäre Interventionen werden als wichtiger Anwendungsbereich der Lehre vom gerechten Krieg betrachtet. Der Text untersucht, wie die Kriterien des gerechten Krieges auf solche Interventionen angewendet werden können und welche Herausforderungen sich dabei stellen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Gerechter Krieg, Friedensethik, Christliche Theologie, Gewalt, Frieden, Humanitäre Intervention, Bibel, Kriegstheorie, Militärische Intervention, Pazifismus, Feindesliebe.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Der Text hat zum Ziel, die historische Entwicklung der Theorie des gerechten Krieges innerhalb der christlichen Friedensethik aufzuzeigen und die heutigen Kriterien für einen gerechten Krieg zu beleuchten. Dabei werden unterschiedliche Positionen und Interpretationsmöglichkeiten im Kontext militärischer und humanitärer Interventionen berücksichtigt.
An wen richtet sich dieser Text?
Der Text richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit Fragen der Friedensethik, der christlichen Theologie und der Theorie des gerechten Krieges auseinandersetzt. Die Sprache und der Aufbau sind auf ein wissenschaftliches Verständnis ausgerichtet.
- Quote paper
- Georg Kahl (Author), 2015, Der Gerechte Krieg. Neuere philosophische Positionen zur Lehre vom Gerechten Krieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343866