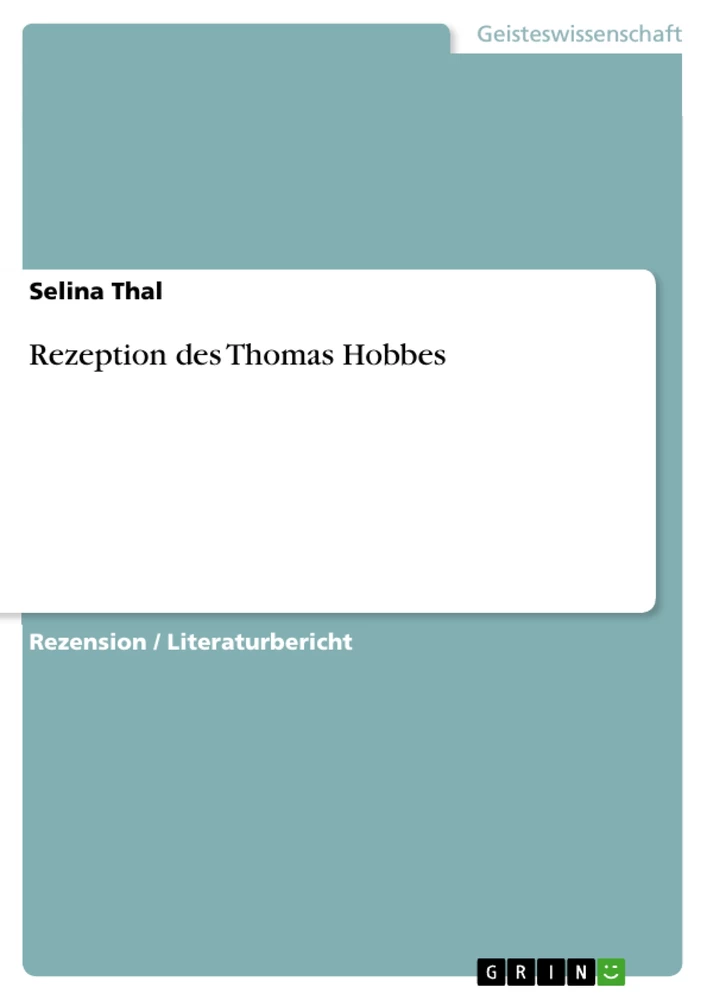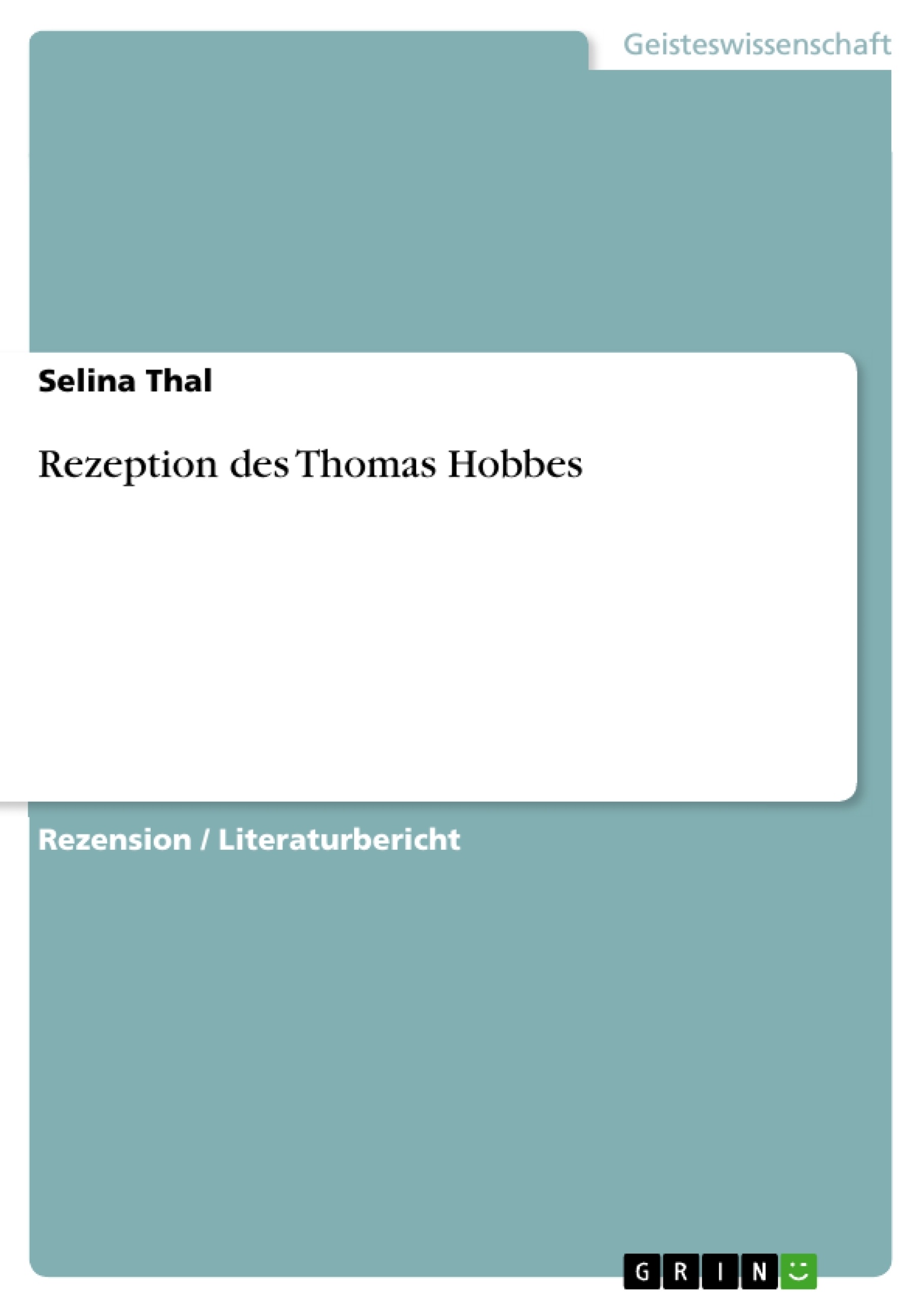Warum gelang es dem Hobbesschen Ansatz sogar bis in die zeitgenössische politische Philosophie des Liberalismus vorzudringen?
Thomas Hobbes konstruierte seinen absolutistischen Staat im Leviathan unter Verwendung eines zutiefst liberalen Hilfsmittels: der Vertragstheorie. Dieser dem Werk immanente Gegensatz ist auch der Grund für die ambivalente Rezeptionsgeschichte. Wolfgang Kersting unterscheidet in diesem Kontext zwischen der „weißen“ und „schwarzen“ Hobbes-Rezeption. Die „weiße“ Hobbes-Rezeption verkörpert dabei das kontraktualistische Argument, die „schwarze“ Rezeption hingegen, das Souveränitäts- bzw. Letztinstanzlichkeitsargument.
Inhaltsverzeichnis
- Rezeption des Thomas Hobbes
- Die "weiße" Hobbes-Rezeption
- Die "schwarze" Hobbes-Rezeption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rezeption des Werkes von Thomas Hobbes, insbesondere mit dem Gegensatz zwischen der liberalen Grundlage seiner Vertragstheorie und den daraus resultierenden antiliberalen Konsequenzen. Die Arbeit analysiert die "weiße" und die "schwarze" Hobbes-Rezeption, die unterschiedliche Interpretationen des Hobbesschen Staates bieten.
- Die "weiße" Hobbes-Rezeption und der philosophische Liberalismus
- Die "schwarze" Hobbes-Rezeption und die Kritik am Kontraktualismus
- Der Hobbessche Staat und die Frage der Herrschaftslegitimation
- Der Einfluss des Hobbesschen Denkens auf die zeitgenössische politische Philosophie
- Die Ambivalenz der Hobbesschen Theorie und ihre Relevanz für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit untersucht die "weiße" Hobbes-Rezeption, die das kontraktualistische Argument in den Vordergrund stellt und Hobbes' Werk mit dem philosophischen Liberalismus in Verbindung bringt. Dieser Abschnitt analysiert die Entwicklung des liberalen Denkens von Locke und Kant bis hin zu John Rawls und anderen zeitgenössischen Denkern.
Im zweiten Teil der Arbeit wird die "schwarze" Hobbes-Rezeption beleuchtet, die das Souveränitätsargument in den Vordergrund stellt und Hobbes' Werk als antiliberal interpretiert. Dieser Abschnitt analysiert die Kritik von Carl Schmitt am Hobbesschen Staat und zeigt die Ambivalenz des Hobbesschen Denkens auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Vertragstheorie, Liberalismus, Souveränität, Herrschaftslegitimation, "weiße" und "schwarze" Hobbes-Rezeption, Carl Schmitt, John Rawls, und den Hobbesschen Staat.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das Werk von Thomas Hobbes heute noch relevant?
Hobbes' Ansatz der Vertragstheorie bildet eine fundamentale Grundlage für die moderne politische Philosophie und den Liberalismus.
Was unterscheidet die "weiße" von der "schwarzen" Hobbes-Rezeption?
Die "weiße" Rezeption betont das liberale kontraktualistische Argument, während die "schwarze" Rezeption das Souveränitäts- und Letztinstanzlichkeitsargument hervorhebt.
Wie hängen Hobbes und der philosophische Liberalismus zusammen?
Obwohl Hobbes einen absolutistischen Staat (Leviathan) entwarf, nutzte er das zutiefst liberale Hilfsmittel des Gesellschaftsvertrags zur Begründung von Herrschaft.
Welche Kritik äußerte Carl Schmitt an Hobbes?
Schmitt konzentriert sich auf das Souveränitätsargument und interpretiert Hobbes' Theorie als Gegenentwurf zum liberalen Parlamentarismus.
Was bedeutet "Kontraktualismus" im Kontext von Hobbes?
Es ist die Theorie, dass die Legitimität staatlicher Herrschaft auf einem (fiktiven) Vertrag beruht, den freie Individuen untereinander schließen.
- Arbeit zitieren
- Selina Thal (Autor:in), 2008, Rezeption des Thomas Hobbes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343914