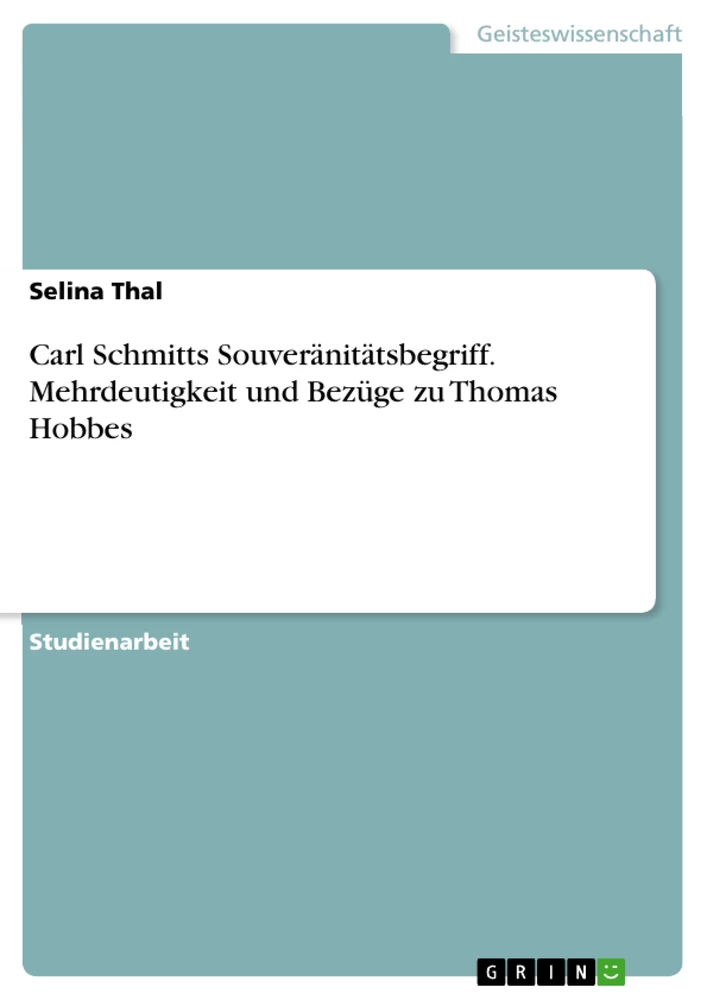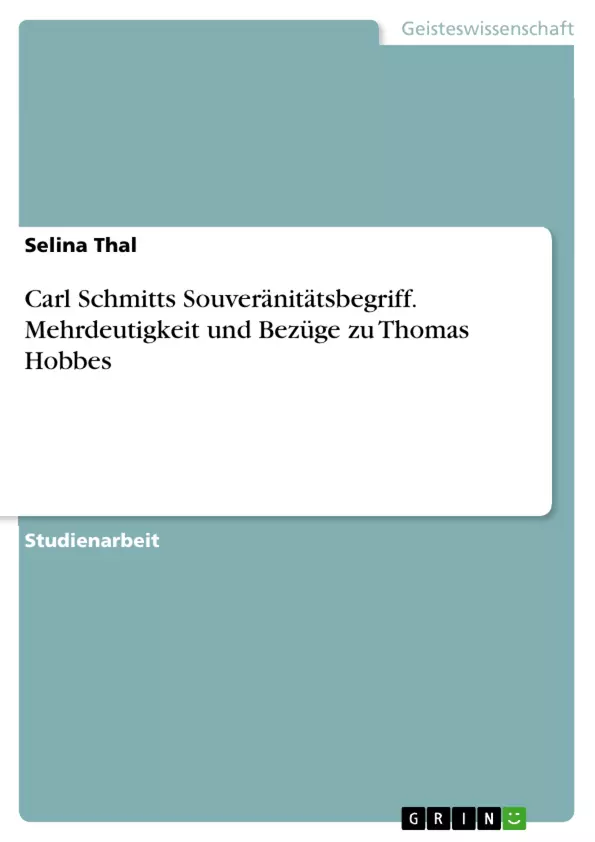Carl Schmitt war einer der umstrittensten und gleichzeitig einer der wirkungsvollsten Vertreter der deutschen Staatstheorie zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Seine Definition von Souveränität war und bleibt auch heute noch Gegenstand heftiger Kontroversen. Die einen sehen in ihm den Kronjuristen des Dritten Reichs und die anderen nutzen seine Souveränitätsdefinition dafür, die asymmetrischen Machtverhältnisse von Wirtschaft und Politik in der „modernen“ globalisierten Welt anzuprangern.
Warum vermag Schmitts Souveränitätsbegriff so kontroverse Meinungen hervorzubringen? Schon bei Thomas Hobbes, zu dem sich Carl Schmitt ideengeschichtlich verbunden fühlte, schieden und scheiden sich die Geister. Dabei lässt sich die ambivalente Rezeption des Hobbesschen Werkes durch den Gegensatz von liberaler theoretischer Basis und den daraus erwachsenen antiliberalen Konsequenzen erklären. Schmitt gilt dabei als ein Vertreter der „schwarzen“ Hobbes-Interpretation, weil er seinen Fokus auf das Letztinstanzlichkeitsargument legt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der legitimen Souveränität zur Souveränität als Entscheidungsakt
- Souveränität nach Hobbes und Schmitt- ein Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht den Souveränitätsbegriff bei Carl Schmitt und beleuchtet seine Bezüge zu Thomas Hobbes. Sie analysiert Schmitts Werk „Politische Theorie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität“ und untersucht, wie sich seine Vorstellung von Souveränität von der Hobbesschen unterscheidet.
- Schmitts Soziologie der Begriffe und ihre Anwendung auf den Souveränitätsbegriff
- Die Rolle der politischen Theologie in Schmitts Souveränitätskonzeption
- Der Wandel vom theistischen zum rationalen Denken und seine Auswirkungen auf den Souveränitätsbegriff
- Die Unterscheidung zwischen legitimer Souveränität und Souveränität als Entscheidungsakt
- Schmitts Kritik an Hobbes' Legitimationsanspruch und seine eigene dezisionistische Sichtweise
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt Carl Schmitt und seinen Souveränitätsbegriff in den Kontext der deutschen Staatstheorie des 20. Jahrhunderts. Sie zeigt die Relevanz des Themas auf und skizziert die methodischen und inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit.
- Von der legitimen Souveränität zur Souveränität als Entscheidungsakt: Dieses Kapitel analysiert Schmitts „Soziologie der Begriffe“ und untersucht, wie er den Souveränitätsbegriff im Kontext der politischen Theologie und der Entwicklung vom theistischen zum rationalen Denken begreift. Es stellt die Frage, wie sich der Souveränitätsbegriff im Laufe der Geschichte gewandelt hat und welchen Einfluss die jeweilige Metaphysik auf die Konzeption des Souveräns hat.
- Souveränität nach Hobbes und Schmitt- ein Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Souveränitätskonzeptionen von Thomas Hobbes und Carl Schmitt. Es untersucht, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Denkern bestehen und wie Schmitts Konzept von Souveränität auf Hobbes' Werk aufbaut und es gleichzeitig transzendiert.
Schlüsselwörter
Souveränität, Carl Schmitt, Thomas Hobbes, Politische Theologie, Dezisionismus, Legitimität, Entscheidungsakt, Soziologie der Begriffe, Metaphysik, Rationalismus, Theismus, Rechtsordnung, Ausnahmezustand, Leviathan.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Carl Schmitts Souveränitätsbegriff?
Souverän ist nach Schmitt, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Es geht um die Letztinstanzlichkeit und den reinen Entscheidungsakt.
Wie hängen Thomas Hobbes und Carl Schmitt zusammen?
Schmitt bezieht sich stark auf Hobbes' Letztinstanzlichkeitsargument, lehnt jedoch dessen liberalen Legitimationsansatz ab und vertritt eine „schwarze“ Hobbes-Interpretation.
Was bedeutet „Politische Theologie“ bei Schmitt?
Schmitt argumentiert, dass alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre säkularisierte theologische Begriffe sind (z.B. der allmächtige Gott wird zum souveränen Gesetzgeber).
Warum ist Schmitts Souveränitätsdefinition heute noch umstritten?
Sie wird einerseits als Wegbereiter für autoritäre Systeme kritisiert, andererseits genutzt, um asymmetrische Machtverhältnisse in der globalisierten Welt zu analysieren.
Was ist der Unterschied zwischen legitimem Recht und Dezisionismus?
Dezisionismus betont die Entscheidung an sich als Rechtsquelle, unabhängig von ihrem Inhalt oder einer vorherigen Norm, während legitimes Recht auf einer bestehenden Ordnung basiert.
- Quote paper
- Selina Thal (Author), 2010, Carl Schmitts Souveränitätsbegriff. Mehrdeutigkeit und Bezüge zu Thomas Hobbes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343953