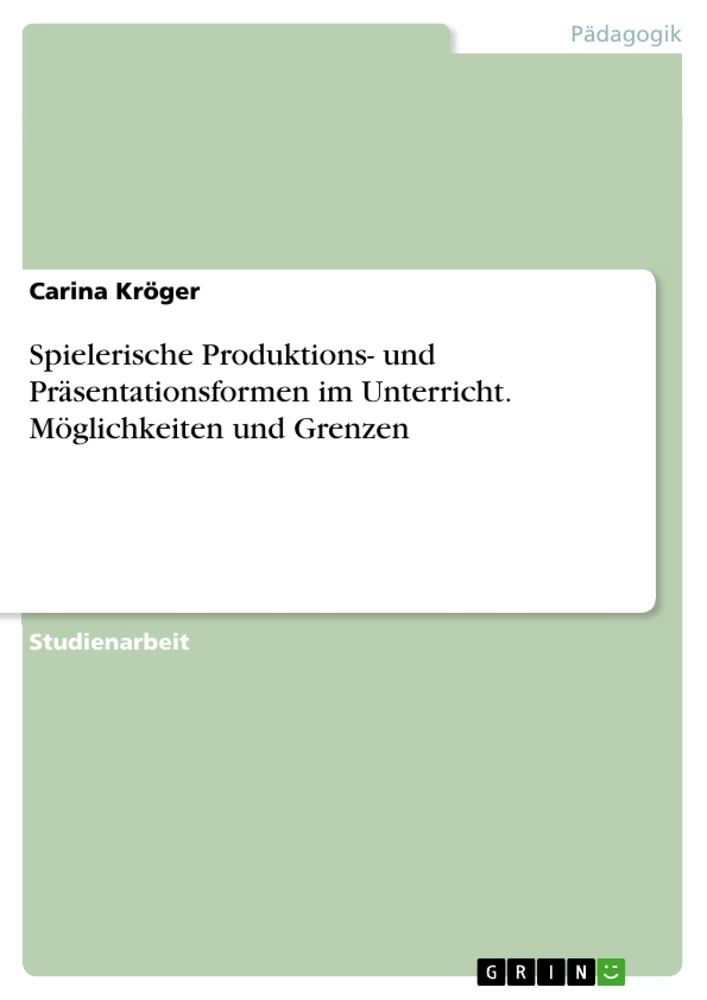Spiele beschäftigen uns durch unser ganzes Leben hindurch aktiv oder passiv, denn Spiele sind spannend, unvorhersehbar und unterhalten uns, ganz gleich welcher Kultur wir entstammen oder in welcher Lebensphase wir uns befinden.
Die folgende Arbeit wird sich mit der Fragestellung beschäftigen, inwieweit „Spielerische Präsentations- und Produktionsformen“ für den Unterricht geeignet sind und wo die Grenzen dieser Lernform liegen. Die Arbeit lässt sich in zwei Bereiche aufteilen; zum einen die theoretische Rahmenerläuterung des Spiels und zum anderen die Fokussierung auf eine spezielle Art der spielerischen Lernformen: die spielerischen Produktions- und Präsentationsformen. Die oben erwähnte Fragestellung baut auf eine Definition des Spielbegriffs auf, die im ersten Kapitel dieser Arbeit eingegangen wird. Nach der Beschreibung verschiedener Merkmale des Spielbegriffs wird eine mögliche Einteilung des Spielbegriffs in Lernspiele und Freie Spiele vorgestellt. Wichtig für die unterrichtliche Nutzbarmachung von spielerischen Lernformen ist die Klärung des Zusammenhangs zwischen Spielen und Lernen, die im zweiten Kapitel vorgenommen wird. Hier spielen besonders die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen spielerischen Lernens und die Ziele der spielerischen Lernformen eine Rolle.
Der zweite Teil meiner Arbeit ist in den Kapiteln drei und vier zu finden, welche sich thematisch mit einer Unterkategorie der spielerischen Lernformen beschäftigen: den spielerischen Produktions- und Präsentationsformen. Dieser Spieltyp war das Thema unserer Gruppenpräsentation im Seminar. Aus diesem Grunde werde ich nicht nur auf die Definition dieser Spielform eingehen, sondern auch die von unserer Gruppe durchgeführte Planung und anschließende praktische Umsetzung im Seminar beschreiben. Zum Abschluss werde ich der Frage nachgehen, ob und inwieweit diese Art der spielerischen Lernformen für den Unterricht geeignet ist und welchen Nutzen man aus ihr ziehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung.
- 1 Der Spielbegriff
- 1.1 Merkmale von Spielen.
- 1.2 Spielformen.
- 2 Spielerisches Lernen
- 2.1 Zusammenhänge zwischen Lernen und Spielen.
- 2.2 Voraussetzungen und Bedingungen spielerischen Lernens.
- 3 Spielerische Produktions- und Präsentationsformen
- 3.1 Definition und Erklärung
- 3.1.1 Produktion.
- 3.1.2 Präsentation.
- 3.2 Planungen und Durchführung der Seminarsitzung am 05.02.2008.
- 3.1 Definition und Erklärung
- 4 Resümee: Anwendung dieses Spieltyps auf die Schule
- 4.1 Was wird gefördert? - Spieldidaktische Reflexion.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern „Spielerische Präsentations- und Produktionsformen“ für den Unterricht geeignet sind und wo die Grenzen dieser Lernform liegen. Sie untersucht den Spielbegriff, die Zusammenhänge zwischen Spielen und Lernen sowie die spezifischen Eigenschaften von spielerischen Produktions- und Präsentationsformen.
- Definition des Spielbegriffs und seiner Merkmale
- Zusammenhänge zwischen Spielen und Lernen
- Voraussetzungen und Bedingungen spielerischen Lernens
- Spielerische Produktions- und Präsentationsformen
- Anwendbarkeit dieser Spielformen im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Das erste Kapitel widmet sich dem Spielbegriff und untersucht seine Merkmale sowie verschiedene Spielformen. Das zweite Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Lernen und Spielen und analysiert die Voraussetzungen und Bedingungen spielerischen Lernens. Im dritten Kapitel werden spielerische Produktions- und Präsentationsformen definiert und die Planung und Durchführung einer konkreten Seminarsitzung mit diesem Spieltyp beschrieben. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Anwendung dieser Spielform im Unterricht und reflektiert ihre didaktischen Potenziale.
Schlüsselwörter
Spielerisches Lernen, Spielbegriff, Produktions- und Präsentationsformen, Didaktik, Unterricht, Lernformen, Spielformen, Spieldidaktik, Seminar, Präsentation, Produktion
Häufig gestellte Fragen
Sind spielerische Lernformen für den Unterricht geeignet?
Ja, die Arbeit untersucht, wie spielerische Ansätze Motivation fördern können, weist aber auch auf die methodischen Grenzen dieser Lernform hin.
Was sind "spielerische Produktions- und Präsentationsformen"?
Es handelt sich um eine Unterkategorie des spielerischen Lernens, bei der Schüler aktiv Inhalte produzieren und diese kreativ im Klassenverband präsentieren.
Was ist der Unterschied zwischen Lernspielen und freien Spielen?
Lernspiele sind zweckgebunden und folgen didaktischen Zielen, während freie Spiele dem Selbstzweck dienen und keinen vorgegebenen Lernergebnissen unterliegen.
Was wird durch diese Spieltypen didaktisch gefördert?
Gefördert werden insbesondere die soziale Kompetenz, die Kreativität, das Sprachvermögen sowie die Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Welche Voraussetzungen müssen für spielerisches Lernen erfüllt sein?
Es bedarf klarer Rahmenbedingungen, einer fehlerfreundlichen Atmosphäre und einer engen Verknüpfung zwischen den Spielregeln und den Lerninhalten.
- Quote paper
- Carina Kröger (Author), 2008, Spielerische Produktions- und Präsentationsformen im Unterricht. Möglichkeiten und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344370