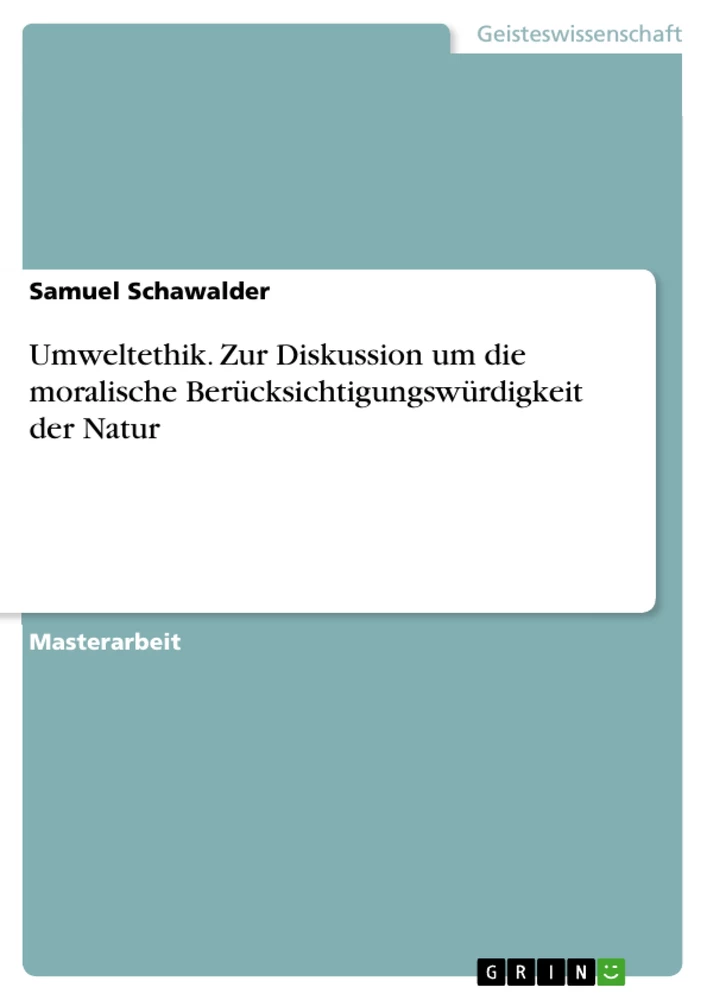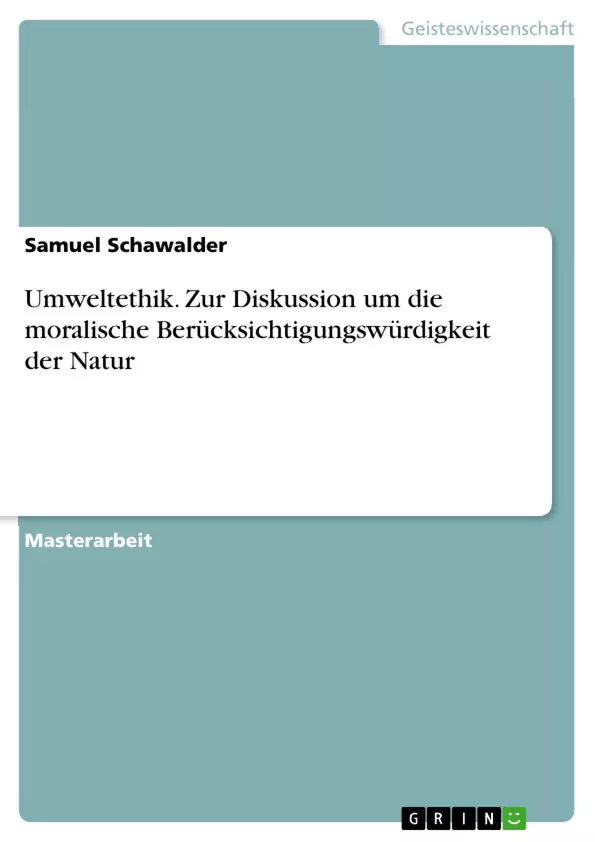Angesichts des Verlusts von zahlreichen Pflanzen- und Tierarten, des Klimawandels, den Exzessen in der modernen Massentierhaltung, der Zerstörung des Regenwaldes und vieler weiterer solcher Beispiele wird unweigerlich klar, dass beim Umgang des Menschen mit seiner natürlichen Umgebung etwas grundlegend falsch läuft. Viele Menschen finden es dann auch falsch, dass wir grosse Teile der Natur verschmutzen oder gar zerstören. Doch wieso genau ist dies falsch? Ist es falsch, weil die Natur und ihre Bewohner die Grundlage unserer Existenz sichern und wir damit quasi den Ast absägen, auf dem wir selbst sitzen1? Oder ist es falsch, weil die Natur und ihre Bewohner oder zumindest Teile davon moralisch um ihrer selbst willen zu berücksichtigen sind?
Die hier vorgelegte Arbeit spricht sich dafür aus, dass der Umgang des Menschen mit seiner natürlichen Umgebung primär nicht deshalb falsch ist, weil wir uns Menschen damit selbst schaden, sondern weil wir damit die moralische Berücksichtigungswürdigkeit der Natur oder zumindest Teile davon missachten. Die Natur oder zumindest Teile davon sind um ihrer selbst willen zu berücksichtigen.
Die Diskussion um die moralische Berücksichtigungswürdigkeit der Natur findet auf zwei Ebenen statt. Zum einen stellt sich auf der ersten Ebene die Frage: Welche Entitäten sind um ihrer selbst willen moralisch zu berücksichtigen? Zum anderen stellt sich auf der zweiten Ebene die Frage: Kommt allen Entitäten, die moralisch um ihrer selbst willen berücksichtigt werden, diese moralische Berücksichtigungswürdigkeit in gleicher Weise zu? Mit anderen Worten wird die Frage der moralischen Relevanz von der Frage der moralischen Signifikanz unterschieden. Die hier vorliegende Arbeit beantwortet beide Fragen. Die Antwort auf die erste Frage lautet, dass allen empfindungsfähigen Wesen beziehungsweise allen Menschen und allen Tieren moralische Berücksichtigungswürdigkeit um ihrer selbst willen zukommt. Die Antwort auf die zweite Frage lautet, dass alle Menschen und alle Tiere in allen Situation moralische Berücksichtigungswürdigkeit in gleicher Weise zukommt. Im Folgenden wird demnach für eine stark egalitaristische, pathozentrische Umweltethik argumentiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Von der Urwahl zu den vier Grundtypen der Umweltethik
- Egoismus oder moralischer Standpunkt
- Wer sind alle?
- Instrumenteller Wert, intrinsischer Wert, inhärenter Wert und Eigenwert
- Vier Grundtypen der Umweltethik
- Moralischer Anthropozentrismus
- Pathozentrismus
- Biozentrismus
- Holismus
- Welche Ethik?
- Inklusions- oder Exklusionsfrage?
- Der Weg der Ausweitung von innen
- Ist es legitim, Tiere zur moralischen Gemeinschaft dazu zu zählen?
- Das pathozentrische Argument
- Ist es legitim, Pflanzen und andere Organismen zur moralischen Gemeinschaft dazu zu zählen?
- Das pathozentrische Argument
- Das teleologische Argument
- Das Argument von der Ehrfurcht vor dem Leben
- Ist es legitim, Tiere zur moralischen Gemeinschaft dazu zu zählen?
- Der Weg der Einschränkung von aussen
- Soll unbelebte Materie von der moralischen Gemeinschaft ausgeschlossen werden?
- Sollen Ökosysteme von der moralischen Gemeinschaft ausgeschlossen werden?
- Sollen Pflanzen und anderen Organismen von der moralischen Gemeinschaft ausgeschlossen werden?
- Zwischenfazit
- Diskussion von Einwänden
- Der Einwand der Unhintergehbarkeit der Anthropozentrik
- Nortons Konvergenzhypothese
- Der Einwand der fehlenden Wechselseitigkeit
- Der Following-Nature-Einwand
- Der Einwand der Holisten
- Exkurs: Interne Argumente für den Naturschutz
- Basic-Need-Argument
- Ästhetische Argumente (Aisthesis/Kontemplation/Design)
- Heimat-Argumente
- Pädagogisches Argument
- Fazit
- Abgestufter oder gleicher Eigenwert?
- Hierarchismus oder Egalitarismus?
- Hierarchismus
- Egalitarismus
- Diskussion
- Fazit
- Schwacher oder starker Egalitarismus?
- Fazit
- Hierarchismus oder Egalitarismus?
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Frage der moralischen Berücksichtigungswürdigkeit der Natur und argumentiert für eine stark egalitaristische, pathozentrische Umweltethik. Sie untersucht, welche Entitäten um ihrer selbst willen moralisch zu berücksichtigen sind und ob diese moralische Berücksichtigungswürdigkeit in gleicher Weise zukommt.
- Moralische Relevanz: Welche Entitäten sind um ihrer selbst willen moralisch zu berücksichtigen?
- Moralische Signifikanz: Kommt allen Entitäten, die moralisch zu berücksichtigen sind, diese moralische Berücksichtigungswürdigkeit in gleicher Weise zu?
- Pathozentrische Ethik: Die Arbeit argumentiert für eine Umweltethik, die alle empfindungsfähigen Wesen, also Menschen und Tiere, moralisch berücksichtigt.
- Egalitarismus: Alle Menschen und Tiere sollen in allen Situationen moralische Berücksichtigungswürdigkeit in gleicher Weise erhalten.
- Ausweitung des Kreises der moralischen Gemeinschaft: Die Arbeit untersucht Argumente für eine Ausweitung der moralischen Gemeinschaft auf Tiere und Pflanzen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 führt in die Thematik der moralischen Berücksichtigungswürdigkeit der Natur ein und untersucht verschiedene Grundtypen der Umweltethik, von anthropozentrischen bis hin zu holistischen Ansätzen. Die Unterscheidung zwischen Egoismus und moralischem Standpunkt sowie die Bedeutung von Werten werden beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der Frage, welche Entitäten moralisch zu berücksichtigen sind. Es werden Argumente für eine Ausweitung des Kreises der moralischen Gemeinschaft auf Tiere und Pflanzen, sowie Einwände gegen eine pathozentrische Ethik, diskutiert.
Kapitel 4 befasst sich mit der Frage, ob alle Entitäten, die moralisch zu berücksichtigen sind, diese moralische Berücksichtigungswürdigkeit in gleicher Weise erhalten sollen. Hierarchische und egalitaristische Ansätze werden gegenübergestellt und ein stark egalitaristischer Standpunkt wird vertreten.
Schlüsselwörter
Umweltethik, moralische Berücksichtigungswürdigkeit, Natur, Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Biozentrismus, Holismus, Egalitarismus, Hierarchismus, Moral, Tiere, Pflanzen, empfindungsfähige Wesen.
- Quote paper
- Samuel Schawalder (Author), 2013, Umweltethik. Zur Diskussion um die moralische Berücksichtigungswürdigkeit der Natur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344504