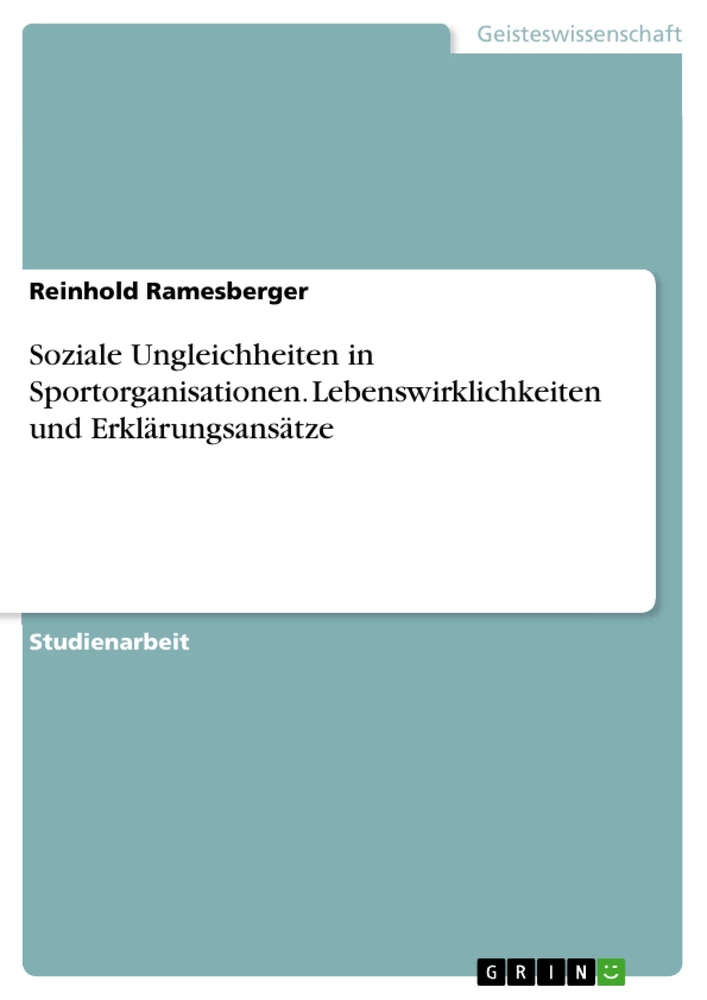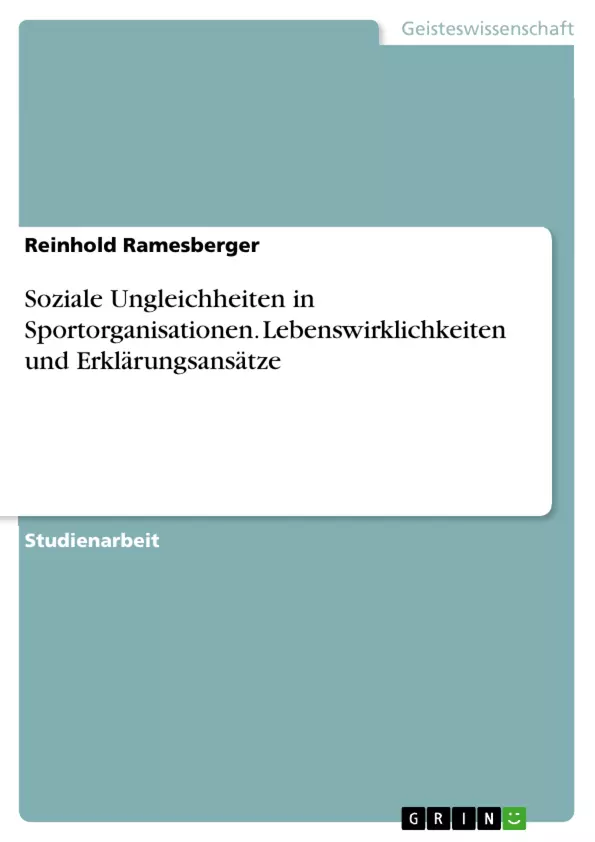Der Sportsektor ist eine Erscheinung, welche in der Gesellschaft durch die weltweite Omnipräsenz, die Medienpräsenz sowie die Vermarktung eine enorme gesellschaftliche aber auch wirtschaftliche Bedeutung gewonnen hat. Auch die Europäische Union erkennt die wichtige Rolle des Sports für die europäische Gesellschaft an.
Die gesellschaftliche Bedeutung der Sportorganisationen und dabei insbesondere der Vereine, zeigt sich greifbar in gesundheitlicher, sozialer sowie pädagogischer Art und Weise ebenso wie bei der Verkörperung des Leistungsprinzips, welches im Sport beispielhaft sichtbar wird. Der Teilbereich sozialer Ungleichheit wird im Sportsektor in der Literatur jedoch sehr kontrovers diskutiert und dargestellt. Ein Meinungslager vertritt die Auffassung, dass im Sport soziale Ungleichheiten weniger hervortreten als in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und soziale Schichtgrenzen sogar aufgehoben werden könnten.
Im Wettkampfsport ist Gleichberechtigung und gleiche Verteilung der Siegchancen sogar konstitutiv und „Spitzenqualität und Leistung“ ist auf der Grundlage weltweit gleicher Regeln relativ objektiv zu ermitteln. Im Bereich der sozialen Integration wird der Sportbereich oft sogar als „Königsweg“ bezeichnet, da Sport eine Welt der Gleichwertigkeit aller Menschen unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht oder Ethnie usw. darstellt. Ein anderes Meinungslager konstatiert hingegen, dass auch im Sportbereich der Zugang und generell die Möglichkeiten stark vom sozialen Status abhängen.
Aufgrund dieser heterogenen und kontroversen Zugänge soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, inwieweit der Bereich des Sports tatsächlich universal integrierend und für alle gleich ist, oder ob es sich dabei eher um einen Mythos handelt. Ganz speziell sollen dabei die Einflussfaktoren und Mechanismen in den Blick genommen, die sich in und durch Sportorganisationen auf die Reproduktion von Ungleichheit auswirken oder andererseits vielleicht doch eine ungleichheitsmindernde Wirkung haben. Dies soll unter folgender Forschungsfrage untersucht werden:
„Reproduziert der organisierte Sport und dessen Sportorganisationen die soziale Ungleichheit oder wirken diese ungleichheitsverringernd?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung & Problemstellung
- Eingrenzung, Einordnung und gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- Sportorganisationen - eine Definitionsannäherung
- Das deutsche System der Sportorganisation(en)
- Soziale Ungleichheit und Bourdieu's „Ungleichheitstheorie“
- Die Kapitaltheorie
- Habitus und sozialer Raum
- Ungleichheiten in Sportorganisationen - Lebenswirklichkeiten und Erklärungsansätze
- Geschlechterungleichheiten in Sportorganisationen
- Geschlechterungleichheiten bei Führungspositionen und Mitgliedschaft
- Erklärungsansätze und Mechanismen für Geschlechterdifferenzen
- Soziale Ungleichheit durch Schicht- & Milieuzugehörigkeit – Sachstand und Ursachen
- Wirkmechanismus soziale Lage & Habitus
- Sozioökonomische Wirkfaktoren
- Motivationale Wirkfaktoren
- Ungleichheit durch Migrationshintergrund (MGH)
- Erklärungsansatz Milieu & Schicht
- Erklärungsansatz Vereinsorganisation
- Erklärungsansatz Kultur, Religion und Selbstselektion
- Erklärungsansatz Passung von Bedürfnisbefriedigung
- Ungleichheiten durch Vereinsbarrieren und Staat
- Autopoesis und Binnenstrukturen
- Ungleichheits(re)produktion durch staatliche Fördersysteme
- Zwischenfazit
- Besondere Potenziale und Chancen des organisierten Sports
- Beantwortung der Forschungsfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der organisierte Sport und dessen Sportorganisationen soziale Ungleichheit reproduzieren oder ob sie ungleichheitsverringernd wirken. Dabei stehen die Einflussfaktoren und Mechanismen im Fokus, die sich in und durch Sportorganisationen auf die Reproduktion von Ungleichheit auswirken oder andererseits vielleicht doch eine ungleichheitsmindernde Wirkung haben.
- Analyse der Rolle des Sports in der Gesellschaft und seiner Bedeutung für soziale Integration
- Untersuchung der verschiedenen Formen und Ursachen sozialer Ungleichheit im Sportsektor
- Beurteilung der Auswirkungen von Sportorganisationen auf die Reproduktion oder Verminderung von Ungleichheit
- Identifizierung von Potenzialen und Chancen des Sports im Hinblick auf soziale Inklusion
- Entwicklung von Empfehlungen für die Gestaltung des Sports, um soziale Ungleichheit zu verringern.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der sozialen Ungleichheit im Sportsektor ein und stellt die Forschungsfrage. Das zweite Kapitel grenzt den Untersuchungsgegenstand ein und ordnet ihn in den gesellschaftlichen Kontext ein. Das dritte Kapitel erläutert die theoretische Grundlage der Arbeit, Bourdieu's „Ungleichheitstheorie". Das vierte Kapitel untersucht anhand von Studien- und Dokumentenanalysen relevante Ungleichheiten im Sport und seinen Organisationen und liefert mögliche Erklärungsansätze. Das fünfte Kapitel beleuchtet besondere gesellschaftlich relevante Potenziale und Chancen des Sportsektors.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Sportorganisationen, Bourdieu's „Ungleichheitstheorie", Geschlechterungleichheit, Schicht- & Milieuzugehörigkeit, Migrationshintergrund, Vereinsbarrieren, Staat, Potenziale, Chancen, Reproduktion, Verminderung.
Häufig gestellte Fragen
Reproduziert der organisierte Sport soziale Ungleichheit?
Die Arbeit untersucht kontrovers, ob Sport tatsächlich universal integrierend wirkt oder ob der Zugang und die Möglichkeiten stark vom sozialen Status und Kapital abhängen.
Welche Rolle spielt Bourdieus Theorie in diesem Kontext?
Bourdieus Kapitaltheorie (ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital) sowie das Konzept des Habitus erklären, warum bestimmte Schichten im Sport unterrepräsentiert sind.
Gibt es Geschlechterungleichheiten in Sportorganisationen?
Ja, die Analyse zeigt deutliche Differenzen bei der Besetzung von Führungspositionen und in der Mitgliederstruktur zwischen den Geschlechtern.
Wie wirkt sich ein Migrationshintergrund auf die Sportbeteiligung aus?
Die Beteiligung hängt oft von kulturellen Faktoren, Vereinsbarrieren sowie der Passung zwischen individuellen Bedürfnissen und den Angeboten der Sportvereine ab.
Warum wird Sport oft als "Königsweg" der Integration bezeichnet?
Weil Sport theoretisch eine Welt der Gleichwertigkeit bietet, in der Leistung unabhängig von Herkunft oder Status nach weltweit gleichen Regeln zählt.
- Arbeit zitieren
- BA Reinhold Ramesberger (Autor:in), 2016, Soziale Ungleichheiten in Sportorganisationen. Lebenswirklichkeiten und Erklärungsansätze, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344572