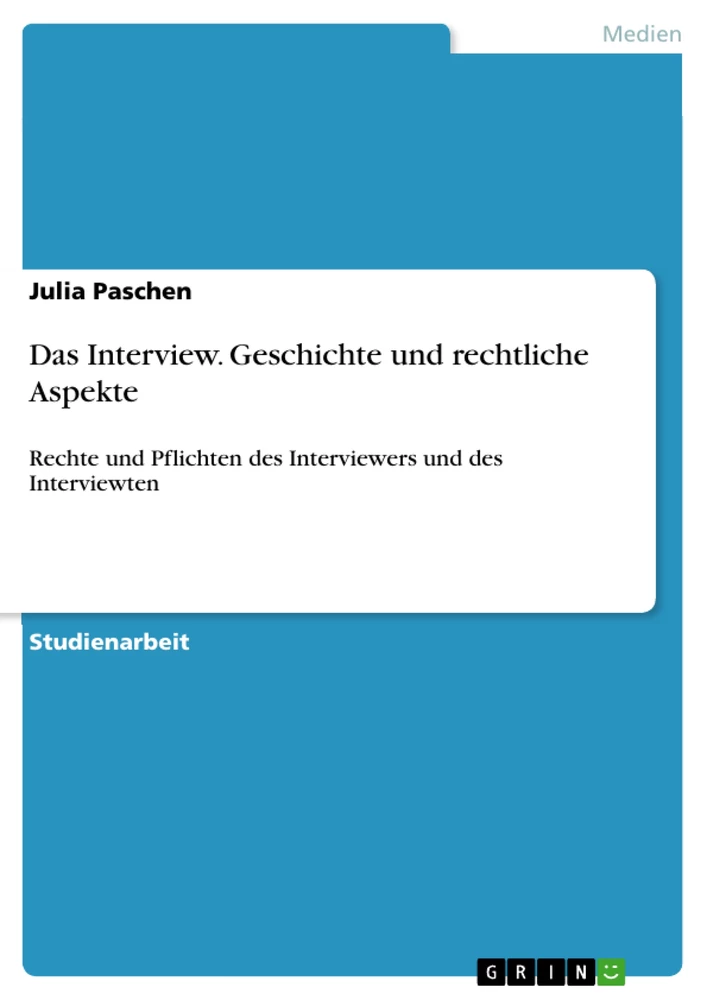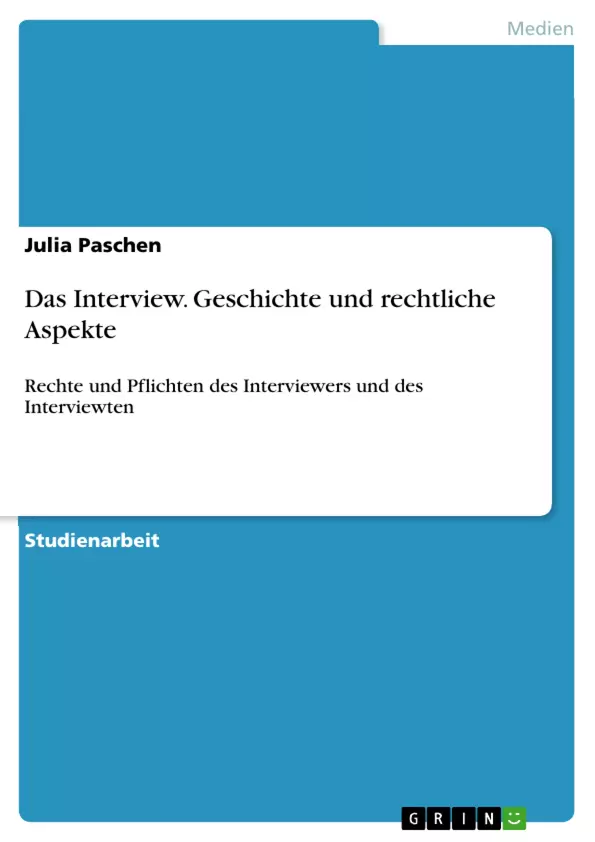In dieser Arbeit wird die historische Entwicklung des Interviews nachgezeichnet und ergänzend die Rechte und Pflichten von Interviewer und Interviewtem erläutert.
Das Befragen anderer Menschen findet seit Beginn der Menschheit statt. Auf diese Weise wird die Neugier gestillt. Die journalistische Befragung, das Interview, welche erst im 19. Jahrhundert entstand, ist eine beabsichtigte und verbale Kommunikation zwischen einem Journalisten und dem Interviewpartner in Frage-Antwort-Form. Man kann diese Art von Kommunikation nicht mit Alltagsgesprächen gleichsetzen. Zwar geht es hierbei auch um Alltagskommunikation, jedoch erzeugt die „Künstlichkeit“ des Interviews eine gewisse Spannung. Diese Künstlichkeit geschieht durch die Zielsetzung und die Geplantheit. Es gibt mittlerweile unterschiedliche Interviewformen und Techniken, die zu einem professionellen Journalismus gehören. Das war nicht immer so.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Interview im Allgemeinen
- 2.1 Was ist ein Interview?
- 2.2 Die Entstehungsgeschichte des Presse-Interviews
- 2.3 Interviewmethoden, Vorbereitung und Durchführung
- 3. Rechte und Pflichten
- 3.1 Das Urheberrecht
- 3.2 Haftungen für inhaltliche Aspekte
- 3.3 Grundsätze des Persönlichkeitsrechts
- 4. Fallbeispiel und Fazit
- 4.1 „Der Bangemann-Fall“
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte des Interviews, fokussiert auf die Rechte und Pflichten von Interviewer und Interviewtem. Sie beleuchtet die Entwicklung des Interviewformats vom antiken sokratischen Dialog bis zum modernen Journalismus und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte.
- Entwicklung des Interviews von der Antike bis zum modernen Journalismus
- Rechtliche Grundlagen des Interviews (Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht)
- Rollen und Verantwortlichkeiten von Interviewer und Interviewpartner
- Unterschiede zwischen Alltagskommunikation und dem journalistischen Interview
- Analyse eines Fallbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Interviews ein und stellt dessen Entwicklung und Komplexität dar. Sie hebt den Unterschied zwischen alltäglichen Gesprächen und dem gezielten, geplanten Charakter des journalistischen Interviews hervor. Die Einleitung unterstreicht die wachsende Bedeutung des Interviews im Journalismus und die Notwendigkeit, die damit verbundenen Rechte und Pflichten zu verstehen. Der Fokus liegt auf der beabsichtigten und verbalen Kommunikation zwischen Journalist und Interviewpartner, wobei die "Künstlichkeit" des Interviews als spannungsvoller Aspekt betont wird.
2. Das Interview im Allgemeinen: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Interview“ selbst, seine Definition und seine Anwendung in verschiedenen journalistischen Kontexten. Es beschreibt das Interview als Methode der Informationsgewinnung durch gezielte Fragen und die anschließende Bearbeitung der Antworten. Der Abschnitt betont die Bedeutung der Asymmetrie im Interview (Interviewer fragt, Interviewpartner antwortet), die Notwendigkeit glaubwürdiger Fragen und die Verwendung von O-Tönen, um den Informationsgehalt lebendig zu gestalten. Es wird außerdem die wachsende Popularität des Interviews in verschiedenen Medien hervorgehoben, sowie die Anforderungen an einen professionellen Interviewer.
2.2 Die Entstehungsgeschichte des Presse-Interviews: Dieser Abschnitt zeichnet den historischen Werdegang des Presse-Interviews nach, beginnend in den USA mit Joseph Burbridge McCullagh. Er beschreibt die anfängliche Kritik an dieser neuen Befragungsmethode, ihren Siegeszug über die Ostküste der USA, nach England und schließlich nach Deutschland. Die Diskussion um den genauen Zeitpunkt der ersten Interviewveröffentlichung wird erläutert, wobei auch frühere Formen der Befragung in Polizeiberichten ("human interest stories") berücksichtigt werden. Die Einführung wörtlicher Dialoge durch James Gordon Bennett wird als Meilenstein hervorgehoben, ebenso wie die unterschiedliche Entwicklung des Journalismus in Amerika und Deutschland im 19. Jahrhundert.
FAQ: Interview – Rechte, Pflichten und Geschichte
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über das Interview, seine Geschichte, die damit verbundenen Rechte und Pflichten sowie ein Fallbeispiel. Er behandelt die Entwicklung des Interviews vom antiken Dialog bis zum modernen Journalismus, analysiert rechtliche Aspekte wie Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte und untersucht die Rollen von Interviewer und Interviewpartner.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in fünf Kapitel gegliedert: 1. Einleitung, 2. Das Interview im Allgemeinen (inkl. Entstehungsgeschichte und Methoden), 3. Rechte und Pflichten (Urheberrecht, Haftung, Persönlichkeitsrecht), 4. Fallbeispiel und Fazit ("Der Bangemann-Fall"), 5. Fazit.
Worauf konzentriert sich der zweite Abschnitt ("Das Interview im Allgemeinen")?
Dieser Abschnitt definiert den Begriff "Interview", beschreibt seine Anwendung in journalistischen Kontexten, betont die Asymmetrie zwischen Interviewer und Interviewpartner, die Bedeutung glaubwürdiger Fragen und die Verwendung von O-Tönen. Er hebt auch die wachsende Popularität des Interviews und die Anforderungen an professionelle Interviewer hervor.
Was behandelt der Abschnitt zur Entstehungsgeschichte des Presse-Interviews?
Dieser Abschnitt verfolgt die historische Entwicklung des Presse-Interviews, beginnend in den USA mit Joseph Burbridge McCullagh. Er beschreibt anfängliche Kritik, die Verbreitung in den USA, England und Deutschland, diskutiert den Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung und betont die Rolle von James Gordon Bennett bei der Einführung wörtlicher Dialoge. Die unterschiedliche Entwicklung des Journalismus in Amerika und Deutschland wird ebenfalls beleuchtet.
Welche rechtlichen Aspekte werden behandelt?
Der Text behandelt das Urheberrecht, die Haftung für inhaltliche Aspekte und die Grundsätze des Persönlichkeitsrechts im Kontext von Interviews. Es wird deutlich gemacht, welche Rechte und Pflichten sowohl für den Interviewer als auch für den Interviewpartner bestehen.
Welches Fallbeispiel wird analysiert?
Der Text analysiert den "Bangemann-Fall" als Beispiel, um die behandelten rechtlichen und ethischen Aspekte zu veranschaulichen.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text untersucht die Geschichte des Interviews, konzentriert sich auf die Rechte und Pflichten von Interviewer und Interviewpartner und analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte. Er beleuchtet die Entwicklung vom antiken sokratischen Dialog bis zum modernen Journalismus.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Entwicklung des Interviews, die rechtlichen Grundlagen (Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht), die Rollen und Verantwortlichkeiten von Interviewer und Interviewpartner, der Unterschied zwischen Alltagskommunikation und journalistischem Interview und die Analyse eines Fallbeispiels.
- Quote paper
- Julia Paschen (Author), 2013, Das Interview. Geschichte und rechtliche Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344582