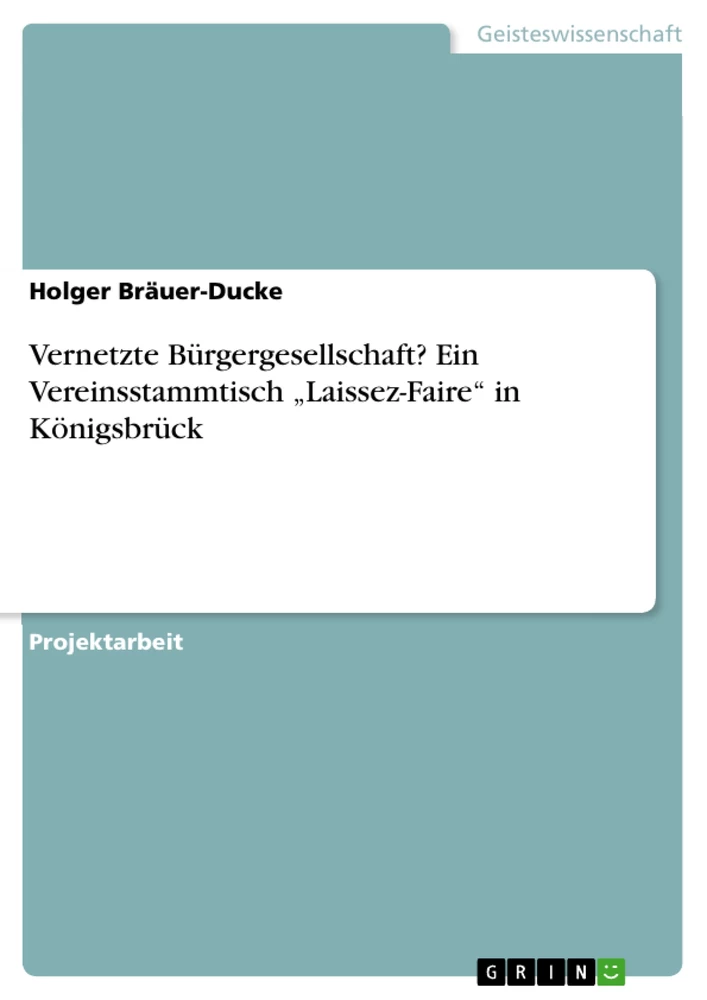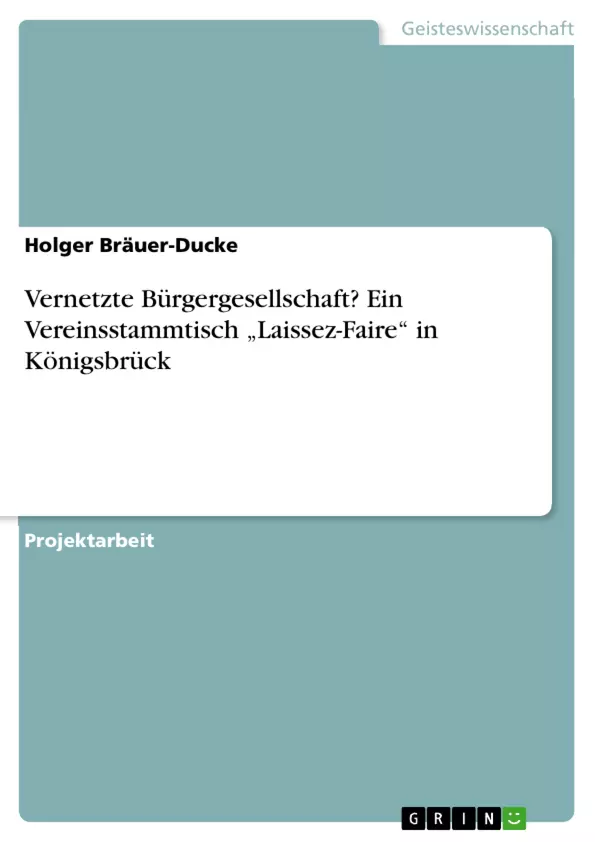Diese Thesis befasst sich mit einem freien Projekt zur stärkeren Verbindung der Aktivitäten von Vereinen, Initiativen, Bündnissen und interessierten Bürgern der Stadt Königsbrück mittels einer offenen Veranstaltung „Königsbrücker Vereinsstammtisch“. Die Initiativperson nimmt keinen Einfluss auf den Ablauf der Veranstaltung und die Annahme der Einladung zu dieser.
Sie gewährleistet lediglich die Organisation und Bereitstellung notwendiger Mittel zur Durchführung, sowie der rechtlichen Rahmenbedingungen, um den größtmöglichen Freiraum zur willentlichen Entfaltung der Teilnehmer zu gewährleisten. Die Teilnehmer werden auf freiwilliger Basis während der Veranstaltung befragt. In einer zweiten anonymen Befragung im Nachgang werden zur besseren Einschätzung der Fremdsicht auch Nichtteilnehmer mit einbezogen.
Das Ziel ist, interne Stärken und Schwächen der Bürgergesellschaft zu ermitteln, externe Chancen und Gefahren für die engagierte Bürgergesellschaft Königsbrücks auszuloten und unter Berücksichtigung aktueller Trends allgemeine Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Die Handlungsempfehlungen sind die Ergebnisse einer Momentaufnahme, entstanden aus dem freien Willen engagierter Bürger.
Sie sollen zyklisch neu überdacht, neu formuliert, auf die einzelne Organisation abgewandelt und ergänzt oder, dem freien Willen folgend, verworfen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Die Bürgergesellschaft
- Soziale Netzwerke: historisch, analog und digital
- Die Stadt Königsbrück – historisch, demografisch und politisch
- Die Maxime „Laissez faire et laissez passer“ und Führungsstil
- Direct Mailing
- Die SWOT-Analyse
- Das Projekt „Königsbrücker Vereinsstammtisch“ - „Vereine vernetzen - Verbindungen vereinen“
- Initial- und Vorbereitungsphase
- Planungsphase
- Umsetzungsphase
- Projektabschluss und -auswertung
- Schlussbetrachtung
- Chancen und Gefahren für die Bürgergesellschaft in Königsbrück
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht ein freies Projekt zur Vernetzung von Vereinen, Initiativen und Bürgern in Königsbrück mittels eines offenen Vereinsstammtisches. Das Hauptziel ist die Ermittlung interner Stärken und Schwächen der Bürgergesellschaft, die Auslotung externer Chancen und Gefahren sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. Der Ansatz ist partizipativ und basiert auf der freiwilligen Mitarbeit der Bürger.
- Stärken und Schwächen der Königsbrücker Bürgergesellschaft
- Chancen und Risiken für zivilgesellschaftliches Engagement in Königsbrück
- Analyse verschiedener Formen bürgerschaftlichen Engagements
- Der Einfluss von "Laissez-faire"-Prinzipien auf die Organisation und den Erfolg des Projekts
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit analysiert ein Projekt zur Stärkung der Vernetzung von Vereinen und Bürgern in Königsbrück durch einen offenen Vereinsstammtisch. Der Fokus liegt auf der partizipativen Methode, dem minimalen Einfluss der Initiativperson und der Erhebung von Daten mittels freiwilliger Befragungen von Teilnehmern und Nichtteilnehmern, um Stärken und Schwächen der lokalen Bürgergesellschaft zu identifizieren und Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung. Es definiert die Bürgergesellschaft, untersucht historische und aktuelle Formen sozialen Netzwerks, beleuchtet die sozio-politische Situation Königsbrücks und diskutiert die Bedeutung des "Laissez-faire"-Prinzips im Kontext des Projekts. Weiterhin werden Direct Mailing und die SWOT-Analyse als relevante Methoden eingeführt.
Das Projekt „Königsbrücker Vereinsstammtisch“ - „Vereine vernetzen - Verbindungen vereinen“: Dieses Kapitel beschreibt das Projekt in seinen verschiedenen Phasen: Initiierung und Vorbereitung, Planung, Umsetzung und abschließende Auswertung. Es wird detailliert auf die Organisation, die Durchführung und die gewonnenen Erkenntnisse eingegangen. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung des "Laissez-faire"-Ansatzes und den daraus resultierenden Erfahrungen.
Schlüsselwörter
Bürgergesellschaft, Königsbrück, Vereinsstammtisch, Laissez-faire, zivilgesellschaftliches Engagement, Netzwerke, Handlungsempfehlungen, partizipative Methoden, SWOT-Analyse, lokale Governance.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Königsbrücker Vereinsstammtisch"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert ein freies Projekt zur Vernetzung von Vereinen, Initiativen und Bürgern in Königsbrück mittels eines offenen Vereinsstammtisches. Das Hauptziel ist die Ermittlung interner Stärken und Schwächen der Bürgergesellschaft, die Auslotung externer Chancen und Gefahren sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. Der Ansatz ist partizipativ und basiert auf der freiwilligen Mitarbeit der Bürger.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die theoretischen Grundlagen der Bürgergesellschaft, soziale Netzwerke (historisch, analog und digital), die sozio-politische Situation Königsbrücks, das "Laissez-faire"-Prinzip und dessen Einfluss auf das Projekt, Direct Mailing und die SWOT-Analyse. Des Weiteren wird das Projekt "Königsbrücker Vereinsstammtisch" in seinen verschiedenen Phasen (Initiierung, Planung, Umsetzung, Auswertung) detailliert beschrieben. Die Arbeit untersucht Stärken und Schwächen der Königsbrücker Bürgergesellschaft, Chancen und Risiken für zivilgesellschaftliches Engagement, verschiedene Formen bürgerschaftlichen Engagements und entwickelt Handlungsempfehlungen für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
Welche Methodik wurde angewendet?
Der Ansatz ist partizipativ und basiert auf der freiwilligen Mitarbeit der Bürger. Daten wurden mittels freiwilliger Befragungen von Teilnehmern und Nichtteilnehmern erhoben. Die SWOT-Analyse und Direct Mailing werden als relevante Methoden eingesetzt. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung des "Laissez-faire"-Ansatzes und den daraus resultierenden Erfahrungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel mit theoretischen Grundlagen (Bürgergesellschaft, soziale Netzwerke, Königsbrück, Laissez-faire, Direct Mailing, SWOT-Analyse), ein Kapitel zum Projekt "Königsbrücker Vereinsstammtisch" (Initial- und Vorbereitungsphase, Planungsphase, Umsetzungsphase, Projektabschluss und -auswertung) und eine Schlussbetrachtung mit Chancen und Gefahren für die Bürgergesellschaft in Königsbrück sowie Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Bürgergesellschaft, Königsbrück, Vereinsstammtisch, Laissez-faire, zivilgesellschaftliches Engagement, Netzwerke, Handlungsempfehlungen, partizipative Methoden, SWOT-Analyse, lokale Governance.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Ermittlung der Stärken und Schwächen der Königsbrücker Bürgergesellschaft, die Auslotung externer Chancen und Gefahren sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.
Welche Rolle spielt das "Laissez-faire"-Prinzip?
Das "Laissez-faire"-Prinzip spielt eine zentrale Rolle im Projekt und beeinflusst die Organisation und den Erfolg des Vereinsstammtisches. Die Arbeit untersucht den Einfluss dieses Prinzips auf die praktische Umsetzung des Projekts.
- Arbeit zitieren
- Holger Bräuer-Ducke (Autor:in), 2015, Vernetzte Bürgergesellschaft? Ein Vereinsstammtisch „Laissez-Faire“ in Königsbrück, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344586