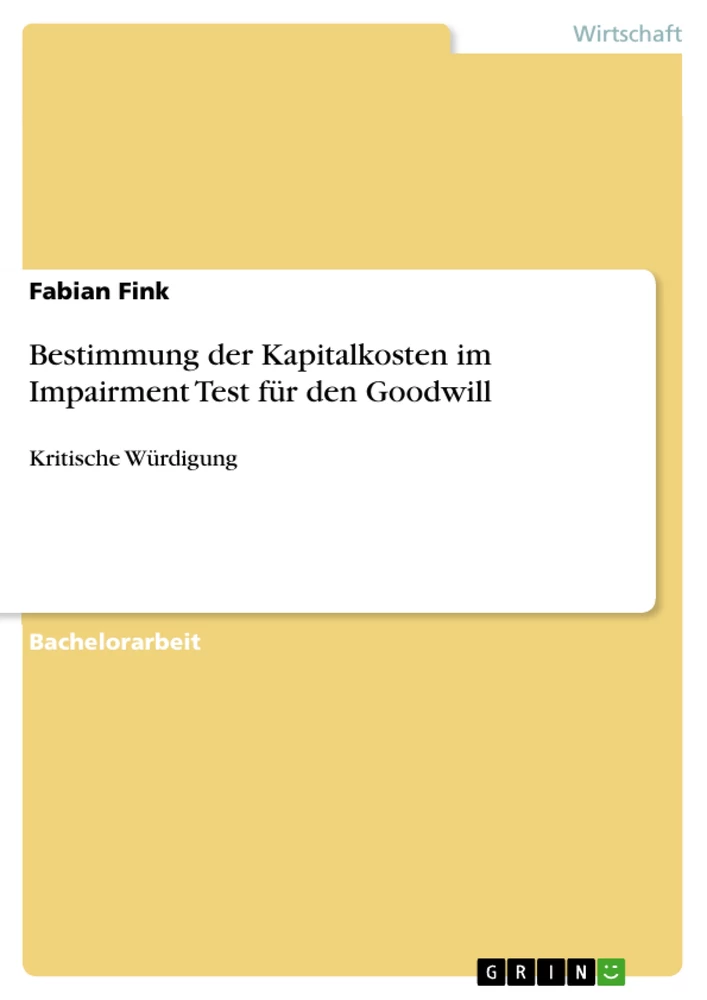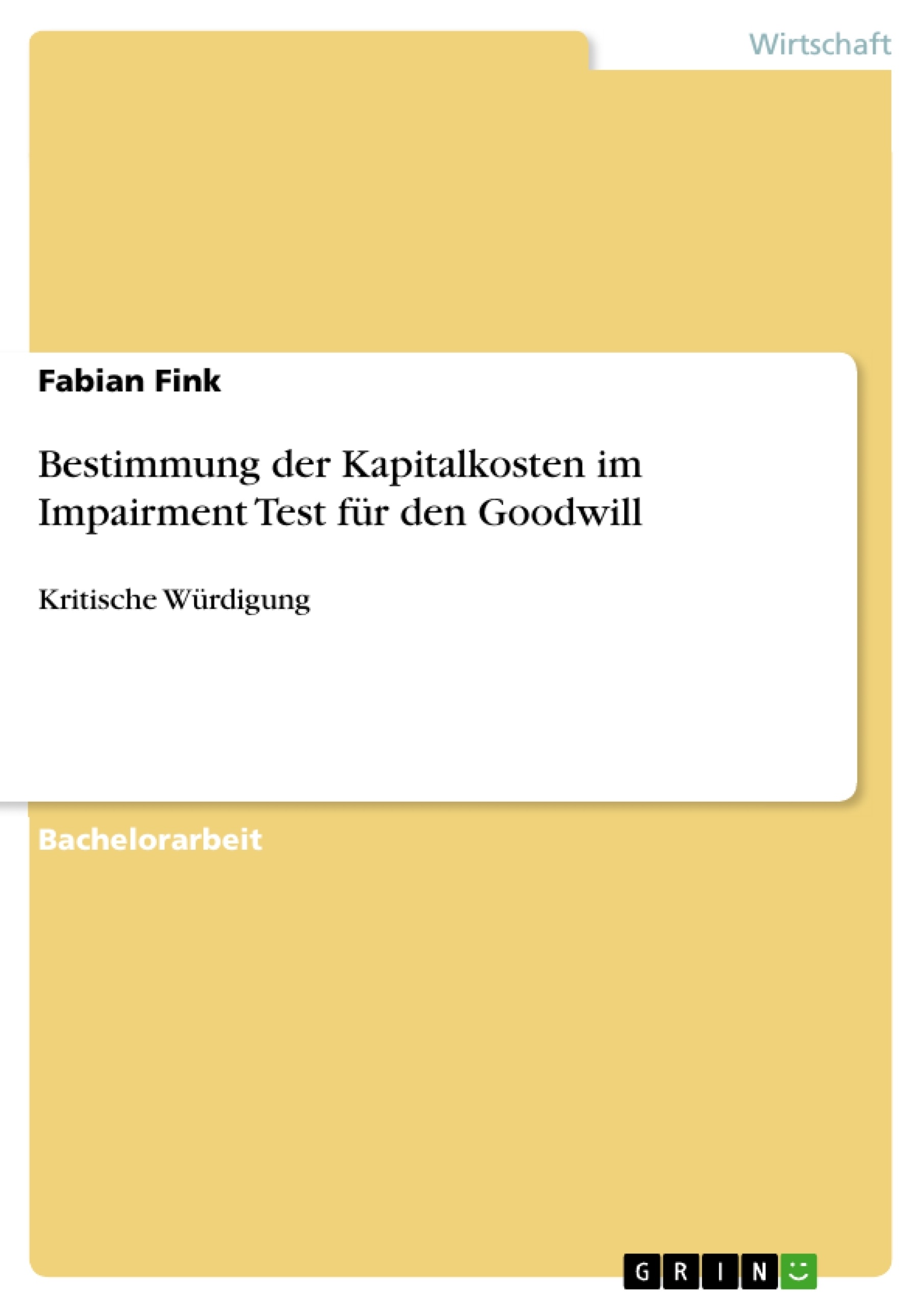Als Unterpunkt der Vermögenswerte gliedert sich in der Bilanz der Posten immaterielle Vermögenswerte, welche schon von Moxter als „die ewigen Sorgenkinder im Bilanzrecht“ bezeichnet wurden. Eine wesentliche Rolle wird dabei vom Goodwill (Geschäfts- oder Firmenwert) eingenommen. Oft wird in den Medien über Unternehmenskäufe berichtet, bei denen der Kaufpreis den Buchwert übersteigt. Dieser Unterschiedsbetrag schlägt sich in der Bilanz des Erwerbers meist als Geschäftswert nieder und zählt zu einem der größten Bilanzposten. Mit einem Impairment Test wird die Werthaltigkeit des Goodwills geprüft. Da es sich bei einer Goodwillabschreibung oft um sehr hohe Werte handelt, wirken bilanzbeeinflussende Maßnahmen direkt auf die Gewinngrößen. Seit der Finanzkrise 2008 ist der Impairment Test dadurch verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Für die Bestimmung des Abschreibungsbedarfs wird der Nutzungswert (Value in Use) herangezogen, der als sehr subjektiver Wert gilt. Für die Bestimmung des Value in Use ist die Schätzung der Cashflows sowie ein „angemessener“ Abzinsungssatz notwendig. Da hierfür das Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF-Verfahren), welches ausdrücklich in den IFRS gewünscht ist, verwendet wird, werden dem Management so erhebliche bilanzpolitische Freiheiten eröffnet, sodass der Gewinnausweis beliebig steuerbar ist. Selbst dem Bilanzanalysten ist es nicht mehr möglich, diese Folgebewertung kritisch zu hinterfragen. Die Bestimmung des Diskontierungssatzes erhält dadurch eine zentrale Rolle, denn sein Hebeleffekt macht ihn zu einem beliebten Instrument im Management: Minimale Veränderungen dieses Zinsfußes können den Unternehmenswert enorm beeinflussen. Fraglich dabei ist, inwieweit bei seiner Ermittlung unternehmensspezifische Einflüsse einbezogen werden können, obwohl im Standard eine unternehmensunabhängige Ermittlung für eine weitgehende Objektivierung vorgeschrieben ist.
Die vorliegende Bachelorarbeit betrachtet die Theorie der genannten Thematik und unterzieht sie dabei gleichzeitig einer kritischen Betrachtung. Der Gang der Untersuchung startet mit der Erklärung des Goodwills und seiner Entstehung in Kapitel 2. Auf die sich anschließende Folgebewertung wird in Kapitel 3 eingegangen, woran in dem Punkt 3.2.1 mit der Ermittlung des Value in Use anhand der geforderten Richtlinien des IASB angeschlossen wird. [...]
Inhaltsverzeichnis
- ProblemSTELLUNG
- ANSATZ UND ERSTBEWERTUNG DES GOODWILLS IN DER BILANZ
- GRUNDLEGENDE IFRS-REGELUNGEN FÜR DIE BILANZIERUNG DES GOODWILLS
- DER GOODWILL - VERMÖGENSGEGENSTAND KRAFT FIKTION
- ERMITTLUNG DES GOODWILLS MIT DER ERWERBSMETHODE
- AUFTEILUNG DES GOODWILLS AUF CASH GENERATING UNITS
- DER IMPAIRMENT TEST ZUR FOLGEBEWERTUNG DES GOODWILLS
- ZIELSETZUNG DER WERTHALTIGKEITSPRÜFUNG
- VORGEHENSWEISE ZUR ERMITTLUNG DES WERTBERICHTIGUNGS-BEDARFS
- ERMITTLUNG DES RECOVERABLE AMOUNTS
- DAS DISCOUNTED-CASHFLOW-VERFAHREN
- ABLEITUNG DER KÜNFTIGEN CASHFLOWS
- DER WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL-ANSATZ
- DIE ERMITTLUNG DER WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL
- EIGENKAPITALKOSTEN
- DER RISIKOLOSE ZINS
- DIE MARKTRISIKOPRÄMIE
- DER BETA-FAKTOR
- FREMDKAPITALKOSTEN
- KAPITALSTRUKTUR
- DIE ERMITTLUNG DER WACHSTUMSRATE
- THESENFÖRMIGE ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bestimmung der Kapitalkosten im Impairment Test für den Goodwill. Sie befasst sich kritisch mit den Verfahren zur Ermittlung des WACC (Weighted Average Cost of Capital) und der damit verbundenen Herausforderungen.
- Analyse der IFRS-Vorschriften zur Bilanzierung und Folgebewertung von Goodwill
- Kritik an der fiktiven Natur des Goodwills und seiner Behandlung im Impairment Test
- Diskussion der verschiedenen Ansätze zur Ermittlung der Kapitalkosten (WACC)
- Bewertung der Bedeutung des Goodwills im Kontext der Unternehmensbewertung
- Analyse des Impairment Tests als Instrument zur Bewertung der Wertberichtigung von Goodwill
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Problemstellung dar. Es wird die Relevanz des Goodwills in der Bilanz und die Bedeutung des Impairment Tests zur Bewertung seiner Wertberichtigung hervorgehoben. Das zweite Kapitel beleuchtet die grundlegenden IFRS-Regelungen zur Bilanzierung des Goodwills sowie die Herausforderungen seiner Bewertung als fiktiven Vermögensgegenstand. Es werden verschiedene Ansätze zur Ermittlung des Goodwills, wie die Erwerbsmethode, vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich dem Impairment Test, der im Mittelpunkt der Arbeit steht. Es werden die Ziele der Werthaltigkeitsprüfung, die Vorgehensweise zur Ermittlung des Wertberichtigungsbedarfs und die Anwendung des Discounted-Cashflow-Verfahrens erläutert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Berechnung des WACC, den verschiedenen Komponenten wie Eigenkapitalkosten, Fremdkapitalkosten und der Kapitalstruktur, gewidmet. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse thesenförmig zusammengefasst und wichtige Erkenntnisse der Arbeit hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Goodwill, Impairment Test, WACC (Weighted Average Cost of Capital), Discounted-Cashflow-Verfahren, IFRS, Kapitalkosten, Unternehmensbewertung, Wertberichtigung, fiktives Vermögen, Erwerbsmethode, Folgebewertung.
- Citation du texte
- Fabian Fink (Auteur), 2012, Bestimmung der Kapitalkosten im Impairment Test für den Goodwill, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344665