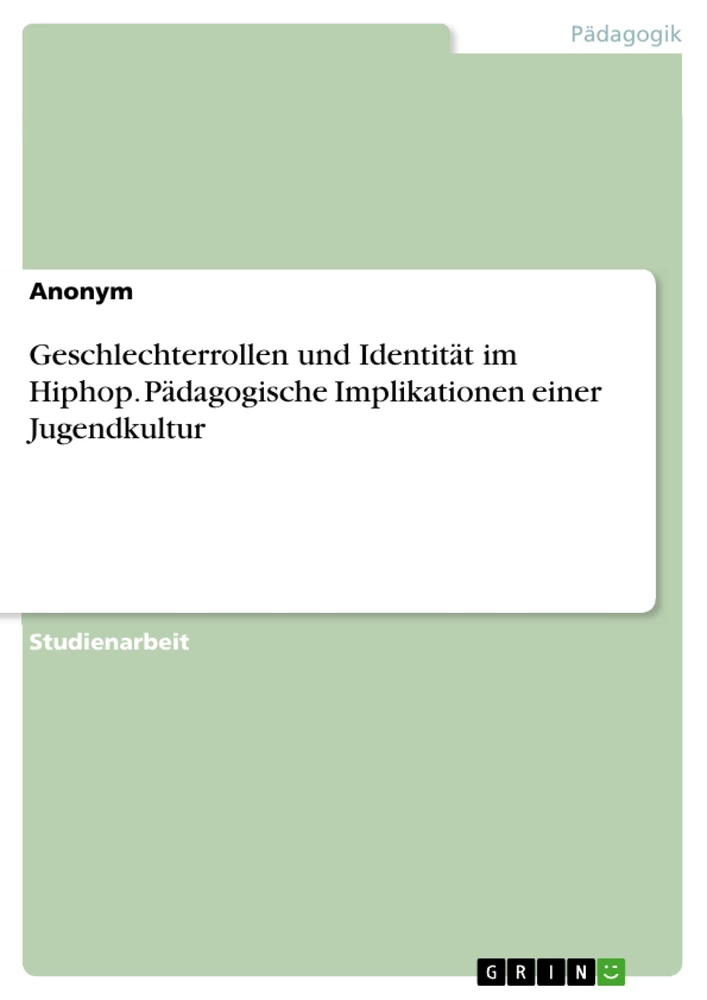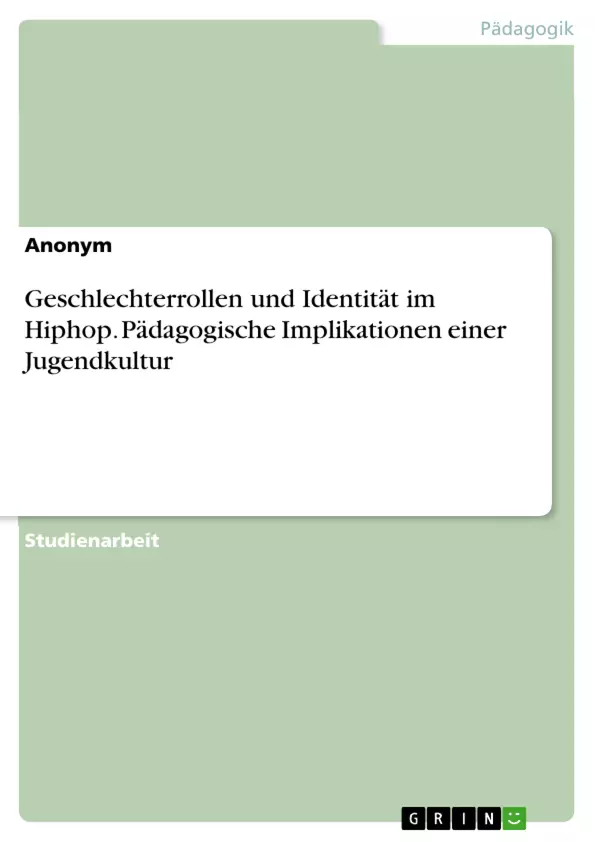Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll der Einfluss des Hiphop als eine der „dominantesten, erfolgreichsten und folgenreichsten Popkulturen“ im Hinblick auf die Identitätsbildung von Jugendlichen untersucht werden. Von übergeordnetem Interesse ist dabei zunächst die Frage nach den im Hiphop enthaltenen Repräsentationen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Im weiteren Verlauf wird danach gefragt, welche Auswirkungen die im Hiphop dargestellten Geschlechterrollen auf die Identitätskonstruktionen Jugendlicher haben können.
Vor diesem Hintergrund soll insbesondere auch auf zwei grundlegende kritische Perzeptionen der repräsentierten Geschlechterrollen eingegangen werden: Nämlich der Überrepräsentation des Männlichen einerseits und einer gleichzeitigen Herabwürdigung und auf sexuelle Merkmale reduzierte Darstellung der Frau. Insbesondere wird Letzteres aus medienpädagogischer Sicht als jugendgefährdend eingestuft. Entsprechend soll im Anschluss erörtert werden, inwiefern Hiphop als Jugendkultur einen negativen Einfluss auf die Identitätsbildung von Jugendlichen haben kann.
Den Beginn dieser Arbeit bildet die theoretische Auseinandersetzung mit dem Terminus Jugend und der Problematik einer Eingrenzung des Jugendbegriffs. Im weiteren Verlauf wird auf die Identitätsbildung Jugendlicher in der Postmoderne eingegangen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Relevanz von Jugendkulturen und –Szenen eingegangen. Im Anschluss wird der Hiphop als spezifische Jugendkultur in den Fokus gerückt.
Nach einem kurzen Abriss über die Entstehungsbedingungen wird auf die zentralen Elemente und das thematische Spektrum dieser Popkultur eingegangen. Daran anknüpfend wird auf die im Hiphop enthaltenen Repräsentationen von Weiblichkeit und Männlichkeit eingegangen. Zuletzt soll diskutiert werden, inwieweit die dargestellten Geschlechterrollen sich als jugendgefährdend erweisen und sich eine Zensur gewisser Hiphop-Texte empfiehlt, oder aber, welche positiven Impulse Hiphop für die Identitätsbildung von Jugendlichen bieten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugend und Jugendkulturen
- Jugendliche Identitätsbildung in der Postmoderne
- Zur Bedeutung von Jugendkulturen
- Jugendkultur Hiphop: Repräsentation und Identifikation
- Zentrale Elemente und thematisches Spektrum
- Repräsentationen von Männlichkeit und Weiblichkeit im Hiphop
- Hiphop als „Sündenbock“? Pro und Contra einer Zensur
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss des Hiphop auf die Identitätsbildung von Jugendlichen im postmodernen Kontext. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der im Hiphop enthaltenen Repräsentationen von Männlichkeit und Weiblichkeit und deren Auswirkungen auf die Identitätskonstruktionen Jugendlicher.
- Die Herausforderungen der Identitätsbildung in der Postmoderne
- Die Rolle von Jugendkulturen für die Identitätsfindung
- Die Repräsentation von Geschlechterrollen im Hiphop
- Die kritische Diskussion um die im Hiphop dargestellten Geschlechterrollen
- Die Frage nach der potentiellen Jugendgefährdung durch Hiphop
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die Relevanz von Jugendkulturen für die Identitätsbildung in der Postmoderne.
- Das zweite Kapitel untersucht die Entstehung des Jugendbegriffs und beleuchtet die Problematik der Jugendlichen Identitätsbildung in der Postmoderne. Es werden verschiedene Konzepte zur Identitätsfindung im Kontext von Jugendkulturen vorgestellt.
- Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Jugendkultur Hiphop. Zentrale Elemente und das thematische Spektrum dieser Popkultur werden vorgestellt. Anschließend werden die Repräsentationen von Männlichkeit und Weiblichkeit im Hiphop analysiert.
Schlüsselwörter
Jugend, Jugendkulturen, Hiphop, Identitätsbildung, Postmoderne, Geschlechterrollen, Repräsentation, Zensur, Jugendgefährdung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Hiphop die Identität von Jugendlichen?
Hiphop bietet starke Identifikationsfiguren und prägt durch seine Repräsentationen von Männlichkeit und Weiblichkeit das Selbstbild Jugendlicher.
Was wird an der Darstellung von Frauen im Hiphop kritisiert?
Oft wird eine Herabwürdigung und die Reduzierung der Frau auf sexuelle Merkmale bemängelt, was medienpädagogisch als problematisch gilt.
Gilt Hiphop als jugendgefährdend?
Die Arbeit diskutiert, ob bestimmte Texte aufgrund sexistischer oder gewaltverherrlichender Inhalte zensiert werden sollten oder positive Impulse bieten.
Welche Rolle spielen Jugendkulturen in der Postmoderne?
In einer komplexen Welt dienen Szenen wie Hiphop als wichtige Orientierungspunkte für die Identitätskonstruktion.
Was sind die zentralen Elemente der Hiphop-Kultur?
Dazu gehören Rap (MCing), DJing, Breakdance und Graffiti sowie das spezifische thematische Spektrum der Texte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Geschlechterrollen und Identität im Hiphop. Pädagogische Implikationen einer Jugendkultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344768