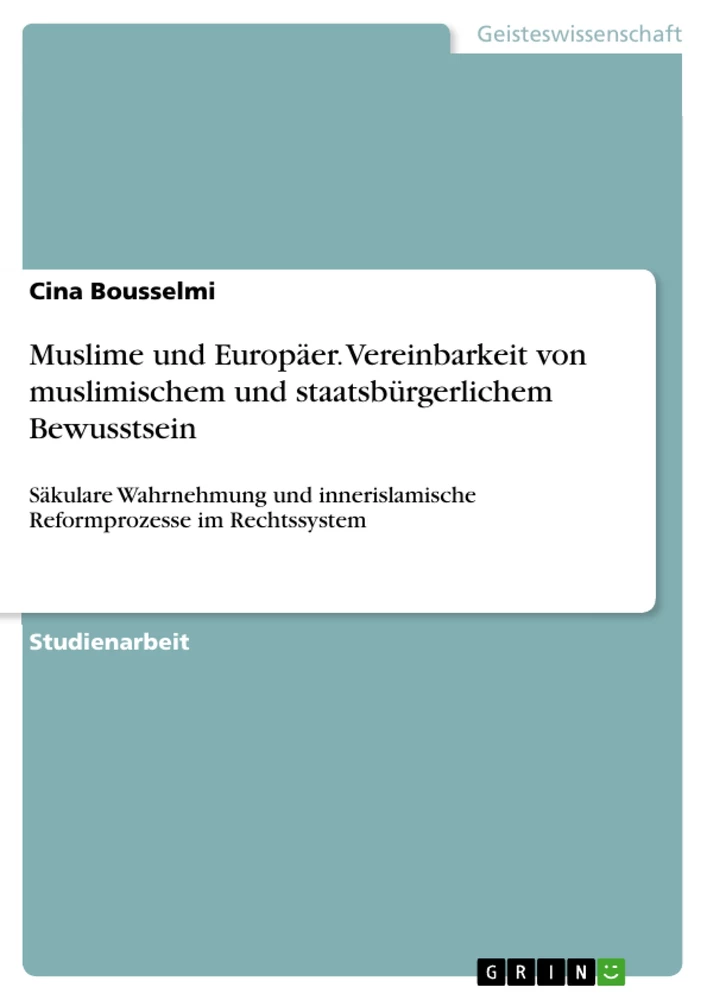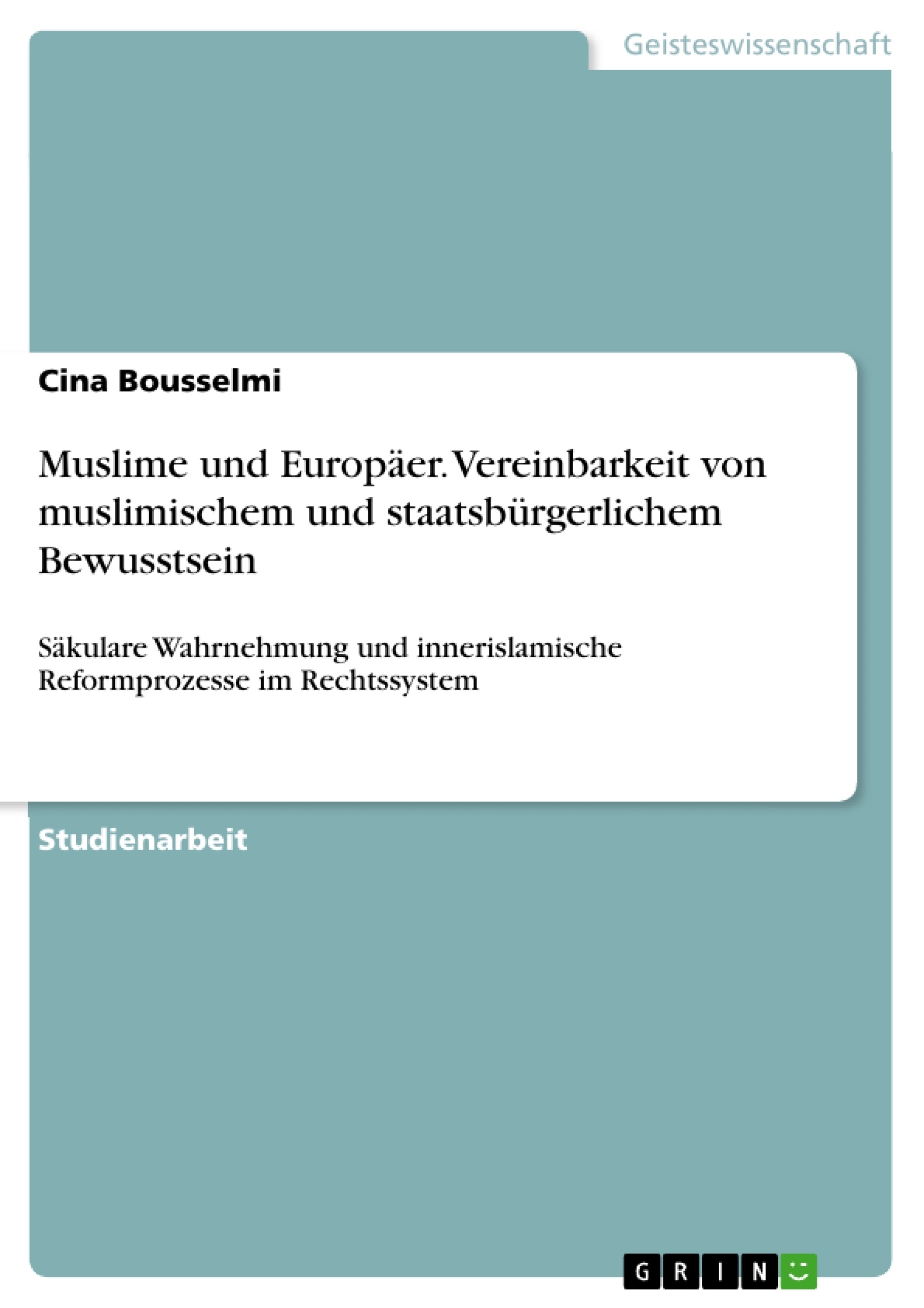Die Arbeit behandelt Fragen der Zugehörigkeit und Identität: Wie sieht es mit der Vereinbarkeit der Werteordnung des Islam und des Pluralismus aus?
Der Islam ist nach dem Christentum die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Deutschland. Frauen mit Kopftüchern und Halal-Geschäfte sind keine Randerscheinung mehr, sondern werden mehr und mehr zu einem Bestandteil Deutschlands. Das Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft, welches bisher den Islam als Fremd definierte, sieht sich gezwungen das Wertespektrum zu hinterfragen, neu zu definieren und ggf. zu ergänzen. Den durchaus komplizierten Status des Islams in Deutschland zeigte sich nicht zuletzt in der Polemik, die 2010 durch die vom damaligen Bundespräsident getätigte Äußerung in seiner Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit „der Islam gehört zu Deutschland“ ausgelöst wurde. Sein Nachfolger, der derzeitigen Bundespräsident Gauck, relativierte gleich nach Amtsantritt diesen Satz, und stellt fest, dass zwar die vielen Muslime, die in Deutschland leben, dazu gehören, dass es jedoch durchaus zweifelhaft sei, ob man das von der islamischen Religion sagen kann, da diese, anders als das Christentum, den Prozess der Aufklärung noch nicht vollzogen habe. Dadurch betonte er, dass es eine Diskrepanz zwischen der christlichen (und evtl. jüdischen) Wertetradition Deutschlands und dem mitunter als problematisch gesehen kulturell-religiösen Erbe des Islam gibt. Zugleich stellte er damit die Vereinbarkeit von europäischem und muslimischem Selbstverständnis in Frage.
Der Islam steht im europäischen Kontext vor einer schwierigen Situation: Anschauung und Tradition aus verschiedensten Ländern und damit äußerst heterogene Islamverständnisse treffen aufeinander und versuchen als muslimische Minderheit in einer historisch christlich-abendländischen, heute säkular pluralistischen Gesellschaft, ihren Platz zu finden. Um Orientierung zwischen Identitätsanomie und radikalen Fundamentalismus und um die Suche nach neuen Wegen beide Identitäten zu vereinbaren, bemühen sich die „neuen muslimische Intellektuellen“ indem sie versuchen innerislamische Reformprozesse auszuarbeiten.
Um dem nachzugehen, werde ich meine Arbeit an zwei Hauptsträngen orientieren. Nachdem an das modern-säkulare Verständnis von Pluralismus erinnert wird, sollen zugleich dessen Grenzen anhand der Darstellung bestimmter Diskursperspektiven in Bezug auf den Islam aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Islam im pluralistischen, säkularen Kontext Europas
- Referenzrahmen
- Islam in der Moderne
- Eine Frage der Identität
- Angst um säkulare Moderne
- Muslimische Identitätsfindung in Europa
- Exkurs: Das Rechtsystem im Islam
- Innermuslimische Grundpositionen des Islam in Europa
- Die „Aufgaben der neuen Intellektuellen“
- Tariq Ramadans Reformkonzept
- Islam und Staatsbürgerliche Pflichten und Rechte
- Die Achtung weltlich-säkularer Gesetze
- Weg vom „Minderheiten Fiqu“ hin zur Partizipation
- Neuerung der Konzepte
- Dâr ash-shahâda: Die Auflösung der klassischen Dichotomie
- Die Gefahr einer Islamisierung Europas?
- Islam und Staatsbürgerliche Pflichten und Rechte
- Islamisches Rechtwesen im Bezug zum Westen
- Ramadans Idschtihad Konzeption
- Selbständiger Islam in Europa
- Sein Zugang zu den normativen Quellen
- Ramadan „Radikale Reform“: die Neubestimmung der klassischen Rechtsmethoden
- Die Unterscheidung zwischen dem Unveränderlichen (ath-thâbit) und dem Veränderlichen (al-mutaghayyir)
- Verschiebung des Schwerpunkts religiöser und rechtlicher Autorität
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vereinbarkeit von muslimischem und staatbürgerlichem Bewusstsein im Kontext Europas. Sie fokussiert auf den Einfluss innerislamischer Reformprozesse auf die Herausforderungen, die sich aus dem Zusammenleben von Muslimen und Europäern in einer säkularen Gesellschaft ergeben. Das zentrale Anliegen ist, die Relevanz und die Bedeutung des Islams im öffentlichen Diskurs in Europa zu beleuchten und die Möglichkeiten zur Integration von muslimischen Werten und Traditionen in das europäische Wertesystem zu analysieren.
- Die Bedeutung der Säkularität im europäischen Kontext
- Die Identitätskrise muslimischer Bürger in Europa
- Die Rolle innerislamischer Reformprozesse in der Integration
- Das Verhältnis von muslimischem und staatbürgerlichem Rechtssystem
- Die Bedeutung des Idschtihad im modernen Islam
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Situation des Islams in Deutschland und stellt die Problematik der Vereinbarkeit von muslimischem und staatbürgerlichem Bewusstsein in den Vordergrund. Kapitel 2 setzt den Rahmen für die Analyse und untersucht den Pluralismus in Europa sowie die Herausforderungen, die sich für den Islam im modernen, säkularen Kontext ergeben. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Suche nach einer muslimischen Identität in Europa und beleuchtet die innerislamischen Grundpositionen sowie die Rolle der „neuen Intellektuellen“. Kapitel 4 analysiert Tariq Ramadans Reformkonzept und betrachtet seine Ansätze zur Neubestimmung der klassischen Rechtsmethoden. Kapitel 5 widmet sich der Frage, wie sich islamisches Rechtwesen im Bezug zum Westen entwickelt und ob es möglich ist, einen selbständigen Islam in Europa zu etablieren. Kapitel 6 geht auf Ramadans „Radikale Reform“ ein und erklärt seine Methode zur Neubestimmung der klassischen Rechtsmethoden. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf Schlüsselbegriffe wie Säkularität, Pluralismus, muslimische Identität, Reformprozesse im Islam, Idschtihad, Islamisches Recht, Tariq Ramadan, Europa, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Islam mit der europäischen Werteordnung vereinbar?
Die Arbeit untersucht diese Frage anhand von Identitätskonzepten und zeigt auf, wie Muslime versuchen, ihr religiöses Selbstverständnis mit den Werten einer pluralistischen, säkularen Gesellschaft zu vereinen.
Wer ist Tariq Ramadan und was ist sein Reformkonzept?
Tariq Ramadan ist ein einflussreicher Intellektueller, der für einen „europäischen Islam“ plädiert. Sein Konzept betont die Partizipation von Muslimen als vollwertige Bürger unter Achtung säkularer Gesetze.
Was bedeutet „Idschtihad“ im modernen Kontext?
Idschtihad bezeichnet die selbstständige Interpretation der religiösen Quellen, um zeitgemäße Antworten auf moderne Fragen zu finden, was für Reformprozesse im Islam zentral ist.
Was ist der Unterschied zwischen „Dâr al-Islâm“ und „Dâr ash-shahâda“?
Ramadan löst die klassische Dichotomie auf und führt den Begriff „Dâr ash-shahâda“ (Raum des Zeugnisses) ein, in dem Muslime ihren Glauben in Freiheit leben und bezeugen können, ohne in einem islamischen Staat zu sein.
Welche Rolle spielen die „neuen muslimischen Intellektuellen“?
Sie bemühen sich um innerislamische Reformen, um Orientierung zwischen Identitätsverlust und radikalem Fundamentalismus zu bieten und die Integration in Europa zu fördern.
Wie wird das Verhältnis von religiösem und weltlichem Recht diskutiert?
Die Arbeit analysiert die Unterscheidung zwischen unveränderlichen religiösen Kernen und veränderlichen rechtlichen Bestimmungen, die an den europäischen Kontext angepasst werden können.
- Quote paper
- Cina Bousselmi (Author), 2013, Muslime und Europäer. Vereinbarkeit von muslimischem und staatsbürgerlichem Bewusstsein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344880