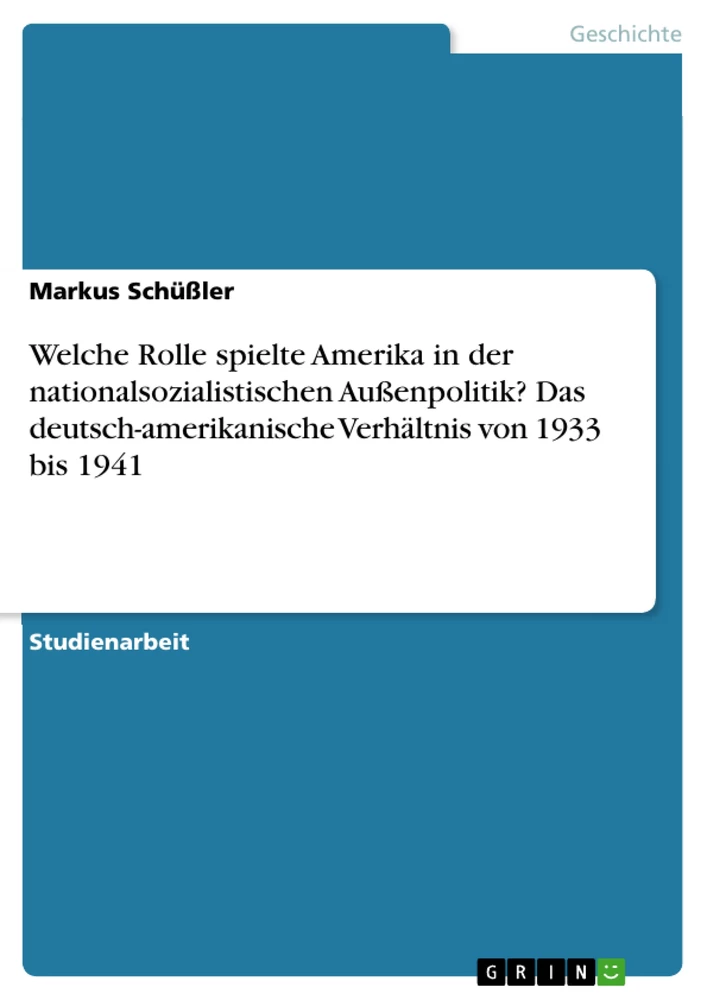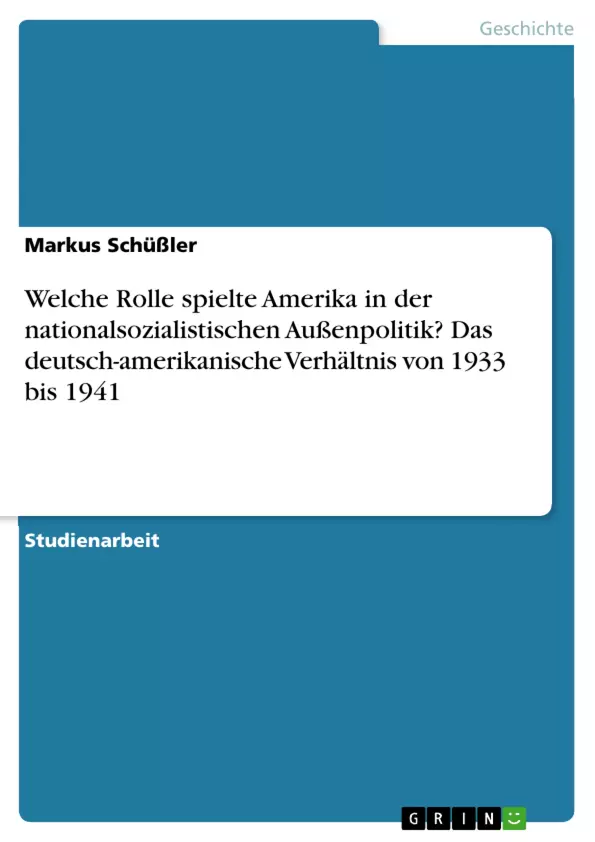In der vorliegenden Hausarbeit wird das deutsch-amerikanische Verhältnis in den Jahren von 1933 bis 1941 untersucht. Das deutsch-amerikanische Verhältnis in diesem Zeitraum kann in drei Phasen eingeteilt werden. Die erste Phase begann mit der Machtübernahme Hitlers. In ihr wurde die deutsch-amerikanische Kooperation, die seit 1921 bestanden hatte, abgebrochen und es entstand ein Verhältnis gegenseitigen Misstrauens. Besonders die Vereinigten Staaten hatten Vorbehalte zum „neuen“ Deutschland. Hierauf folgte die zweite Phase ab 1935, die gekennzeichnet war durch ein stetiges Abrücken voneinander hin zu einer noch nicht offenen aber dennoch deutlichen Opposition. 1934 schien es zunächst, als würden sich die USA aus Europa zurückziehen. Doch warum hielten sich die Vereinigten Staaten gerade in dieser Periode des deutschen Aufrüstens und Erstarkens zurück, wo es doch zu dieser Zeit relativ leicht gewesen wäre, Hitler seine Grenzen klar aufzuzeigen? Hätte Washington Frankreich nicht den Rücken stärken können, als es eine härtere Gangart gegenüber Deutschland forderte? Die dritte und damit letzte Phase schließlich bestand aus einer eskalierenden Feindschaft, die schließlich in der Kriegserklärung Hitlers an die USA ihren Höhepunkt fand. Doch wieso ging Hitler, der doch den Ersten Weltkrieg sonst als Lehre ansah, das Risiko ein, Amerika wie schon 1917 auf Seiten der Alliierten in den Krieg zu ziehen?
Die These schließlich, dass Hitler keine klare Amerikakonzeption gehabt habe und daher die USA in seinen politischen Planungen als einen zu vernachlässigenden Faktor dargestellt habe, soll widerlegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Ende der deutsch-amerikanischen Kooperation
- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Die Abrüstungs- und Weltwirtschaftskonferenz
- 2. Die Jahre der Distanzierung und des „non-involvement“
- 2.1 Zwischen Revisionismus und „non-involvement“
- 2.2 Handelspolitische Gegensätze
- 2.3 Die Gründe für Roosevelts Zurückhaltung
- 3. Der Weg in den Krieg
- 3.1 Amerikas Unterstützung für Großbritannien
- 3.2 Gründe für die deutsche Kriegserklärung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das deutsch-amerikanische Verhältnis zwischen 1933 und 1941, aufgeteilt in drei Phasen: den Abbruch der Kooperation, die zunehmende Distanzierung und schließlich die Eskalation in den Krieg. Die Hauptthese widerlegt die Annahme, Hitler habe die USA vernachlässigt.
- Das Ende der deutsch-amerikanischen Kooperation nach Hitlers Machtergreifung.
- Die Rolle der Abrüstungs- und Weltwirtschaftskonferenzen in der Verschlechterung der Beziehungen.
- Die Gründe für die US-amerikanische Zurückhaltung gegenüber dem aufrüstenden Deutschland.
- Die Entwicklung der Handelspolitik und ihre Auswirkungen auf das Verhältnis.
- Die Eskalation der Feindschaft und die deutsche Kriegserklärung an die USA.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung gliedert das deutsch-amerikanische Verhältnis von 1933-1941 in drei Phasen: den Abbruch der Kooperation, die Distanzierung und die Eskalation in den Krieg. Sie stellt die These auf, dass Hitler eine klare Amerikakonzeption hatte und die USA nicht vernachlässigte, im Gegensatz zu manchen Theorien. Die Einleitung umreißt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit.
1. Das Ende der deutsch-amerikanischen Kooperation: Dieses Kapitel beschreibt die Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Deutschland nach Hitlers Machtergreifung. Die zunehmende Zerstörung der Demokratie in Deutschland, der staatliche Terror, die Diskriminierung ethnischer und religiöser Gruppen und die negative öffentliche Reaktion in den USA trugen maßgeblich dazu bei. Das Kapitel analysiert auch die These, Hitler habe kein Interesse an den USA gehabt, und widerlegt sie unter anderem durch die Analyse der deutschen Medienpolitik und Propaganda, die eine vorsichtige Annäherung verfolgte, um eine Verschärfung des Konflikts zu vermeiden und die eigene Politik zu legitimieren. Die zunehmende Handelspolitik spielte ebenfalls eine große Rolle.
1.2 Die Abrüstungs- und Weltwirtschaftskonferenz: Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die gescheiterte Abrüstungskonferenz von 1933. Die USA waren anfänglich bereit, Deutschland in die internationale Gemeinschaft zu integrieren, um ein Gegengewicht zu Frankreich zu schaffen. Hitlers aggressive Revisionspolitik und das Scheitern des McDonald-Plans führten jedoch zum Abzug der deutschen Delegation und zum endgültigen Ende der Kooperation. Der Fokus liegt auf der amerikanischen Hoffnung auf friedlichen Wandel und Deutschlands Verhalten, dass die USA als Partner verlor.
Schlüsselwörter
Deutsch-amerikanisches Verhältnis, Hitler, Roosevelt, Abrüstungskonferenz, Weltwirtschaftskrise, Revisionismus, „non-involvement“, Propaganda, Handelspolitik, Kriegserklärung, Isolationismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum deutsch-amerikanischen Verhältnis 1933-1941
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das deutsch-amerikanische Verhältnis zwischen 1933 und 1941. Sie gliedert die Beziehungen in drei Phasen: den Abbruch der Kooperation, die zunehmende Distanzierung und schließlich die Eskalation in den Krieg. Ein zentrales Thema ist die Widerlegung der Annahme, Hitler habe die USA vernachlässigt.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie das Ende der deutsch-amerikanischen Kooperation nach Hitlers Machtergreifung, die Rolle der Abrüstungs- und Weltwirtschaftskonferenzen, die Gründe für die US-amerikanische Zurückhaltung gegenüber dem aufrüstenden Deutschland, die Entwicklung der Handelspolitik und ihre Auswirkungen auf das Verhältnis, sowie die Eskalation der Feindschaft und die deutsche Kriegserklärung an die USA.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit vertritt die These, dass Hitler eine klare Amerikakonzeption hatte und die USA nicht vernachlässigt hat, im Gegensatz zu manchen Theorien. Diese These wird durch die Analyse der deutschen Medienpolitik und Propaganda gestützt, die eine vorsichtige Annäherung verfolgte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel (Das Ende der deutsch-amerikanischen Kooperation, Die Jahre der Distanzierung und des „non-involvement“, Der Weg in den Krieg) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird in Unterkapitel weiter unterteilt und behandelt spezifische Aspekte des deutsch-amerikanischen Verhältnisses.
Was ist der Inhalt des Kapitels „Das Ende der deutsch-amerikanischen Kooperation“?
Dieses Kapitel beschreibt die Verschlechterung der Beziehungen nach Hitlers Machtergreifung, unter anderem durch die zunehmende Zerstörung der Demokratie in Deutschland, staatlichen Terror und die Diskriminierung ethnischer und religiöser Gruppen. Es analysiert auch die deutsche Medienpolitik und Propaganda, um die These zu widerlegen, Hitler habe kein Interesse an den USA gehabt.
Was ist der Inhalt des Unterkapitels „Die Abrüstungs- und Weltwirtschaftskonferenz“?
Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die gescheiterte Abrüstungskonferenz von 1933. Es analysiert die anfängliche Bereitschaft der USA, Deutschland zu integrieren, und wie Hitlers aggressive Revisionspolitik und das Scheitern des McDonald-Plans zum Abbruch der Kooperation führten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsch-amerikanisches Verhältnis, Hitler, Roosevelt, Abrüstungskonferenz, Weltwirtschaftskrise, Revisionismus, „non-involvement“, Propaganda, Handelspolitik, Kriegserklärung, Isolationismus.
Welche Quellen wurden verwendet? (Diese Frage kann nicht aus dem gegebenen HTML beantwortet werden)
Diese Information ist nicht im bereitgestellten HTML-Code enthalten.
- Quote paper
- Magister Artium Markus Schüßler (Author), 2003, Welche Rolle spielte Amerika in der nationalsozialistischen Außenpolitik? Das deutsch-amerikanische Verhältnis von 1933 bis 1941, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344912