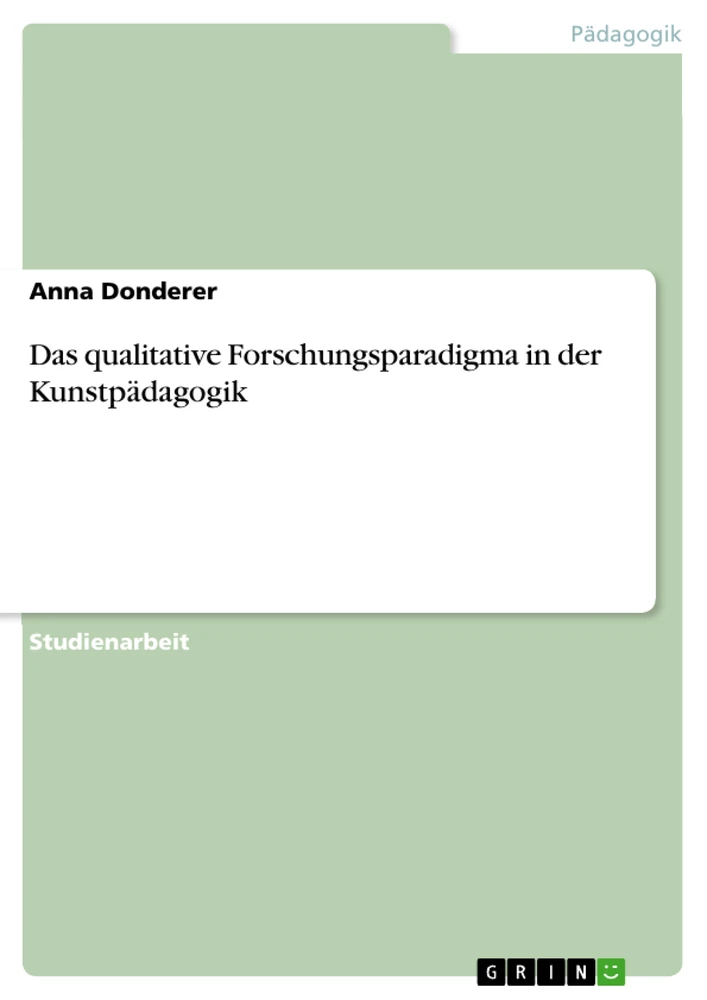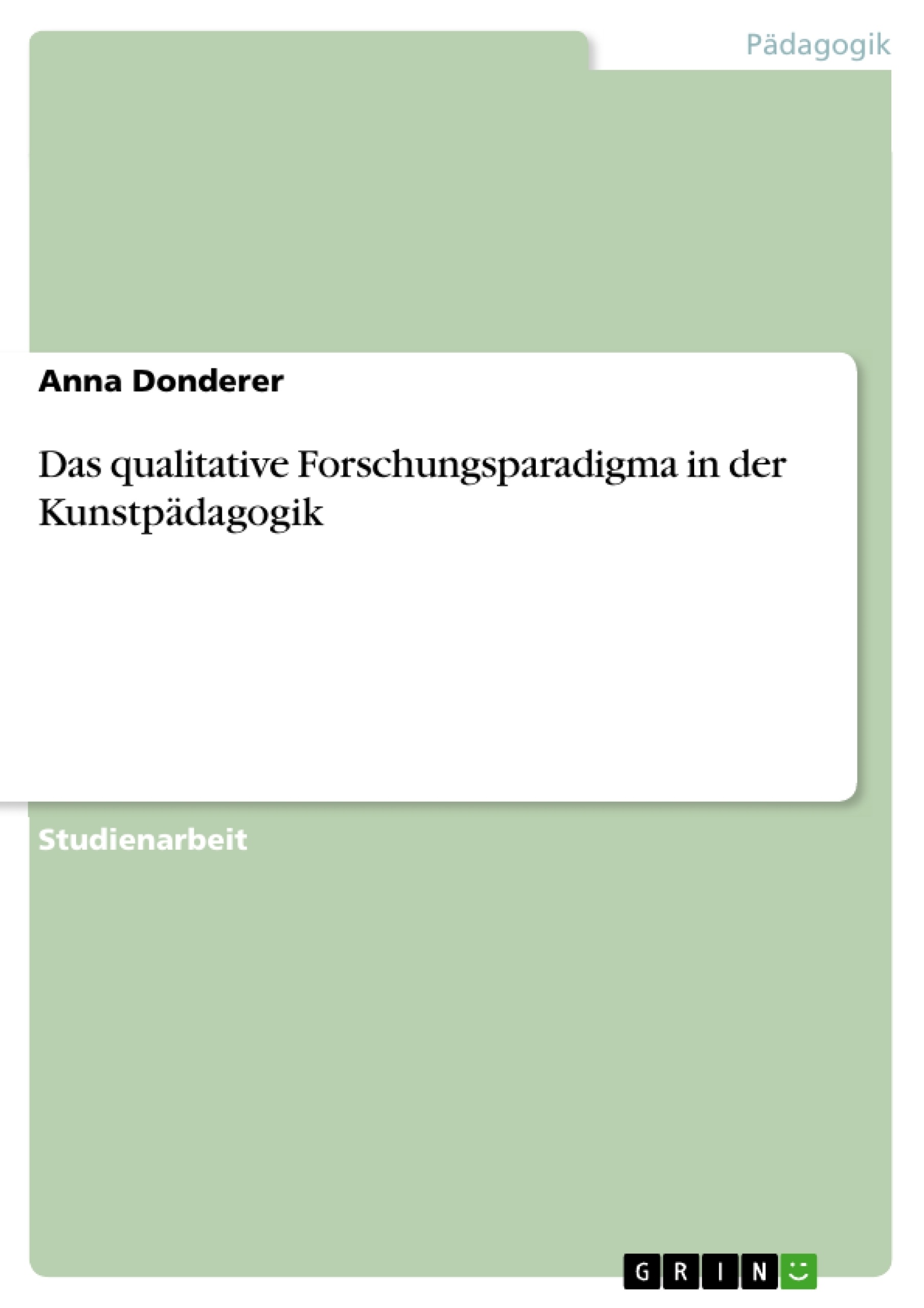Obwohl der kunstpädagogische Diskurs sich durch eine Vielzahl unterschiedlicher Publikationen auszeichnet, welche diverse Selbstverortungen zwischen Kunst und Pädagogik vornehmen, bleibt der Einfluss der Wissenschaft auf das Fachverständnis meist unerwähnt (Sabisch 2009, S. 36). In der Kunstpädagogik werden schon seit längerer Zeit Diskussionen zum eigenen Selbstverständnis geführt, die bisher angenommene Grundüberzeugungen infrage stellen (vgl. Peez 2000, S. 13). Auf der einen Seite werden Fachverständnisse von Kunst aus legitimiert, auf der anderen Seite von der Pädagogik, um nur die extremen Pole der Lehrkonzeptionen zu erwähnen. Wie es zu diesem durchaus festgefahrenen Selbstverständnis kam, welche Normen, Werte und Menschenbilder etc. damit verbunden werden wird leider nur selten reflektiert (vgl. Sabisch 2009, S. 36).
Was ist im Falle der akademischen Disziplin Kunstpädagogik das Material? Was sind ihre Themen und Fragestellungen? Durch welche institutionellen und medialen Konstellationen wird sie bestimmt? Weshalb ist Forschung in der Fachdisziplin Kunstpädagogik überhaupt notwendig? Mit diesen Fragen werden Studierende der Kunstpädagogik konfrontiert, wenn sie sich mit fachspezifischen Ursprüngen und Entwicklungen kunstpädagogischen Handelns beschäftigen möchten.
Mithilfe der Aneignung von forschungsbasierten Methoden wird möglich, die Selbstreflexion der eigenen kunstpädagogischen Praxis zu vertiefen. Ein Beispiel hierzu wäre z. B. die teilnehmende Beobachtung, welche zum Methodenpool der qualitativ-empirischen Sozialforschung zählt. Diese kann kollegiale Beratungsformen unterstützen und den eigenen Blick auf Sachverhalte in der Praxis schärfen. Ich erhoffe mir von einer fundierten Wissengrundlage zur kunstpädagogischen Forschung ästhetische Prozesse auf der Grundlage erhobener empirischer Forschungsmaterialien besser sichtbar und somit auch intersubjektiv nachvollziehbar zu machen. Mit immer stärker wachsenden Berufsanforderungen im Bereich von pädagogischen, als auch kunstpädagogischen Arbeitsfeldern besteht für mich die Aufgabe der Hochschule darin, Hilfestellungen, Werkzeuge, Herausforderungen und Anregungen für die Studierenden bereitzustellen, sowie Fähigkeiten zu fördern, um sich immer neuartigeren Aufgabenfeldern und Problemen anzupassen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Notwendigkeit kunstpädagogischer Forschung
- Eine Einführung
- Persönliche Motivation
- Qualitativ empirische Forschung in der Kunstpädagogik
- Begriff, Merkmale & Themenfelder qualitativer Forschung
- Differenzierung qualitativer Erhebungs-und Auswertungsmethoden
- Die qualitative Beobachtung
- Alltagsbeobachtung & Wissenschaftliche Beobachtung
- Formen der Beobachtung
- Die teilnehmende Beobachtung
- Reflexion und Diskussion eigener Erfahrungen
- Grundlagen qualitativer Interviewtechniken
- Das leitfadengestütze Interview
- Das narrative Interview
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des qualitativen Forschungsparadigmas in der Kunstpädagogik. Sie beleuchtet die Notwendigkeit von kunstpädagogischer Forschung, die sich durch die Verbindung von Kunst und Pädagogik auszeichnet und eigene Fragestellungen entwickeln muss, um sich von angrenzenden Fachdisziplinen abzugrenzen. Das Papier befasst sich mit den wichtigsten Merkmalen und Themenfeldern der qualitativen Forschung und diskutiert die Eignung von Methoden wie der qualitativen Beobachtung und verschiedenen Interviewtechniken für die Erforschung kunstpädagogischer Fragestellungen.
- Die Bedeutung von Forschung in der Kunstpädagogik
- Die Rolle der qualitativen Forschung in der Kunstpädagogik
- Das Herausarbeiten von Merkmalen und Themenfeldern qualitativer Forschung
- Die Anwendung qualitativer Methoden in der Kunstpädagogik
- Die Bedeutung der eigenen Forschungsidentität der Kunstpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit kunstpädagogischer Forschung, die durch die Verbindung von Kunst und Pädagogik neue Fragestellungen und einen eigenen Forschungsbereich etabliert. Es wird auf die Relevanz der Forschung für das Verständnis von kunstpädagogischem Handeln und die Bedeutung der Einbeziehung verschiedener Perspektiven hingewiesen.
Das zweite Kapitel widmet sich der qualitativen empirischen Forschung in der Kunstpädagogik. Es werden die Merkmale und Themenfelder qualitativer Forschung erläutert und die Bedeutung der Differenzierung qualitativer Erhebungs- und Auswertungsmethoden betont.
Im dritten Kapitel wird die qualitative Beobachtung als Forschungsmethode in der Kunstpädagogik genauer betrachtet. Die Unterscheidung zwischen Alltagsbeobachtung und wissenschaftlicher Beobachtung sowie verschiedene Formen der Beobachtung werden vorgestellt. Darüber hinaus wird die teilnehmende Beobachtung als spezifische Form der qualitativen Beobachtung beleuchtet und die Reflexion der eigenen Erfahrungen im Forschungsfeld thematisiert.
Das vierte Kapitel behandelt die Grundlagen qualitativer Interviewtechniken. Es werden das leitfadengestütze Interview und das narrative Interview als wichtige Methoden der Datenerhebung in der qualitativen Forschung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Kunstpädagogik, qualitative Forschung, Forschungsmethoden, Beobachtung, Interview, Inklusion, Bildung, Erziehung, Gesellschaft, Wissenschaftliche Identität, Fachdisziplin
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Forschung in der Kunstpädagogik notwendig?
Forschung hilft, das eigene Fachverständnis zwischen Kunst und Pädagogik zu klären, die eigene Praxis zu reflektieren und ästhetische Prozesse intersubjektiv nachvollziehbar zu machen.
Was ist die "teilnehmende Beobachtung"?
Es ist eine Methode der qualitativ-empirischen Sozialforschung, bei der der Forscher aktiv am Geschehen teilnimmt, um tiefere Einblicke in die Praxis zu gewinnen.
Welche Interviewtechniken werden in der Kunstpädagogik genutzt?
Häufig werden leitfadengestützte und narrative Interviews eingesetzt, um die Perspektiven und Erfahrungen der Beteiligten zu erfassen.
Was unterscheidet Alltagsbeobachtung von wissenschaftlicher Beobachtung?
Wissenschaftliche Beobachtung ist systematisch, zielgerichtet und basiert auf methodisch fundierten Kriterien zur Datenerhebung.
Wie unterstützt Forschung die Inklusion in der Kunstpädagogik?
Durch qualitative Methoden können Barrieren identifiziert und Bildungsprozesse so gestaltet werden, dass sie den Anforderungen einer diversen Gesellschaft gerecht werden.
- Quote paper
- Anna Donderer (Author), 2016, Das qualitative Forschungsparadigma in der Kunstpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345051