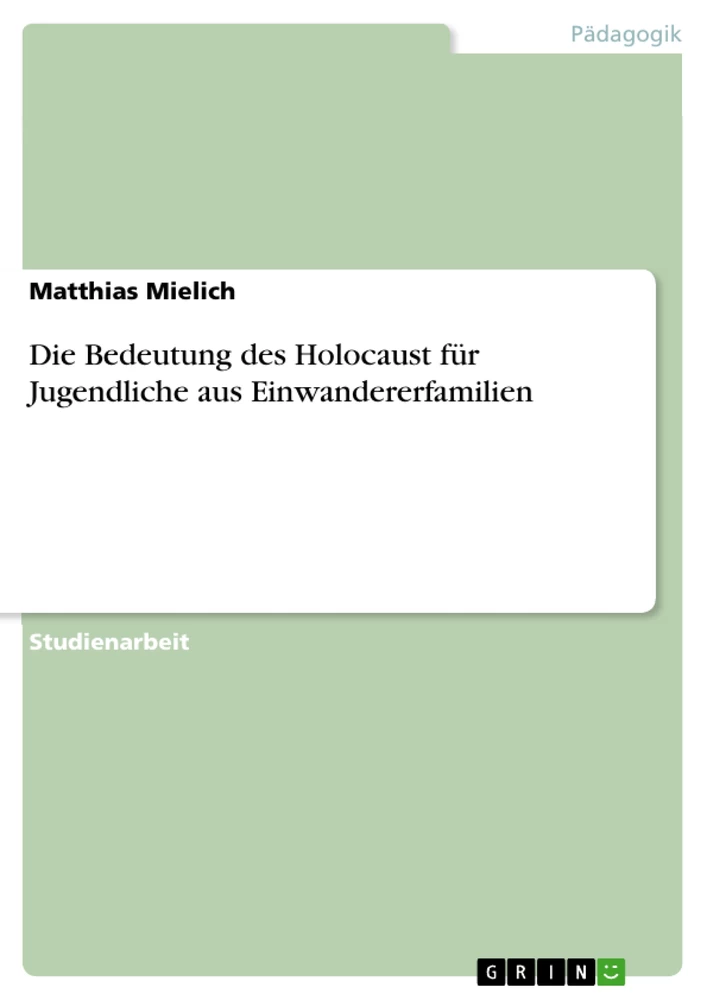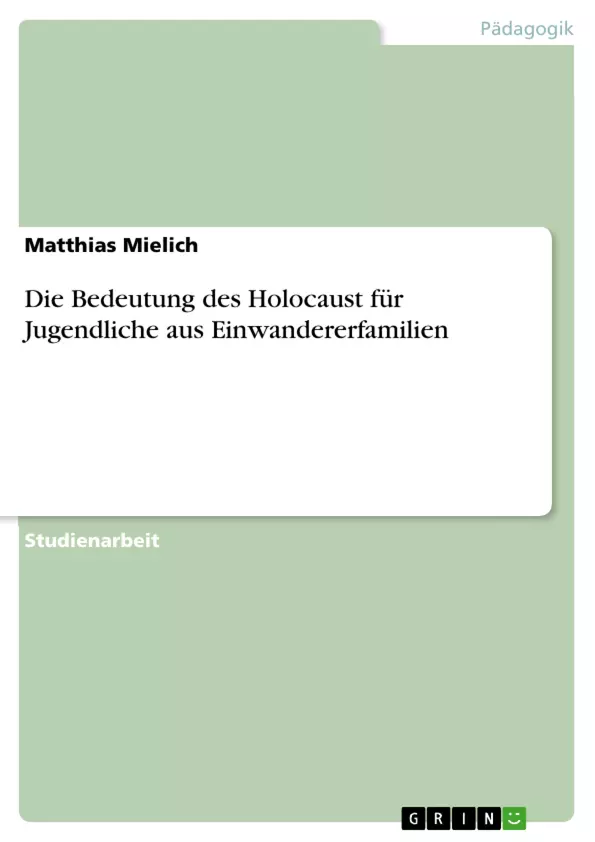Die Diskussion um die Frage, wie an den Holocaust und an die Zeit des Nationalsozialismus erinnert werden kann, hat in den letzten Jahren im Zuge von Migrationsprozessen und Generationenwechsel zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zum einen sehen sich viele Jugendliche mit Migrationshintergrund mit einem Anerkennungsproblem konfrontiert. Sie beklagen oftmals, dass die spezifischen Geschichten ihrer Migration nach Deutschland und die Geschichten ihres Herkunftslandes zu wenig oder überhaupt nicht im Geschichtsunterricht berücksichtigt werden.
Zum anderen berichten Pädagogen und Lehrkräfte auf Fortbildungsveranstaltungen wiederum, dass Jugendliche an deutscher Geschichte grundsätzlich desinteressiert seien und falls der Nationalsozialismus im Unterricht behandelt werden würde, seien die Wortmeldungen und Unterrichtsbeiträge oft antisemitisch.
Inwiefern sich diese beiden Phänomene und Erfahrungen in der Unterrichtspraxis bestätigen sei dahingestellt. Tatsache ist allerdings, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zahlreiche unterschiedliche Zugänge zur deutschen Geschichte, zum Nationalsozialismus und zum Holocaust haben.
Somit stellt sich die Frage, mit welchen Methoden die dargestellten Herausforderungen im Geschichtsunterricht angegangen werden können.
Ausgehend von diesen Überlegungen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Frage, welche Bedeutung der Holocaust für Jugendliche aus Einwandererfamilien hat und wie diese zur Geschichte des Holocaust und des Nationalsozialismus stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung der NS-Geschichte und des Holocaust für Jugendliche aus Einwandererfamilien
- Zugänge zum Holocaust und historische Identitäten von Jugendlichen in der deutschen Einwanderungsgesellschaft
- Multiperspektivische Vermittlung des Holocaust und der NS-Zeit im Geschichtsunterricht
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Bedeutung der Holocaust für Jugendliche aus Einwandererfamilien hat und wie diese zur Geschichte des Holocaust und des Nationalsozialismus stehen. Die Arbeit analysiert die Zugänge dieser Jugendlichen zur deutschen Geschichte und untersucht, wie das Thema Holocaust im interkulturellen Geschichtsunterricht didaktisch vermittelt werden kann, um das Interesse der Jugendlichen zu wecken und ihnen einen besseren Zugang zu diesem Thema zu ermöglichen.
- Historische Identitäten und Zugänge von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Holocaust
- Herausforderungen in der Vermittlung des Holocaust im Geschichtsunterricht
- Möglichkeiten der multiperspektivischen Vermittlung des Holocaust
- Die Rolle von Geschichtsbewusstsein und historischer Bildung in der Einwanderungsgesellschaft
- Interkulturelle Ansätze im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Debatte um die Bedeutung des Holocaust für Jugendliche aus Einwandererfamilien in der deutschen Gesellschaft. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf das Thema beleuchtet, darunter die Perspektive von Pädagogen, Schülern mit Migrationshintergrund und die allgemeine Diskussion um Geschichtsbewusstsein in der Einwanderungsgesellschaft.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, welche Bedeutung die NS-Geschichte und der Holocaust für Jugendliche aus Einwandererfamilien hat. Es werden verschiedene Zugänge zu diesem Thema betrachtet, unter anderem die Schwierigkeiten, die viele junge Migranten bei der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte erleben. Die Arbeit analysiert auch die spezifischen Herausforderungen, die diese Jugendlichen bei der Bildung einer eigenen historischen Identität haben.
Im zweiten Teil des zweiten Kapitels werden didaktische Möglichkeiten der multiperspektivischen Vermittlung des Holocaust und der NS-Zeit im Geschichtsunterricht vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung einer interkulturellen Herangehensweise, die die unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven der Schüler berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Holocaust, NS-Zeit, Einwandererfamilien, Migrationshintergrund, Geschichtsbewusstsein, historische Identität, interkultureller Geschichtsunterricht, multiperspektivische Vermittlung, Didaktik, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat der Holocaust für Jugendliche mit Migrationshintergrund?
Für diese Jugendlichen ist der Zugang oft komplexer, da sie die NS-Geschichte nicht primär als Teil ihrer eigenen Familiengeschichte wahrnehmen, aber dennoch im deutschen Bildungssystem damit konfrontiert werden.
Warum fühlen sich viele Migranten vom klassischen Geschichtsunterricht nicht angesprochen?
Oftmals fehlen im Unterricht die spezifischen Migrationsgeschichten oder die Historie ihrer Herkunftsländer, was zu einem Anerkennungsproblem und Desinteresse führt.
Stimmt es, dass Jugendliche aus Einwandererfamilien oft antisemitisch reagieren?
Pädagogen berichten teilweise von solchen Vorfällen. Die Arbeit untersucht jedoch differenziert, inwiefern dies auf fehlendem Wissen, Provokation oder anderen kulturellen Einflüssen basiert.
Was ist eine „multiperspektivische Vermittlung“ des Holocaust?
Dies ist ein didaktischer Ansatz, der verschiedene Blickwinkel (z.B. Opfer, Täter, Mitläufer, aber auch internationale Perspektiven) einbezieht, um Schülern mit unterschiedlichen Hintergründen einen Zugang zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt die historische Identität in einer Einwanderungsgesellschaft?
Historische Bildung soll Jugendlichen helfen, sich als Teil der Gesellschaft zu begreifen. Dazu muss die Geschichte so vermittelt werden, dass sie für alle Bürger – unabhängig von ihrer Herkunft – relevant wird.
Wie kann interkultureller Geschichtsunterricht die Integration fördern?
Indem er gemeinsame Werte wie Menschenrechte und Demokratie anhand der Geschichte erarbeitet und dabei die Vielfalt der Erfahrungen im Klassenzimmer wertschätzt.
- Quote paper
- Matthias Mielich (Author), 2016, Die Bedeutung des Holocaust für Jugendliche aus Einwandererfamilien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345272