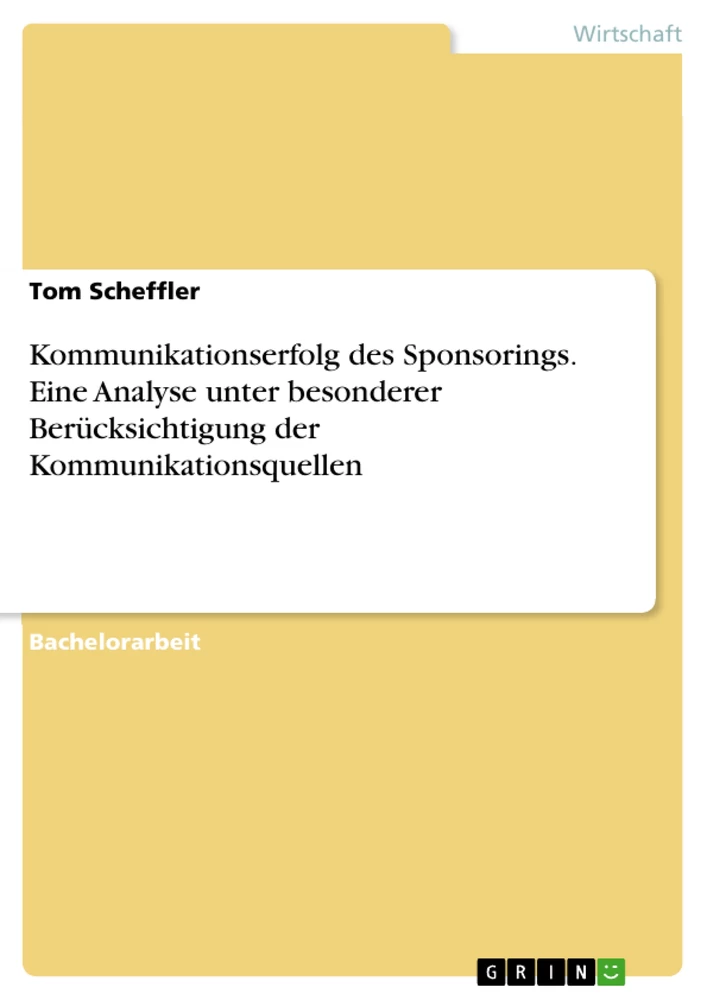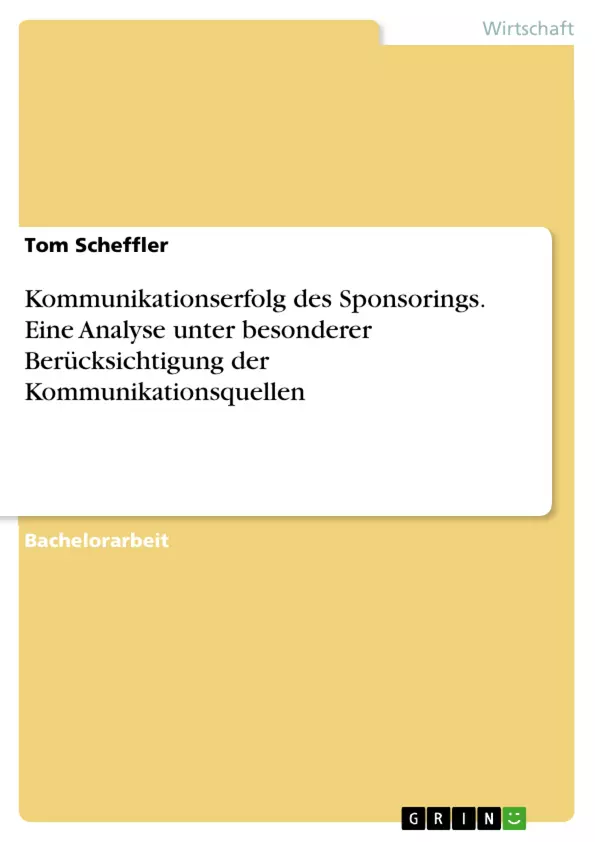Diese Arbeit setzt sich mit dem Kommunikationserfolg des Sponsorings unter besonderer Berücksichtigung der Kommunikationsquellen auseinander.
Kaum ein anderes Kommunikationsinstrument hat in den vergangenen Jahren so stark an Bedeutung gewonnen wie das Sponsoring. So stieg beispielsweise das Sponsoring-Gesamtvolumen in Deutschland von 2,7 Milliarden Euro im Jahre 2002 auf 4,2 Milliarden Euro im Jahre 2009. Doch was ist eigentlich unter dem Kommunikationsinstrument „Sponsoring“ zu verstehen, das heute sowohl in der Fachliteratur, als auch in den Marketingplänen vieler Unternehmen seinen festen Platz gefunden hat?
Bruhn versteht unter Sponsoring die „Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder Know-How durch Unternehmen und Institutionen zur Förderung von Personen und/oder Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und/oder den Medien unter vertraglicher Regelung der Leistung des Sponsors und Gegenleistung des Gesponserten verbunden sind, um damit gleichzeitig Ziele der Marketing- und Unternehmenskommunikation zu erreichen“ (2010, S.6f.). Weltweit widmen Unternehmen dem Sponsoring heute mehr denn je Aufmerksamkeit und Ressourcen. So verwundert es nicht, dass sich das weltweite Sponsoring-Volumen seit Mitte der 80er Jahre in etwa verfünffacht hat.
Diese enorme Entwicklung des Sponsoring-Gesamtvolumens ist vor allem auf die unverkennbaren Vorteile des Sponsorings gegenüber den anderen Kommunikationsinstrumenten in einem reizüberfluteten Kommunikationsmarkt und gegenüber „werbemüden“ Konsumenten zurückzuführen. Unternehmen sollten sich jedoch nicht für Sponsoring entscheiden, wenn sie nach einem Marketinginstrument suchen, mit dessen Hilfe sie ihren Absatz steigern können. Wenn überhaupt, ist Sponsoring nur hintergründig als Instrument zur Verkaufsförderung geeignet. Vielmehr liegen die Sponsoring-Ziele auf der psychografischen Ebene. In erster Linie erhoffen sich werbetreibende Unternehmen von einem Sponsoring-Engagement neben der Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Marke, auch einen „Imagetransfer“ , bei dem der Sponsor langfristig vom Image des Gesponserten profitiert.
Inhaltsverzeichnis
- Besonderheiten der Kommunikationsquelle im Sponsoring
- Das Glaubwürdigkeitskonzept als Grundlage für den Kommunikationserfolg im Sponsoring
- Definition der Glaubwürdigkeit
- Dimensionen und Wirkungsweise der Glaubwürdigkeit
- Informationsverarbeitung und Motivzuschreibungen zur Beurteilung einer persuasiven Botschaft
- Das Elaboration-Likelihood-Modell und das Persuasion-Knowledge-Modell als relevante Modelle der Informationsverarbeitung
- Die Attributionstheorie als weiterführende Grundlage
- Empirische Erkenntnisse zu den Wirkungsweisen von Quellen im Sponsoring
- Zusammenfassung der Erkenntnisse und Implikationen für Forschung und Praxis zur Erreichung der Sponsoring-Ziele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Kommunikationserfolg von Sponsoring-Engagements und analysiert die Rolle der Kommunikationsquelle in diesem Kontext. Dabei wird der Schwerpunkt auf das Konzept der Glaubwürdigkeit und seine Auswirkungen auf die Informationsverarbeitung und Motivzuschreibungen von Konsumenten gelegt.
- Die Bedeutung der Kommunikationsquelle im Sponsoring
- Das Konzept der Glaubwürdigkeit als Grundlage für den Kommunikationserfolg
- Die Rolle der Informationsverarbeitung und Motivzuschreibungen bei der Beurteilung von Werbebotschaften
- Empirische Erkenntnisse zu den Wirkungsweisen von Quellen im Sponsoring
- Implikationen für Forschung und Praxis zur Erreichung der Sponsoring-Ziele
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Besonderheiten der Kommunikationsquelle im Sponsoring und erläutert die Bedeutung dieses Instruments im heutigen Kommunikationsmarkt. Es werden verschiedene Definitionen des Sponsorings vorgestellt und die Vor- und Nachteile eines Sponsoring-Engagements aufgezeigt.
- Das zweite Kapitel widmet sich dem Glaubwürdigkeitskonzept und dessen Bedeutung für den Kommunikationserfolg im Sponsoring. Es werden die Definition, die Dimensionen und die Wirkungsweise der Glaubwürdigkeit diskutiert.
- Im dritten Kapitel werden Modelle der Informationsverarbeitung und Motivzuschreibungen betrachtet, die für die Beurteilung persuasiver Botschaften relevant sind. Das Elaboration-Likelihood-Modell und das Persuasion-Knowledge-Modell werden als relevante Frameworks vorgestellt, und die Attributionstheorie wird als weiterführende Grundlage erläutert.
- Das vierte Kapitel präsentiert empirische Erkenntnisse zu den Wirkungsweisen von Quellen im Sponsoring. Es werden Ergebnisse aus verschiedenen Studien zusammengefasst und analysiert, um die Bedeutung der Kommunikationsquelle im Kontext des Sponsoring zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Sponsoring, Kommunikationsquelle, Glaubwürdigkeit, Informationsverarbeitung, Motivzuschreibungen, Elaboration-Likelihood-Modell, Persuasion-Knowledge-Modell, Attributionstheorie, Empirische Forschung, Marketingkommunikation, Unternehmenskommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die wichtigste Voraussetzung für Sponsoringerfolg?
Die Glaubwürdigkeit der Kommunikationsquelle (des Sponsors und des Gesponserten) ist entscheidend für die Akzeptanz der Botschaft durch den Konsumenten.
Was versteht man unter einem Imagetransfer?
Imagetransfer bedeutet, dass positive Eigenschaften und Assoziationen des Gesponserten (z.B. Sportler) auf die Marke des Sponsors übertragen werden.
Was erklärt das Elaboration-Likelihood-Modell (ELM)?
Das ELM beschreibt zwei Wege der Informationsverarbeitung: den zentralen Weg (intensive Auseinandersetzung) und den peripheren Weg (Orientierung an Reizen wie Prominenz oder Sympathie).
Wie unterscheidet sich Sponsoring von klassischer Werbung?
Sponsoring wirkt oft indirekter und weniger aufdringlich, da es in einem emotionalen, nicht-kommerziellen Kontext (Sport, Kultur) stattfindet, was die Werbemüdigkeit der Konsumenten umgeht.
Welche Rolle spielt die Attributionstheorie im Sponsoring?
Die Attributionstheorie untersucht, welche Motive Konsumenten einem Sponsor unterstellen. Wird ein Sponsoring als rein kommerziell wahrgenommen, sinkt oft die Glaubwürdigkeit.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Tom Scheffler (Autor), 2012, Kommunikationserfolg des Sponsorings. Eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Kommunikationsquellen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345302