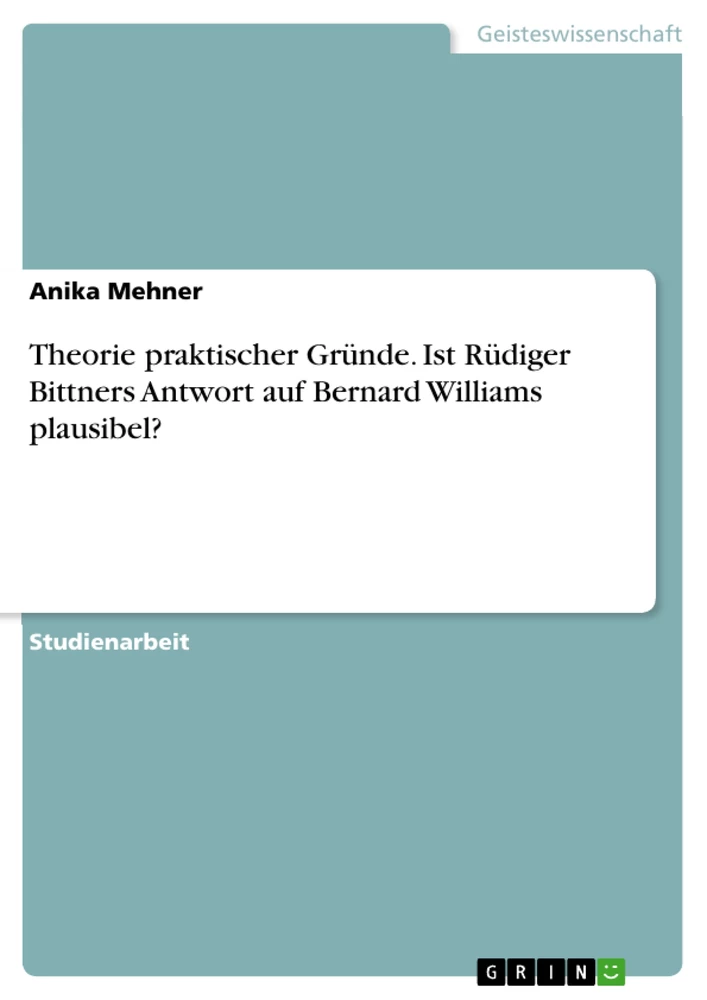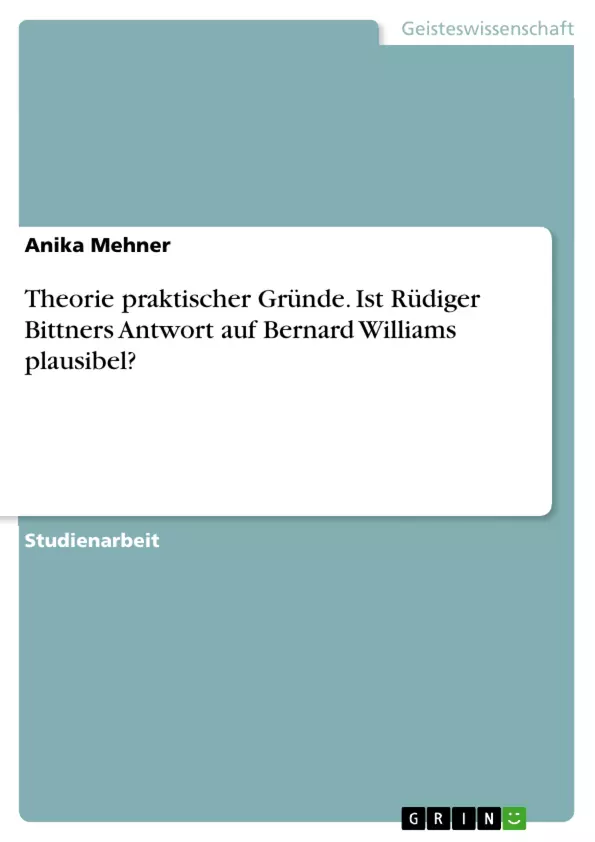Fragen, die unser Menschsein betreffen, gehen mit der Frage einher, wie wir leben sollen. In diesem Zusammenhang wird auch in der Geschichte der praktischen Philosophie versucht, die von Sokrates gestellte Frage „Was soll man tun?“ zu beantworten. Besonders Moralphilosophen sehen es als ihr Anliegen an, diese Frage zu interpretieren und eine Antwort zu finden. Man könnte die Frage, laut gängigen Interpretationen, als Frage interpretieren, zu welcher Handlung eine Person Grund hat. Diese Lesart impliziert, dass Gründe mit normativen Forderungen ungeachtet einer persönlichen Komponente einhergehen. Einen Grund zu einer Handlung haben hieße, eine Handlung auszuführen, die ausgeführt werden soll. In diesem Punkt gehen die Meinungen vieler Philosophen auseinander. Hinsichtlich dessen werden in der praktischen und in der Moralphilosophie Konzeptionen praktischer Gründe entworfen, welche versuchen, Fragen zu klären, wie: Welche Eigenschaften haben Gründe? Wie stehen sie in Verbindung zu rationalem Handeln und zu normativen oder moralischen Forderungen und Handlungen? Inwiefern spielen Motive bei Handlungen aus Gründen eine Rolle? Fest steht, dass eine Theorie praktischer Gründe, verstanden als Handlungsgründe, für eine Theorie rationalen Handelns und für eine Moraltheorie von Belang ist.
Hinsichtlich der Eigenschaften sind sich die meisten Philosophen darüber einig, dass praktischer Gründe normativ und motivierend sein müssen. Im Laufe der Zeit entwickelten sich drei Hauptströmungen, welche den beiden Eigenschaften ein unterschiedlich hohes Gehalt zukommen lassen. In der Arbeit soll vorerst auf die angenommenen Eigenschaften praktischer Gründe eingegangen sowie die drei Hauptströmungen von Konzeptionen praktischer Gründe kurz dargestellt werden. Im Anschluss daran werde ich die Frage stellen, ob Rüdiger Bittner der internalistischen Auffassung Bernard Williams` seine Ansicht glaubhaft entgegensetzen kann und welche Fragen für mich offen bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die normative und die motivierende Dimension von Gründen
- 2. Drei Theorien praktischer Gründe
- 3. Williams internalistische Konzeption
- 3.1. Williams Auffassung in: „Interne und externe Gründe“
- 3.1.1. Die Untersuchung interner Gründe
- 3.1.2. Die Untersuchung externer Gründe
- 3.2. Schlussbetrachtung
- 4. Bittners Konzeption
- 4.1. Bittners Auffassung in „Gründe und Motive“
- 4.2. Schlussbetrachtung
- Fazit und offene Fragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Rüdiger Bittners Antwort auf Bernard Williams' internalistische Konzeption praktischer Gründe plausibel ist. Die Arbeit analysiert zunächst die normative und motivierende Dimension von Gründen und stellt drei Hauptströmungen von Konzeptionen praktischer Gründe vor: den Humeanismus, den Kantianismus und den Aristotelismus. Anschließend wird Williams' internalistische Auffassung anhand seiner Ausführungen in „Interne und Externe Gründe“ dargestellt. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Bittners Konzeption, wie sie in „Gründe und Motive“ vorgestellt wird, Williams' Position erfolgreich in Frage stellen kann.
- Die normative und motivierende Dimension von Gründen
- Die drei Hauptströmungen von Konzeptionen praktischer Gründe (Humeanismus, Kantianismus, Aristotelismus)
- Bernard Williams' internalistische Konzeption praktischer Gründe
- Rüdiger Bittners Antwort auf Williams' Position
- Die Plausibilität von Bittners Argumentation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Arbeit vor, indem sie die Bedeutung von Gründen im Kontext der Frage „Was soll man tun?“ beleuchtet. Sie führt in die unterschiedlichen Interpretationen der Frage nach der Handlungsbegründung ein und zeigt die Relevanz von Theorien praktischer Gründe für eine Theorie rationalen Handelns und für eine Moraltheorie auf.
Das erste Kapitel geht auf die beiden Dimensionen von Gründen ein: die normative und die motivierende Dimension. Anhand eines Beispiels wird verdeutlicht, wie Gründe Handlungen rechtfertigen und gleichzeitig ihre Entstehung erklären können. Die Frage nach dem Verhältnis von normativen Forderungen und Motivation wird aufgeworfen und als zentrale Frage für die drei Hauptströmungen von Konzeptionen praktischer Gründe vorgestellt.
Das zweite Kapitel stellt kurz die drei Hauptströmungen von Konzeptionen praktischer Gründe dar: den Humeanismus, den Kantianismus und den Aristotelismus. Dabei wird auf die unterschiedlichen Auffassungen über die Relativität von Gründen und die Rolle der Vernunft im Kontext von Handeln aus Gründen eingegangen.
Das dritte Kapitel widmet sich Bernard Williams' internalistischer Konzeption praktischer Gründe. Es präsentiert seine Ausführungen in „Interne und Externe Gründe“ und untersucht seine Analyse interner und externer Gründe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema praktischer Gründe und beleuchtet die Konzeptionen von Bernard Williams und Rüdiger Bittner. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Handlungsgründe, normative und motivierende Dimension, Internalismus, Externalismus, Humeanismus, Kantianismus, Aristotelismus, Rationalität, Vernunft, Moraltheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Arbeit zu praktischen Gründen?
Die Arbeit untersucht die Plausibilität von Rüdiger Bittners Antwort auf Bernard Williams' internalistische Konzeption praktischer Gründe.
Welche zwei Dimensionen von Gründen werden unterschieden?
Es wird zwischen der normativen Dimension (Rechtfertigung einer Handlung) und der motivierenden Dimension (Erklärung der Entstehung einer Handlung) unterschieden.
Welche drei Hauptströmungen praktischer Gründe gibt es?
Die drei Hauptströmungen sind der Humeanismus, der Kantianismus und der Aristotelismus.
Was versteht Bernard Williams unter internen Gründen?
Williams' internalistische Auffassung besagt, dass Gründe für eine Handlung in direkter Verbindung zu den persönlichen Motiven und Wünschen einer Person stehen müssen.
Warum ist die Theorie praktischer Gründe für die Moraltheorie wichtig?
Sie klärt, wie normative Forderungen und moralische Handlungen mit rationalem Handeln und persönlichen Motiven verknüpft sind.
- Arbeit zitieren
- Anika Mehner (Autor:in), 2015, Theorie praktischer Gründe. Ist Rüdiger Bittners Antwort auf Bernard Williams plausibel?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345332