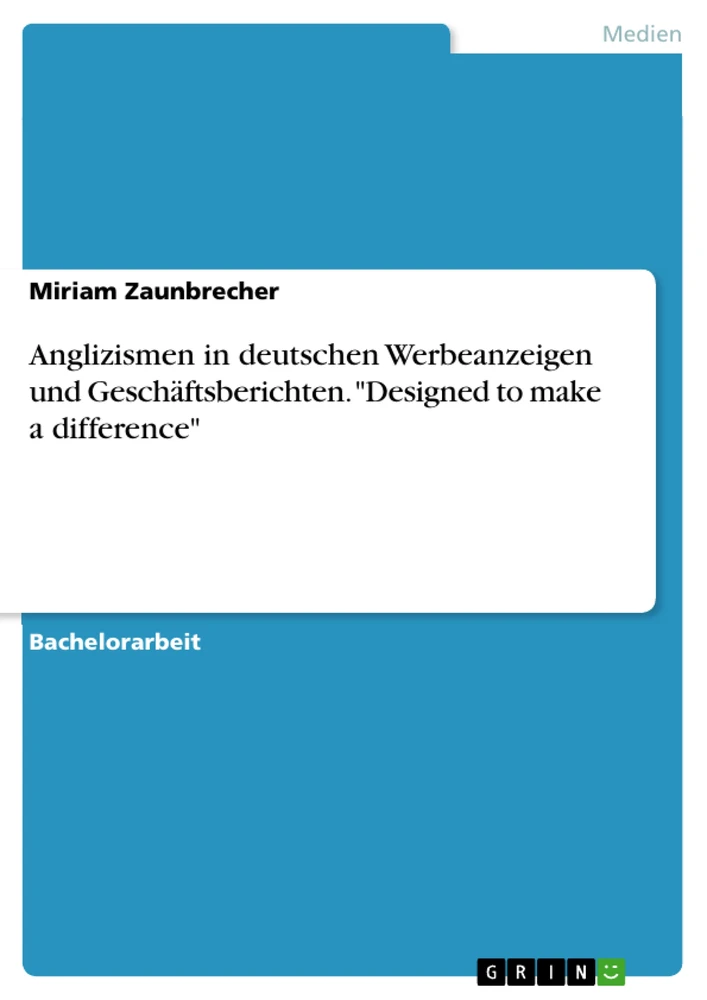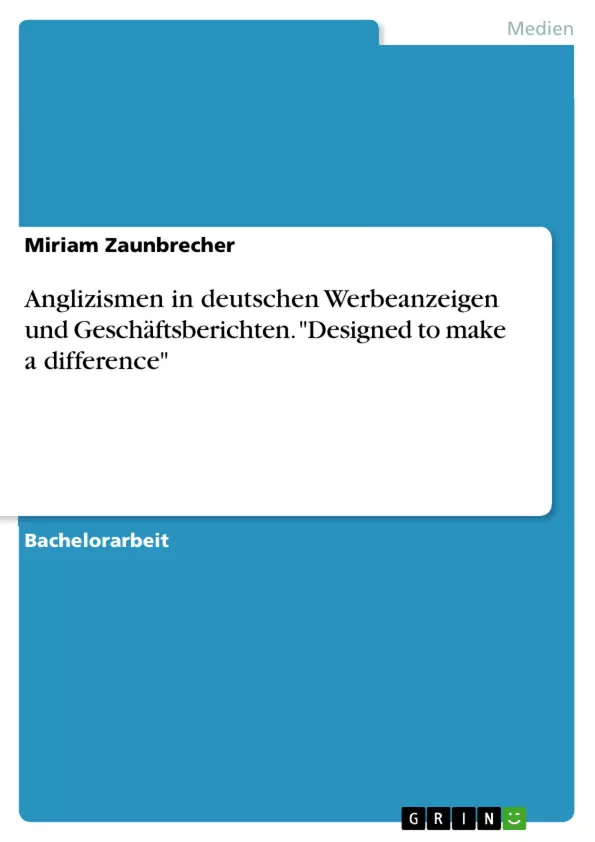Werbung ist allgegenwärtig. Egal ob im Fernsehen, im Radio, in der Öffentlichkeit, in Zeitschriften oder im Internet. Es gibt kaum eine Möglichkeit, sich ihr zu entziehen - schließlich nehmen wir über einen Tag verteilt durch die verschiedensten Medien rund 3000 Werbebotschaften auf, wobei nicht alles davon tatsächlich verarbeitet wird. Mit Werbung verbinden viele Menschen im Allgemeinen etwas Negatives und Störendes. Durch sie werden spannende Filme im Fernsehen unterbrochen, das Lieblingslied im Radio wird verkürzt, um einen Werbespot abzuspielen, und im Briefkasten landet regelmäßig eine große Menge an Werbeflyern und Prospekten, sofern kein „Werbung verboten“-Schild angebracht ist. Werbung muss aber nicht zwangsläufig negativ sein. Sie bietet die Möglichkeit, sich über Produkte und Angebote zu informieren, den besten Preis herauszufinden, und sie kann uns in unserer Kaufentscheidung beeinflussen.
Bei der immer weiter steigenden Anzahl an Werbetreibenden wird es für den Einzelnen jedoch immer schwieriger, aus der Masse herauszustechen und von möglichst vielen Verbrauchern wahrgenommen zu werden. Daher ist es für die Werbetreibenden unverzichtbar, auf gute Werbung zu setzen, die die potenziellen Konsumenten nicht verschreckt, sondern Aufmerksamkeit erregt und positive Gefühle auslöst. Um diese Effekte zu erzielen, machen sich die Firmen Anglizismen zu Nutze.
Ziel der Arbeit ist daher, einen Überblick über den Gebrauch von Anglizismen in der Verbindung mit Werbung zu schaffen und dabei auf die Veränderungen innerhalb der Genres der Anzeigenwerbung und der Geschäftsberichte Bezug zu nehmen. Dies geschieht anhand der Auswertung von Werbeanzeigen deutscher Autohersteller im SPIEGEL- Magazin und den Vergleich der Veränderungen in Anteil und Art der fremdsprachigen Elemente in einer Zeitspanne von 29 Jahren anhand zweier Geschäftsberichte des Unternehmens Daimler-Benz, unter dem Gesichtspunkt verschiedener Thesen, die in dem entsprechenden Kapitel vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Anglizismen
- 2.1 Definition
- 2.2 Lehnwort und Fremdwort
- 2.3 Scheinentlehnung
- 2.4 Mischform
- 3. Wie viel Englisch braucht das Deutsche?
- 3.1 Bedürfniswörter
- 3.2 Luxuswörter
- 4. Werbung und Werbesprache
- 4.1 Etymologie
- 4.2 Elemente der Werbung
- 4.3 Slogan
- 4.4 Marken(-name)
- 4.5 Bilder
- 4.6 Text
- 4.7 Funktion des Markenimages
- 5. Werbung als Kommunikationsform
- 6. Funktionen von Anglizismen in der Werbung
- 6.1 Notwendigkeit/Sprachökonomie
- 6.2 Lokalkolorit
- 6.3 Auffälligkeit/Aufwertung
- 6.4 Verschleierung/Euphemismus
- 6.5 Ausdrucksvariation
- 7. Automobilwerbung
- 8. Englisch in Werbeanzeigen mit SPIEGEL Untersuchung
- 8.1 SPIEGEL Anzeigen Untersuchung
- 8.1.1 1986 Ausgabe 3 vom 13. Januar
- 8.1.2 1996 Ausgabe 3 vom 15. Januar
- 8.1.3 2006 Ausgabe 4 vom 23. Januar
- 8.1.4 2016 Ausgabe 9 vom 27. Februar
- 8.2 Fazit
- 8.1 SPIEGEL Anzeigen Untersuchung
- 9. Geschäftsberichte
- 9.1 Funktion und Sprache des Geschäftsberichts
- 9.2 Englisch in Geschäftsberichten
- 10. Untersuchung der Geschäftsberichte von Daimler-Benz
- 11. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Gebrauch von Anglizismen in deutscher Werbung und Geschäftsberichten. Ziel ist es, einen Überblick über die Verwendung und die Veränderungen im Gebrauch von Anglizismen in Anzeigen und Geschäftsberichten über einen längeren Zeitraum zu geben. Die Arbeit analysiert dabei die Funktionen von Anglizismen im Kontext der jeweiligen Textsorten.
- Verwendung von Anglizismen in deutscher Werbung
- Veränderung des Anglizismengebrauchs über die Zeit
- Funktionen von Anglizismen (z.B. Sprachökonomie, Auffälligkeit)
- Anglizismen in Automobilwerbung
- Anglizismen in Geschäftsberichten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Allgegenwart von Werbung und die zunehmende Schwierigkeit für Werbetreibende, sich von der Masse abzuheben. Sie führt das Thema Anglizismen in der Werbung ein und benennt das Ziel der Arbeit: die Untersuchung des Gebrauchs von Anglizismen in Anzeigen und Geschäftsberichten und deren Veränderungen über die Zeit. Die Arbeit wird durch die Analyse von Werbeanzeigen und Geschäftsberichten von Daimler-Benz empirisch untermauert.
2. Anglizismen: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Anglizismus" und differenziert zwischen Lehnwörtern, Fremdwörtern und Scheinentlehnungen. Es werden verschiedene Formen der Anglizismen-Integration in die deutsche Sprache erläutert.
3. Wie viel Englisch braucht das Deutsche?: Dieses Kapitel thematisiert die Frage nach dem notwendigen Umfang an englischen Wörtern im Deutschen und unterscheidet zwischen Bedürfnis- und Luxuswörtern im Kontext der Werbe- und Geschäftssprache.
4. Werbung und Werbesprache: Hier werden die Elemente der Werbung (Slogan, Markenname, Bilder, Text etc.) und deren Zusammenspiel im Hinblick auf die Verwendung von Anglizismen untersucht. Die etymologischen Aspekte von Anglizismen und ihre Funktion im Markenimage werden ebenfalls beleuchtet.
5. Werbung als Kommunikationsform: Dieses Kapitel betrachtet Werbung aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive und analysiert die Rolle von Anglizismen im Rahmen von Werbebotschaften und deren Wirkung auf den Rezipienten.
6. Funktionen von Anglizismen in der Werbung: Dieses Kapitel erörtert die verschiedenen Funktionen von Anglizismen in der Werbung, darunter die Notwendigkeit aus Gründen der Sprachökonomie, die Schaffung von Lokalkolorit, die Steigerung der Auffälligkeit und Aufwertung, die Verschleierung/Euphemismus und die Erweiterung der Ausdrucksvielfalt.
7. Automobilwerbung: Dieses Kapitel fokussiert auf die Verwendung von Anglizismen in der Automobilwerbung und analysiert spezifische Beispiele und Trends.
8. Englisch in Werbeanzeigen mit SPIEGEL Untersuchung: Dieses Kapitel analysiert den Gebrauch von Anglizismen in Werbeanzeigen des SPIEGEL-Magazins über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, um die Entwicklung und Veränderung im Gebrauch zu dokumentieren. Die Analyse wird mit konkreten Beispielen aus verschiedenen Ausgaben untermauert.
9. Geschäftsberichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Funktion und Sprache von Geschäftsberichten und untersucht die Verwendung von Anglizismen in diesem Kontext.
10. Untersuchung der Geschäftsberichte von Daimler-Benz: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse der Verwendung von Anglizismen in Geschäftsberichten des Unternehmens Daimler-Benz, vergleicht verschiedene Zeiträume und analysiert die Veränderungen im Gebrauch.
Schlüsselwörter
Anglizismen, Werbung, Geschäftsberichte, Markensprache, Sprachökonomie, Kommunikation, Automobilindustrie, Daimler-Benz, SPIEGEL-Magazin, Lehnwörter, Fremdwörter, Scheinentlehnung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Anglizismen in deutscher Werbung und Geschäftsberichten
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Gebrauch von Anglizismen in deutscher Werbung und in Geschäftsberichten. Sie analysiert die Verwendung und die Veränderungen im Gebrauch von Anglizismen über einen längeren Zeitraum und beleuchtet deren Funktionen im jeweiligen Kontext.
Welche Bereiche werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Definition von Anglizismen (inkl. Lehnwörtern, Fremdwörtern und Scheinentlehnungen), die Untersuchung des Umfangs englischen Vokabulars im Deutschen (Bedürfnis- vs. Luxuswörter), eine Analyse von Werbung und Werbesprache (inkl. Slogans, Marken, Bildern und Texten), eine kommunikationswissenschaftliche Betrachtung von Werbung, eine detaillierte Erörterung der Funktionen von Anglizismen in der Werbung (z.B. Sprachökonomie, Auffälligkeit, Euphemismus), eine Fokussierung auf Automobilwerbung, eine Analyse von Anglizismen in Werbeanzeigen des SPIEGEL-Magazins über mehrere Jahrzehnte, eine Untersuchung der Funktion und Sprache von Geschäftsberichten, sowie eine detaillierte Analyse der Anglizismen in Geschäftsberichten von Daimler-Benz.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Analyse von Werbeanzeigen und Geschäftsberichten, insbesondere von Daimler-Benz und dem SPIEGEL-Magazin. Die Analyse umfasst einen Vergleich über verschiedene Zeiträume, um Veränderungen im Anglizismengebrauch aufzuzeigen.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Untersuchung der SPIEGEL-Werbeanzeigen umfasst die Ausgaben von 1986, 1996, 2006 und 2016, um den Wandel des Anglizismengebrauchs über mehrere Jahrzehnte zu belegen. Auch die Analyse der Daimler-Benz Geschäftsberichte erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, der jedoch nicht genau spezifiziert ist.
Welche konkreten Fragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht, wie Anglizismen in der deutschen Werbung und in Geschäftsberichten verwendet werden, wie sich dieser Gebrauch im Laufe der Zeit verändert hat, welche Funktionen Anglizismen in diesen Kontexten erfüllen (z.B. Sprachökonomie, Auffälligkeit, Image-Aufwertung, Euphemismus), und ob es Unterschiede im Anglizismengebrauch zwischen verschiedenen Branchen (z.B. Automobilindustrie) gibt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hauptquellen der Arbeit sind Werbeanzeigen des SPIEGEL-Magazins und Geschäftsberichte von Daimler-Benz. Zusätzlich wird die Arbeit auf theoretischen Grundlagen zur Linguistik, Werbewissenschaft und Kommunikationswissenschaft basieren.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit (in Kurzfassung)?
Die Arbeit wird einen Überblick über die Verwendung von Anglizismen in der deutschen Werbung und in Geschäftsberichten geben und deren Veränderungen über die Zeit aufzeigen. Die Analyse wird die unterschiedlichen Funktionen von Anglizismen in diesen Kontexten beleuchten und möglicherweise Branchentrends aufzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Anglizismen, Werbung, Geschäftsberichte, Markensprache, Sprachökonomie, Kommunikation, Automobilindustrie, Daimler-Benz, SPIEGEL-Magazin, Lehnwörter, Fremdwörter, Scheinentlehnung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Kommunikationswissenschaftler, Werbefachleute und alle, die sich für die Entwicklung der deutschen Sprache und den Einfluss des Englischen interessieren.
- Quote paper
- Miriam Zaunbrecher (Author), 2016, Anglizismen in deutschen Werbeanzeigen und Geschäftsberichten. "Designed to make a difference", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345339