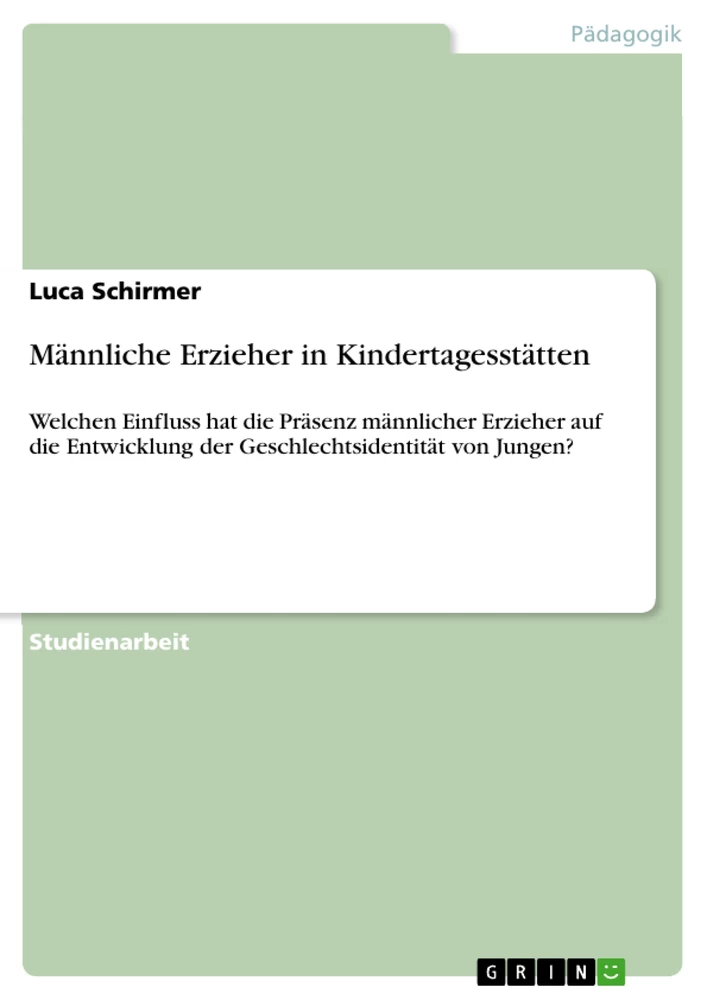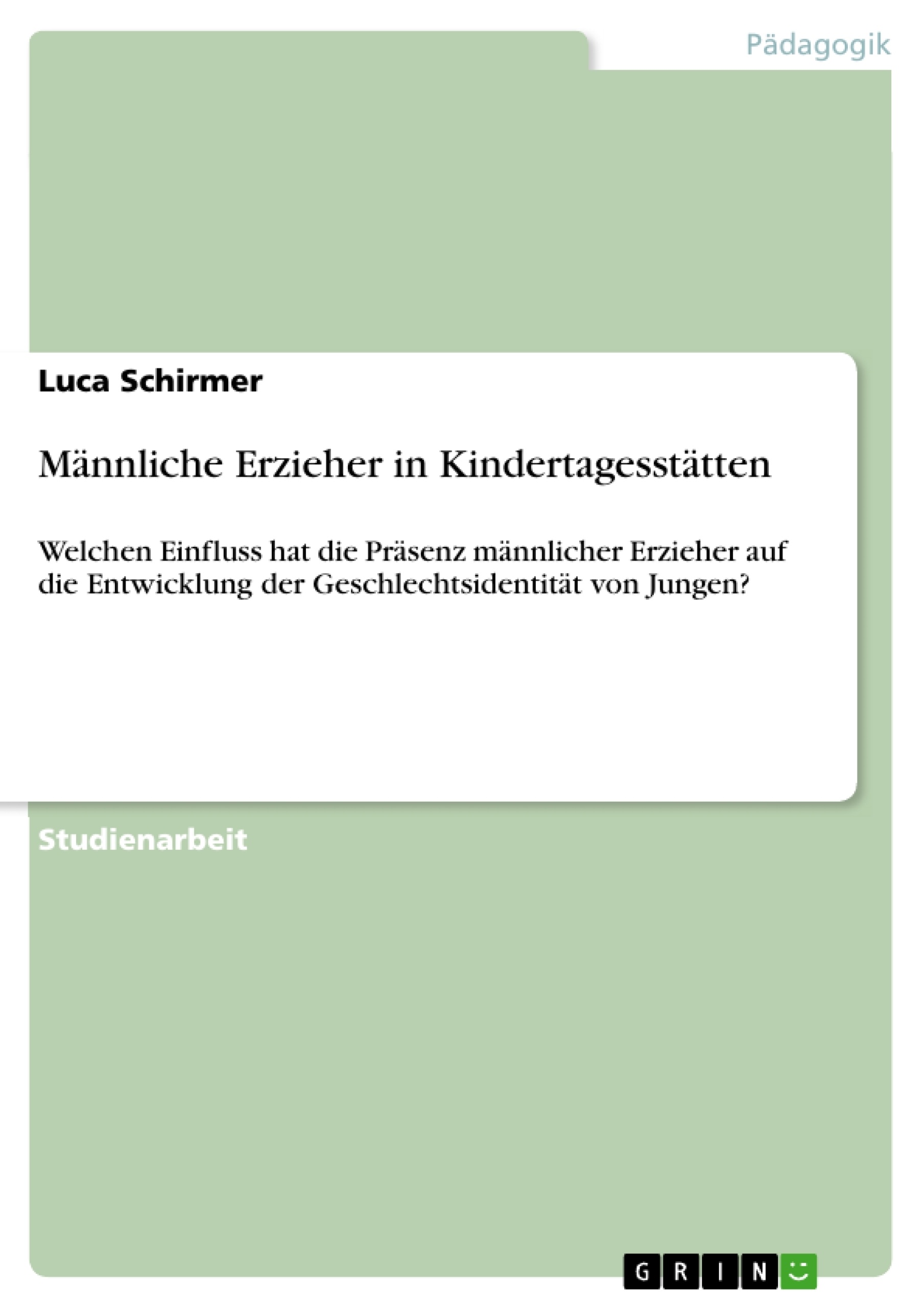Kindertagesstätten (Kitas) sind Orte, die von weiblichen Erzieherinnen dominiert werden. Nur ein Bruchteil des Fachpersonals ist männlich. Es gibt also fast keine Männer, die sich für die Arbeit als Erzieher in Kitas entscheiden. Doch warum ist das so? Wenn es nach dem Wunsch unterschiedlichster Institutionen, wie dem BMFSFJ ginge, würde sich dies ändern. Die Forderung nach mehr Männern in Kitas ist seit einiger Zeit sehr populär und wird immer wieder geäußert. Auch medial wird das Thema regelmäßig aufgegriffen (Buschmeyer 2013 S.41ff.).
Zum Beispiel titelte DIE ZEIT „Männer für Kitas gesucht“ (Michael Klitzsch 2012). Doch warum sollten Männer in Kitas arbeiten? Wofür brauchen wir sie? Hat es nicht viele Jahre auch ohne sie funktioniert? Das sind Fragen, die in der Diskussion zu Männern in Kitas fast nie thematisiert werden. Es wird selten versucht argumentativ darzulegen, welchen Mehrwert männliche Erzieher für die Einrichtung Kita und die Entwicklung von Kindern hätten. Die Beantwortung dieser Fragen sollte jedoch zentral sein, um die Forderung begründen zu können. Dies fällt allerdings besonders schwer, weil es so gut wie keine wissenschaftlichen Studien zu diesem Thema gibt. Empirische Belege dazu, welche Veränderungen durch Männer entstehen könnten, fehlen. Deshalb fußt die Behauptung, dass männliche Erzieher Sozialisationsvorteile brächten, ausschließlich auf einem populären, auf augenscheinlichen Selbstverständlichkeiten beruhenden nicht belegbaren Verständnis (Buschmeyer 2013 S.41ff.). Auf andere Argumente, wie dass beispielsweise mehr Personal benötigt werde und dieses nicht allein durch Frauen abgedeckt werden könne, gehe ich an dieser Stelle nicht weiter ein, da vor allem immer vorangestellt wird, dass Erzieher positive Auswirkungen auf Kinder hätten (Cremers und Krabel 2015 S.9).
Diese Arbeit versucht Fragen positiver Entwicklungen, die durch männliche Erzieher entstehen könnten, zu beantworten. Es geht mir darum zu analysieren, wie sich das Vorhandensein männlicher Erzieher in Kitas auf die Bildung der Geschlechtsidentität von Jungen auswirken kann. Aufgrund des Umfangs der Arbeit ist es nicht möglich auf weiterführende Sozialisationsfragen einzugehen oder noch einen Blick auf die Entwicklung von Mädchen zu werfen. Dabei muss diese Arbeit aufgrund des Mangels an Studien ohne direkt auf die Kita bezogene empirische Belege auskommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Männer in Kindertagesstätten
- 2.1 Wenige Männer im Erzieherberuf in Kitas
- 2.2 Forderung nach mehr Männern in Kitas
- 3. Sozialisationstheoretische Grundlagen
- 3.1 Geschlecht als soziales Konstrukt und Produkt der Sozialisation
- 3.2 Bildung der Geschlechtsidentität bei Jungen
- 4. Alternative Männlichkeit bei Erziehern
- 5. Auswirkungen durch männliche Erzieher
- 5.1 Befriedigung des Bedürfnisses nach einer männlichen Identifikationsfigur
- 5.2 Förderung der Eigenschaften und Interessen von Jungen
- 5.3 Erzieher als alternatives Rollenvorbild
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss männlicher Erzieher in Kindertagesstätten auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Jungen. Sie analysiert die geringe Anzahl männlicher Erzieher, die gesellschaftlichen Forderungen nach mehr männlichem Personal und die theoretischen Grundlagen der Geschlechtsidentitätsbildung. Die Arbeit fokussiert auf die potenziellen positiven Auswirkungen männlicher Erzieher als Rollenvorbilder und ihre Beiträge zur Förderung der Entwicklung von Jungen.
- Der Mangel an männlichen Erziehern in deutschen Kindertagesstätten
- Die gesellschaftliche Forderung nach mehr männlichen Erziehern und die dahinterstehenden Argumente
- Sozialisationstheoretische Grundlagen der Geschlechtsidentitätsbildung bei Jungen
- Das Potenzial männlicher Erzieher als alternative Rollenvorbilder
- Der Einfluss männlicher Erzieher auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Jungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss männlicher Erzieher auf die Geschlechtsidentitätsbildung von Jungen in den Mittelpunkt. Sie hebt den Mangel an empirischen Studien zu diesem Thema hervor und begründet die Notwendigkeit der Untersuchung. Die Arbeit konzentriert sich auf Kinder im Vorschulalter und räumt aufgrund des Umfangs weitere Sozialisationsfragen und die Entwicklung von Mädchen aus. Die Kapitelfolge wird skizziert, wobei die theoretischen Grundlagen und die potenziellen positiven Auswirkungen männlicher Erzieher im Fokus stehen.
2. Männer in Kindertagesstätten: Dieses Kapitel beleuchtet die geringe Anzahl männlicher Erzieher in Kindertagesstätten (Kitas) in Deutschland. Es beschreibt den Ist-Zustand, wobei der Anteil männlicher Erzieher im pädagogischen Fachpersonal bei nur 2,4% liegt. Die Ursachen für dieses Ungleichgewicht werden in gesellschaftlichen Stereotypen und der Konstruktion des Erzieherberufs als weiblich gesehen. Zusätzlich werden Faktoren wie mangelndes Ansehen, Bezahlung und Aufstiegschancen sowie der implizite Verdacht der Pädosexualität als abschreckende Faktoren für Männer genannt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der seltenen Präsenz männlicher Bezugspersonen für Jungen und dem daraus resultierenden Mangel an gleichgeschlechtlichen Rollenvorbildern in Kitas.
3. Sozialisationstheoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung dar. Es behandelt das Geschlecht als soziales Konstrukt und Produkt der Sozialisation und erläutert die Bildung der Geschlechtsidentität bei Jungen. Es wird auf die Bedeutung von Rollenvorbildern und der Sozialisation durch die Umwelt eingegangen, um den theoretischen Rahmen für die Analyse der Auswirkungen männlicher Erzieher zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Erklärung der Entwicklung von Geschlechtsidentität im Kontext der gesellschaftlichen Normen und Erwartungen.
4. Alternative Männlichkeit bei Erziehern: Dieses Kapitel dürfte sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit das Männlichkeitsbild von Erziehern von gesellschaftlichen Stereotypen abweicht. Es wird analysieren, ob und wie männliche Erzieher alternative Männlichkeitsbilder präsentieren und ob diese von den Kindern wahrgenommen und internalisiert werden. Das Kapitel liefert somit die Brücke zwischen der theoretischen Grundlage und den praktischen Auswirkungen von männlichen Erziehern.
5. Auswirkungen durch männliche Erzieher: In diesem Kapitel wird der Zusammenhang zwischen den theoretischen Vorannahmen und dem Potenzial männlicher Erzieher hergestellt. Es werden die potenziellen positiven Auswirkungen auf die Entwicklung von Jungen diskutiert, zum Beispiel die Vorbildfunktion, die Förderung der Interessen von Jungen und die Möglichkeit, Alternativen zum gesellschaftlichen Geschlechtsstereotyp anzubieten. Es werden wahrscheinlich die positiven Aspekte des Einflusses von männlichen Bezugspersonen auf Jungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Männliche Erzieher, Kindertagesstätten, Geschlechtsidentität, Jungen, Sozialisation, Rollenvorbilder, Geschlechterstereotypen, Männlichkeit, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss männlicher Erzieher auf die Geschlechtsidentität von Jungen
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss männlicher Erzieher in Kindertagesstätten auf die Entwicklung der Geschlechtsidentität von Jungen. Sie analysiert den Mangel an männlichen Erziehern, die gesellschaftlichen Forderungen nach mehr männlichem Personal und die theoretischen Grundlagen der Geschlechtsidentitätsbildung. Der Fokus liegt auf den potenziellen positiven Auswirkungen männlicher Erzieher als Rollenvorbilder und ihren Beitrag zur Entwicklung von Jungen.
Wie viele Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit umfasst sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Kapitel 2 (Männer in Kindertagesstätten) beleuchtet den Mangel an männlichen Erziehern in Deutschland und die gesellschaftlichen Ursachen dafür. Kapitel 3 (Sozialisationstheoretische Grundlagen) behandelt die theoretischen Grundlagen der Geschlechtsidentitätsbildung. Kapitel 4 (Alternative Männlichkeit bei Erziehern) untersucht, inwieweit männliche Erzieher alternative Männlichkeitsbilder präsentieren. Kapitel 5 (Auswirkungen durch männliche Erzieher) diskutiert die positiven Auswirkungen männlicher Erzieher auf die Entwicklung von Jungen. Kapitel 6 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Warum ist der Mangel an männlichen Erziehern ein Problem?
Der geringe Anteil männlicher Erzieher (nur 2,4%) führt zu einem Mangel an männlichen Bezugspersonen für Jungen und somit an gleichgeschlechtlichen Rollenvorbildern in Kitas. Gesellschaftliche Stereotype und Faktoren wie mangelndes Ansehen, Bezahlung und Aufstiegschancen tragen zu diesem Ungleichgewicht bei.
Welche sozialisationstheoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Geschlecht als soziales Konstrukt und Produkt der Sozialisation und erläutert die Bildung der Geschlechtsidentität bei Jungen. Die Bedeutung von Rollenvorbildern und der Sozialisation durch die Umwelt wird hervorgehoben.
Welche potenziellen positiven Auswirkungen haben männliche Erzieher?
Männliche Erzieher können als alternative Rollenvorbilder dienen, die Interessen von Jungen fördern und zur Entwicklung einer gesunden Geschlechtsidentität beitragen. Sie können das Bedürfnis nach einer männlichen Identifikationsfigur befriedigen und Alternativen zu gesellschaftlichen Geschlechtsstereotypen anbieten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Männliche Erzieher, Kindertagesstätten, Geschlechtsidentität, Jungen, Sozialisation, Rollenvorbilder, Geschlechterstereotypen, Männlichkeit, empirische Forschung.
Welche Altersgruppe wird in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Kinder im Vorschulalter.
Gibt es empirische Daten in der Arbeit?
Die Zusammenfassung erwähnt den Anteil männlicher Erzieher (2,4%) als empirischen Befund. Der Umfang möglicher weiterer empirischer Daten wird in der Zusammenfassung nicht detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Luca Schirmer (Author), 2016, Männliche Erzieher in Kindertagesstätten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345350