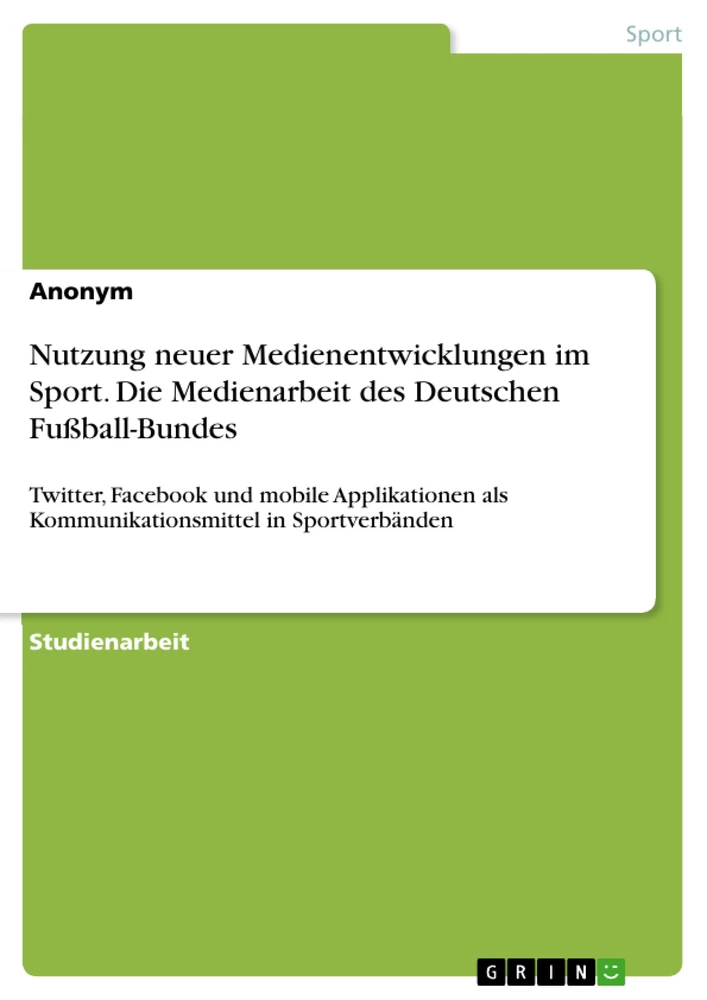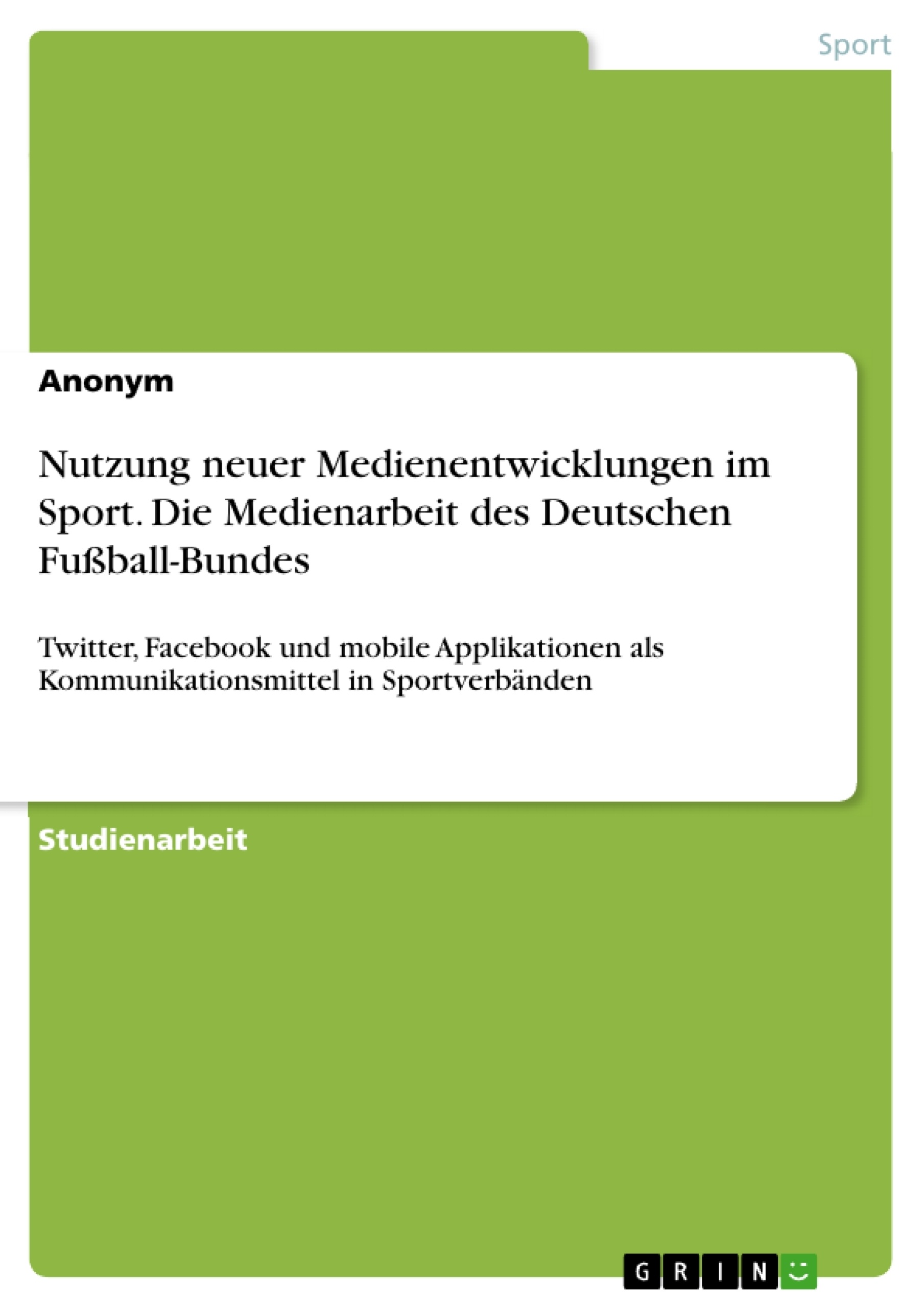Genau wie Twitter stellt das soziale Netzwerk Facebook eine relativ neue Form der computervermittelten Kommunikation dar, das nicht nur von Privatpersonen, sondern auch vermehrt von Personen des öffentlichen Lebens, Unternehmen oder Verbänden genutzt wird. Auch prominente Sportler, Funktionäre, Trainer, Sportvereine, Sportverbände und Sportunternehmen greifen den Trend auf und nutzen verstärkt die Möglichkeiten und Plattformen des Web 2.0 zur Kommunikation.
Welch große Resonanz eine derartige Präsenz in webbasierten Netzwerken nach sich ziehen kann, belegen nicht nur die Klickzahlen, sondern auch die massenmediale Berichterstattung über einzelne Internetaktivitäten, wie jüngst das Beispiel Felix Magath zeigte. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 erstellte auf Facebook eine eigene Seite, auf der er sich zur aktuellen sportlichen Lage äußert und mit Fans ins Gespräch kommen will. Verschiedene Medien griffen die Profilerstellung Magaths auf und berichteten teilweise fortwährend über die Entwicklung der Zahlen von Facebook-Fans und die virtuellen Aktivitäten des Trainers.
Während Magath indes als Einzelperson im Internet auftritt und den Verein und Arbeitgeber indirekt repräsentiert, verfolgen Sportverbände eine ganzheitliche Präsentation.
Am Beispiel der Medienaktivitäten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) soll in dieser Arbeit gezeigt werden, wie Sportverbände neue Medienentwicklungen für ihre Kommunikation nutzen. Zentrale Fragestellungen, die hier beleuchtet werden sollen, sind:
(1) Welche Chancen bieten neue Medienentwicklungen Sportverbänden wie dem DFB bei der Kommunikation?
(2) Inwieweit können neue Medienentwicklungen Kommunikationsbarrieren (im Sinne von fehlenden Rückkopplungsmöglichkeiten) zwischen Verband und Fan/Rezipient abbauen?
(3) Sind die Absichten der Kommunikatoren über neue Medien realisierbar und welches Risiko besteht bei der Vermittlung von Informationen über neue Kanäle?
Zur Bearbeitung der Fragen soll zunächst anhand bisheriger Arbeiten zu diesem Thema eine theoretische Verortung vorgenommen werden. Ferner werden Charakteristika ausgemacht, welche die Online-Kommunikation über Twitter und Facebook allgemein auszeichnen und wie im Speziellen Verbände neue Medienentwicklungen nutzen. Im zweiten Hauptteil wird dann die Nutzung von Twitter, Facebook und mobilen Applikationen des Deutschen Fußball-Bundes betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Themeneinleitung und Fragestellungen
- Sportverband 2.0 – Nutzung von neuen Medienentwicklungen
- Der Begriff Web 2.0 und neue Kommunikationsmöglichkeiten
- Internet als Sportmedium
- Verbandskommunikation im Internet
- Nutzung von Web 2.0-Technologien
- Verfolgte Ziele und Vorteile bei der Nutzung von Web 2.0-Angeboten
- Risiken bei der Nutzung von Web 2.0-Angeboten
- Neue Medienentwicklungen beim Deutschen Fußball-Bund
- Mobile Applikation
- Zusammenfassung und Fazit
- Kritische Betrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Nutzung neuer Medienentwicklungen im Sport, insbesondere mit Twitter, Facebook und mobilen Applikationen als Kommunikationsmittel in Sportverbänden. Am Beispiel der Medienarbeit des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird analysiert, welche Chancen und Risiken diese Medien für Sportverbände bieten.
- Chancen und Möglichkeiten neuer Medien für die Kommunikation von Sportverbänden
- Abbau von Kommunikationsbarrieren zwischen Verband und Fans
- Bewertung der Realisierbarkeit von Kommunikationszielen und Risiken der Informationsvermittlung
- Analyse der Nutzung von Twitter, Facebook und mobilen Applikationen durch den DFB
- Zusammenfassung der Ergebnisse und kritische Betrachtung der neuen Medienlandschaft im Sport
Zusammenfassung der Kapitel
- Themeneinleitung und Fragestellungen: Die Einleitung stellt die Relevanz der Nutzung neuer Medien im Sport heraus und erläutert die Fragestellungen der Arbeit, die sich auf die Chancen, Risiken und die Realisierbarkeit der Kommunikationsziele von Sportverbänden im digitalen Raum konzentrieren.
- Sportverband 2.0 – Nutzung von neuen Medienentwicklungen: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel des Internets im Kontext von Web 2.0, die Entstehung von Communities und sozialen Netzwerken und die wachsende Bedeutung neuer Medien für Sportverbände.
- Neue Medienentwicklungen beim Deutschen Fußball-Bund: Dieses Kapitel analysiert die Nutzung von Twitter, Facebook und mobilen Applikationen durch den DFB. Es zeigt die spezifischen Möglichkeiten und Herausforderungen der jeweiligen Medienplattform auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themengebiete Web 2.0, soziale Netzwerke, Micro-Blogging, mobile Applikationen, Sportkommunikation, Sportverbände, Deutscher Fußball-Bund, Twitter, Facebook, Chancen und Risiken der neuen Medien.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzt der DFB soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter?
Der DFB nutzt diese Plattformen zur direkten Kommunikation mit Fans, zur Berichterstattung in Echtzeit und zum Abbau von Kommunikationsbarrieren.
Welche Chancen bietet das Web 2.0 für Sportverbände?
Es ermöglicht Interaktivität, Rückkopplungsmöglichkeiten durch die Fans und eine ganzheitliche Präsentation des Verbandes jenseits klassischer Medien.
Welche Risiken bestehen bei der Online-Kommunikation?
Risiken sind der Kontrollverlust über Informationen, mögliche "Shitstorms" und die Herausforderung, die Authentizität des Verbandes zu wahren.
Was war das Beispiel Felix Magath in diesem Kontext?
Magath nutzte Facebook als Einzelperson zur Kommunikation, was eine enorme massenmediale Resonanz auslöste und den Trend zur direkten Interaktion verdeutlichte.
Setzt der DFB auch auf mobile Applikationen?
Ja, mobile Apps sind ein zentraler Bestandteil der Medienstrategie, um Informationen jederzeit und überall für die Rezipienten bereitzustellen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Nutzung neuer Medienentwicklungen im Sport. Die Medienarbeit des Deutschen Fußball-Bundes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345400