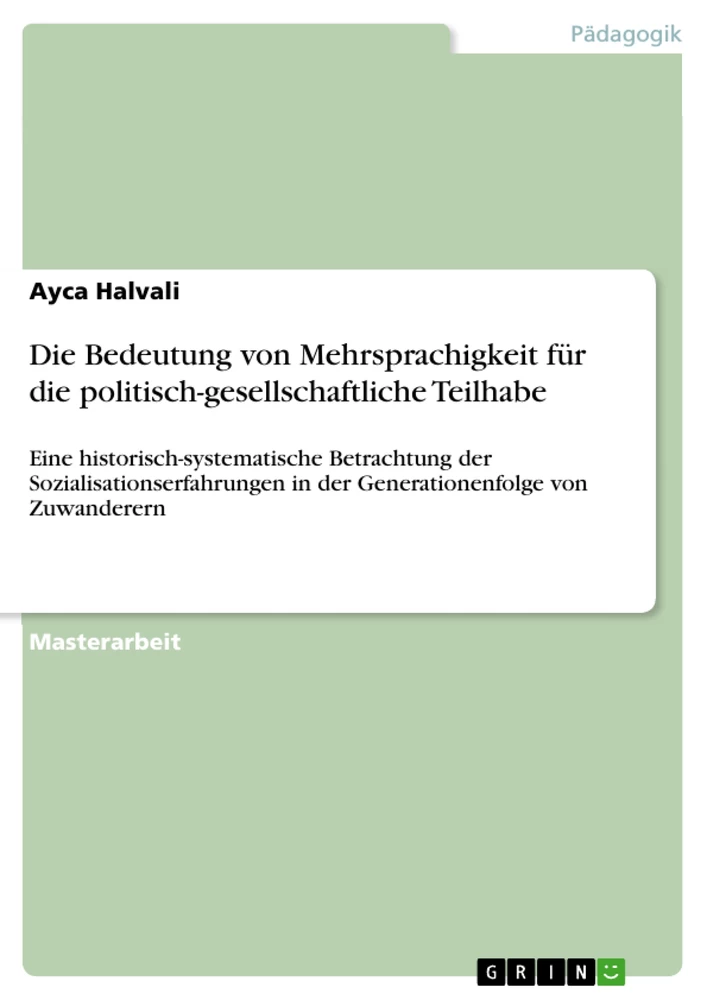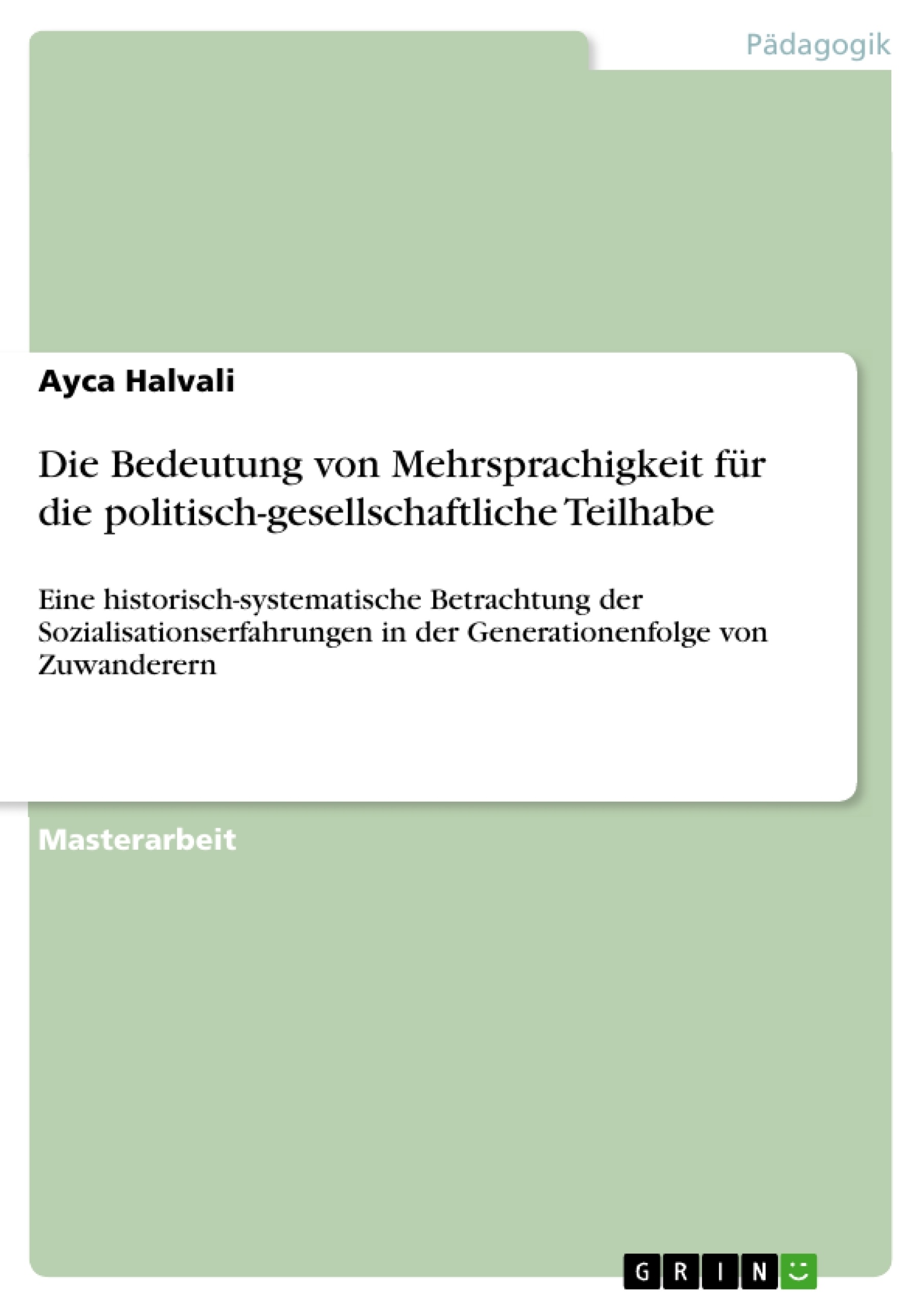In Deutschland haben Einwanderungen, ob es gewollte oder ungewollte waren, ob in Folge von Anwerbungen von (Gast-)Arbeitern, Familienzusammenführungen oder Flucht, faktisch die Gesellschaft in eine multiethnische, multikulturelle und somit vor allem auch mehrsprachige Gesellschaft verwandelt. Seit ihrer Gründung im Jahre 1949 hat die Bundesrepublik Deutschland in jedem Jahr geringstenfalls rund 250.000 Zuwanderer mit unterschiedlichsten Migrationshintergründen untergebracht. Viel Diskussionsbedarf werfen Themen wie Migration von Flüchtlingen, (Spät-)Aussiedlung, Arbeitsmigration, Asylsuchende und die transnationale Migration sowie die Ursachen, Absichten und Folgen der internationalen Migration auf. Wenn es um das Thema Daueraufenthalt von Migranten geht, kann gesagt werden, dass Aussiedler und Spätaussiedler direkt vom Staat politisch anerkannt werden und auch in der Vergangenheit respektiert wurden. Im Gegensatz dazu ist der Daueraufenthalt von Asylanten und Flüchtlingen aus staatlich-politischer Sicht nicht erlaubt. An letzter Stelle seien die Arbeitsmigranten genannt. Für deren Aufenthalt werden Genehmigungen erst seit wenigen Jahren erteilt. Und trotz des Bestehens eines
Daueraufenthaltsgesetzes für bestimmte Zuwanderungsgruppen kommt es noch immer zu Diskriminierungen im Alltag dieser Menschen sowie im Schul- und Bildungssystem und im Berufsleben. Im Hinblick auf das Schulsystem herrscht eine soziale Ungleichheit in Bezug auf die verschiedenen Sprachen, welche die Schüler mit Migrationshintergrund mit sich bringen. Neben der Überalterung sind auch Migrationsbewegungen in Deutschland Faktoren für den konstanten demografischen Wandel. Genau diese Struktur der Gesellschaft demonstriert die komplexe Vielschichtigkeit ihrer Bevölkerungsgruppe. Folglich entstehen soziokulturelle Unterschiede, beispielsweise sprachliche oder religiöse, und damit hängt ein Anpassungs- und Veränderungsdruck auf alle sozialen Institutionen zusammen, vor allem im differenzierten Erziehungssystem.
Zwei- oder Mehrsprachigkeit ist in der heutigen Gesellschaft eigentlich ein erstrebenswertes Ziel der schulischen Bildung. Beispielsweise werden viele Kinder von ihren Eltern bereits
gleich nach der Geburt an bilinguale Kindergärten mit den Sprachen Deutsch und Englisch angemeldet, um überhaupt einen Platz zu bekommen. In vielen Orten sind bilinguale Schulen,
wie beispielsweise deutsch-amerikanische Schulen oder französische Gymnasien, die mit [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Historie der Wanderungen in die Bundesrepublik Deutschland nach 1950
- Aussiedler und Spätaussiedler
- Asylsuchende und Flüchtlinge
- Arbeitsmigranten
- Die Historie der Arbeitsmigration nach dem zweiten Weltkrieg
- Die politische Grenze des Aufenthalts in Deutschland
- Familieneingliederung
- Auswirkungen und Entgegnungen der Zuwanderung
- Aktuelle Situation der Zuwanderer in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der türkischen Zuwanderer
- Zusammenfassung der geschichtlichen Entwicklung der Wanderungen nach Deutschland unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der Beherrschung der Landessprache
- Integration, Assimilation und Partizipation
- Die Definition des Begriffs Integration
- Assimilation Hartmut Essers
- Die Definition des Begriffs Partizipation
- Die Funktionen der Sprache und Mehrsprachigkeit
- Funktionen der Sprache
- Die Definition von Mehrsprachigkeit
- Spracherwerbstypen
- Erstsprache
- Zweitsprache
- Mehrsprachigkeit durch Erst- und Zweitspracherwerb
- Der Prozess des Spracherwerbs
- Code-Switching
- Die Relevanz der Erstsprache für die Entwicklung von Kompetenzen in der Zweitsprache
- Politische Teilhabe durch Sprachvermögen: Politische Bildung als kommunikatives Geschehen
- Begriffsbestimmung und Geschichte der „politischen Bildung“
- Aufgaben und Ziele der politischen Bildung
- Die Bedeutung der Beherrschung der Landes- und der Muttersprache für Zuwanderer aus politischer Sicht
- Sprachkompetenz und die Subsprache Politik, ein Problem hinsichtlich der politischen Teilhabe?
- Politische Integration und Integrationspolitik hinsichtlich der Relevanz der sprachlichen Kommunikation
- Politische Teilhabeformen von Zuwanderern
- Ein Beispiel für eine gelungene politisch-gesellschaftliche Teilhabe der Zuwanderer: Politiker mit Migrationshintergrund
- Fazit und Ausblick: Zur Zukunft von Sprache für eine Verbesserung der politisch-gesellschaftlichen Teilhabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Bedeutung von Mehrsprachigkeit für die politische und gesellschaftliche Teilhabe von Zuwanderern in Deutschland. Sie untersucht, wie sich die Sozialisationserfahrungen in der Generationenfolge von Zuwanderern auf deren Integrations- und Partizipationsmöglichkeiten auswirken. Die Arbeit betrachtet sowohl historische Entwicklungen als auch die gegenwärtige Situation der Zuwanderung, insbesondere am Beispiel der türkischen Gastarbeiter.
- Die Rolle der Sprache in der Integration und politischen Teilhabe von Zuwanderern
- Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit für die kognitive Entwicklung und den Spracherwerb
- Die Herausforderungen der politischen Bildung für Zuwanderer und die Bedeutung der Landessprache und der Subsprache Politik
- Die Auswirkungen von Integrationspolitik auf die Teilhabe von Zuwanderern
- Die Analyse von Beispielen für gelungene politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer historischen Analyse der Wanderungen nach Deutschland seit 1950, wobei verschiedene Gruppen wie Aussiedler, Flüchtlinge und Arbeitsmigranten beleuchtet werden. Insbesondere die Geschichte der türkischen Gastarbeiter und deren Familieneingliederung wird in diesem Kontext detailliert betrachtet. Das zweite Kapitel widmet sich den Begriffen Integration, Assimilation und Partizipation und beleuchtet deren Bedeutung für die gesellschaftliche Teilhabe von Zuwanderern. Das dritte Kapitel untersucht die Funktionen der Sprache und den Einfluss von Mehrsprachigkeit auf die kognitive Entwicklung und den Spracherwerb. Im Fokus stehen die verschiedenen Spracherwerbstypen, der Prozess des Spracherwerbs sowie das Konzept des Code-Switching. Das vierte Kapitel beleuchtet die Relevanz der Erstsprache für die Entwicklung von Kompetenzen in der Zweitsprache.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der politischen Teilhabe von Zuwanderern im Kontext der politischen Bildung. Die Arbeit analysiert die Bedeutung von Sprachkompetenz für die politische Partizipation und betrachtet die Subsprache Politik als Herausforderung. Das sechste Kapitel untersucht die Rolle der Integrationspolitik und deren Einfluss auf die sprachliche Kommunikation von Zuwanderern. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Formen der politischen Teilhabe von Zuwanderern und der Analyse eines Beispiels für eine gelungene politisch-gesellschaftliche Teilhabe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Mehrsprachigkeit, Integration, Partizipation, politische Bildung, sprachliche Kommunikation, Migrationshintergrund, türkische Gastarbeiter, Familieneingliederung und politische Teilhabe. Sie untersucht den Einfluss von Sprache auf die kognitive Entwicklung, den Spracherwerb und die gesellschaftliche Teilhabe von Zuwanderern.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat Mehrsprachigkeit für die politische Teilhabe?
Sprachkompetenz ist die Basis für politische Bildung und Kommunikation. Nur wer die Landessprache beherrscht, kann aktiv an demokratischen Prozessen und gesellschaftlichen Debatten teilnehmen.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Assimilation laut Hartmut Esser?
Integration zielt auf die Einbeziehung in die Gesellschaft unter Wahrung kultureller Identität ab, während Assimilation die vollständige Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft beschreibt.
Warum ist die Erstsprache wichtig für den Erwerb der Zweitsprache?
Eine starke Basis in der Erstsprache (Muttersprache) fördert die kognitiven Fähigkeiten, die notwendig sind, um Kompetenzen in der Zweitsprache (Landessprache) erfolgreich aufzubauen.
Was versteht man unter „Code-Switching“?
Code-Switching bezeichnet den fließenden Wechsel zwischen zwei Sprachen innerhalb eines Gesprächs, was ein typisches Merkmal gelebter Mehrsprachigkeit ist.
Welche Hürden gibt es für Zuwanderer in der politischen Bildung?
Oft stellt die „Subsprache Politik“ mit ihren Fachbegriffen eine Barriere dar. Mangelndes Sprachvermögen kann somit zu einem Ausschluss von politischer Partizipation führen.
Gibt es Beispiele für gelungene politische Teilhabe von Migranten?
Ja, die Arbeit nennt Politiker mit Migrationshintergrund als Vorbilder für eine erfolgreiche Integration und aktive Mitgestaltung der Gesellschaft.
- Citation du texte
- Ayca Halvali (Auteur), 2016, Die Bedeutung von Mehrsprachigkeit für die politisch-gesellschaftliche Teilhabe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345404