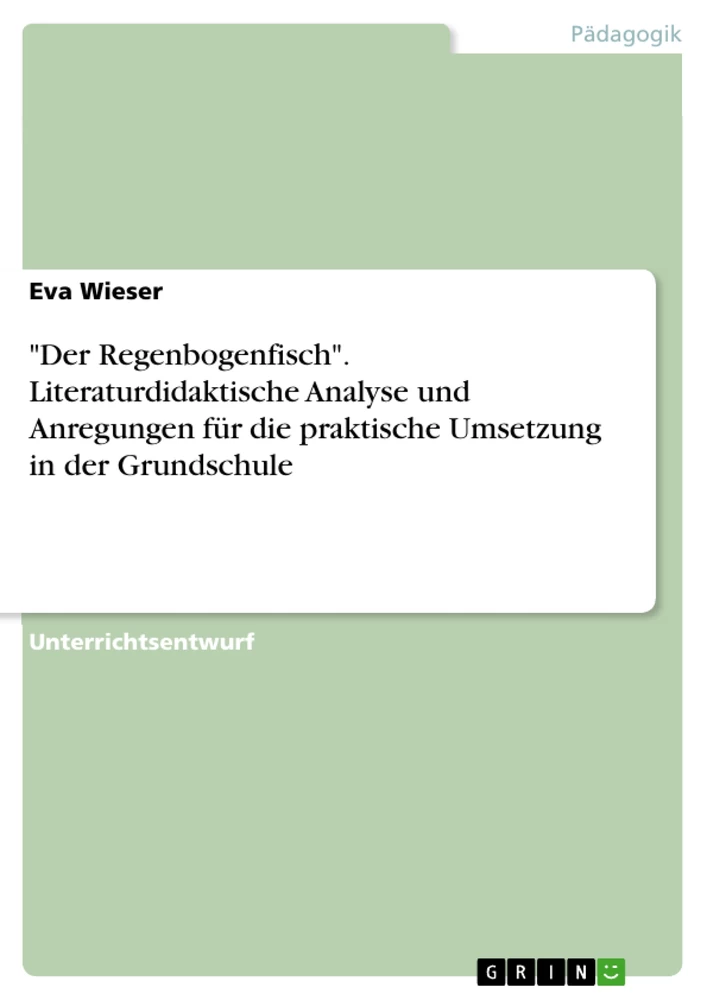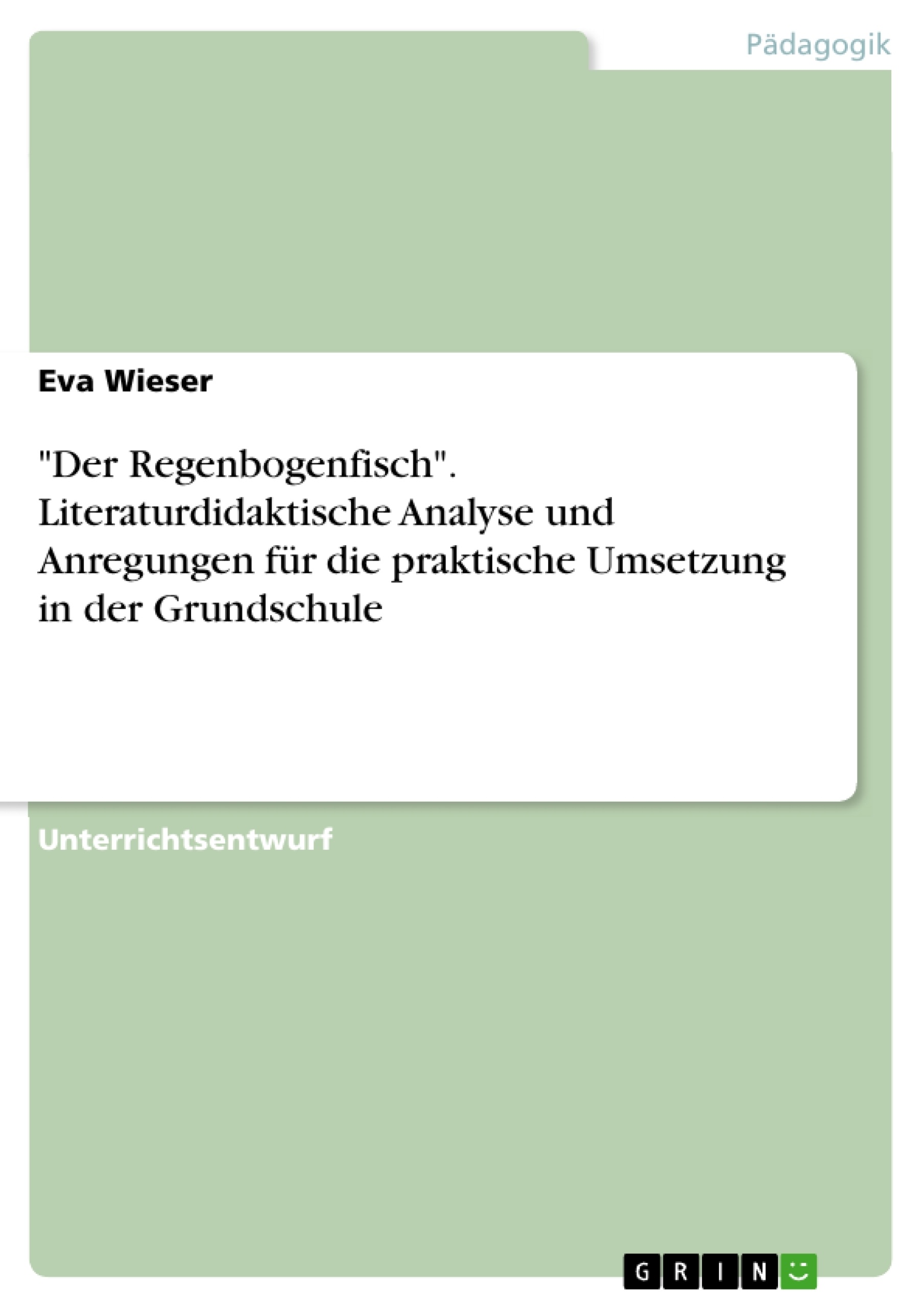Die Geschichte vom „Regenbogenfisch“ wurde in einem Buch künstlerisch durch und von Marcus Pfister verewigt. Es ist eine Erzählung in der literarischen Form der Fabel und gehört somit zur literarischen Gattung der Epik. Das Buch ist farblich so aufgebaut, dass es fast ausschließlich bläuliche Töne enthält. Die Bilder darin laden zum Anfassen ein, da sie zum einen aquarelliert und sehr fein gezeichnet wurden und weil sie zum anderen durch die Glitzerschuppen des Regenbogenfisches besonders ansprechend für Kinder sind. Abgesehen von den überwiegend blauen, türkisenen und grünen Farbtönen glitzern die Schuppen des Fisches in allen bunten Regenbogenfarben. Mimik, Körperhaltung, Blickkontakt und weitere soziale Aspekte werden bereits bei den Illustrationen deutlich, wobei dadurch die Konstellation der Beziehungen unter den Figuren, sowie die äußere und innere Handlung unterstrichen wird. Diese Form des Buches hebt somit von gängigen Büchern ab und wird von vielen Erwachsenen rückwirkend als „Lieblingsbuch der eigenen Kindheit“ bezeichnet.
Betrachtet man die Sprache des Buches etwas genauer, so wird ganz klar ersichtlich, dass sich diese - abgesehen von der optischen Gestaltung des Buches – ebenso von gängigen Fibeln oder Sprachbüchern absetzt. Dieser Unterschied kann jedoch positiv verzeichnet werden, da sie besonders variationsreich und lebendig gewählt wurde.Den Kindern wird durch den Aufbau des Textes, der Wortwahl und sogar der unkomplizierten Syntax das Einprägen des Handlungsablaufes um ein Vielfaches vereinfacht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Sachanalyse
- Vorstellung des Textes
- Kompakte Inhaltszusammenfassung
- Analyse der Handlung
- Interpretation
- Didaktische Analyse
- Begründung der Textauswahl und theoretische Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht
- Ziele für den Literaturunterricht - Kaspar H. Spinner
- Förderung der Lesefreude
- Texterschließungskompetenz
- Literarische Bildung
- Förderung von Imagination und Kreativität
- Identitätsfindung und Fremdverstehen
- Auseinandersetzung mit anthropologischen Grundfragen
- Methodische Analyse
- Eine Möglichkeit der praktischen Umsetzung zum „Regenbogenfisch“
- Vorüberlegungen
- Unterrichtsverlauf
- Entwurf einer Unterrichtseinheit für die 1./2. Jahrgangsstufe
- Stundenthema: Vorstellung des Buches „Der Regenbogenfisch“
- Stundenintention und Lernchancen
- Artikulationsschema
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Geschichte „Der Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister, eine Fabel für Kinder, sowohl in Bezug auf ihre literarischen Elemente als auch in ihrer didaktischen Relevanz für den Unterricht. Der Autor erörtert die Möglichkeiten, die Geschichte im Unterricht einzusetzen, um die Lesefreude, die Texterschließungskompetenz und die literarische Bildung von Schülern zu fördern. Darüber hinaus werden die Themen der Identitätsfindung, des Fremdverstehens und die Auseinandersetzung mit anthropologischen Grundfragen im Kontext der Geschichte beleuchtet.
- Analyse der literarischen Gestaltung des Textes „Der Regenbogenfisch“
- Didaktische Analyse der Geschichte und ihrer Eignung für den Unterricht
- Förderung von Lesefreude und Texterschließungskompetenz
- Entwicklung von Empathie und Perspektiveübernahme
- Auseinandersetzung mit dem Thema Teilen und Freundschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Sachanalyse
- Vorstellung des Textes: Der Text beschreibt die Besonderheiten des Buches „Der Regenbogenfisch“, sowohl in Bezug auf seine visuelle Gestaltung als auch auf seine Sprache. Die farbenprächtigen Illustrationen und die lebendige Sprache machen das Buch für Kinder besonders ansprechend.
- Kompakte Inhaltszusammenfassung: Die Geschichte handelt von einem Fisch, der durch seine schillernden Schuppen einzigartig ist. Sein Stolz führt jedoch dazu, dass er von den anderen Fischen abgelehnt wird. Durch den Rat eines weisen Oktopus lernt er, seine Schönheit zu teilen und findet schließlich wieder Anschluss in der Gemeinschaft.
- Analyse der Handlung: Die einzelnen Abschnitte der Handlung werden analysiert und es werden die Charakterzüge des Regenbogenfisches und die Entwicklung seiner Handlungsweise beleuchtet.
- Interpretation: Der Text interpretiert die Geschichte als Allegorie für die Wichtigkeit des Teilens und der Freundschaft. Der Regenbogenfisch zeigt, dass man nicht egoistisch sein sollte, sondern andere an seiner Freude teilhaben lassen sollte.
Didaktische Analyse
- Begründung der Textauswahl: Der Autor argumentiert, dass „Der Regenbogenfisch“ aufgrund seiner ansprechenden Gestaltung und seiner emotionalen Geschichte ideal für den Unterricht geeignet ist.
- Theoretische Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht: Es werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Geschichte im Unterricht eingesetzt werden kann, um die Lesefreude zu fördern, die Texterschließungskompetenz zu stärken und die Schüler mit wichtigen Themen wie Empathie und Perspektiveübernahme auseinanderzusetzen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die Analyse der Geschichte „Der Regenbogenfisch“, die didaktische Relevanz für den Unterricht, die Förderung von Lesefreude, Texterschließungskompetenz, literarische Bildung, Empathie und Perspektiveübernahme, sowie die Auseinandersetzung mit dem Thema Teilen und Freundschaft.
- Quote paper
- Eva Wieser (Author), 2016, "Der Regenbogenfisch". Literaturdidaktische Analyse und Anregungen für die praktische Umsetzung in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345448