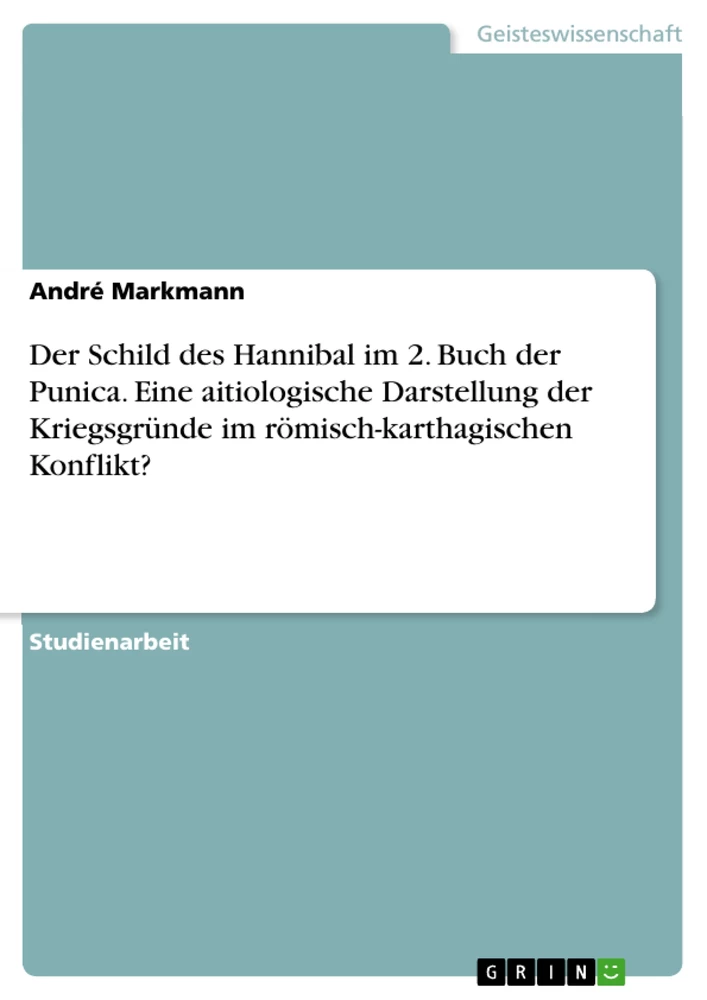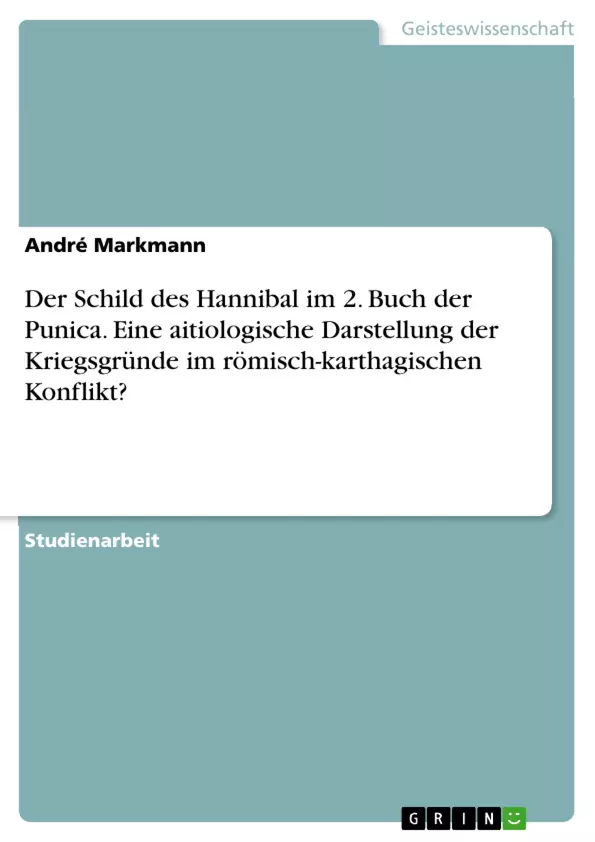Die vorliegende Textstelle ist ein zentraler Bestandteil der Schildekphrasis im 2. Buch der Punica von Silius Italicus. Der karthagische Anführer Hannibal erhält jenen Schild zusammen mit anderen Waffengeschenken von einer verbündeten spanischen Völkerschaft und begutachtet die Abbildungen mit Wohlwollen. Dadurch euphorisiert, schöpft er entschlossen weiteren Mut. Diese Illustrationen werden mittels der Darstellung der Gründung Karthagos durch Dido eingeleitet und gehen nach wenigen Versen in eine äußerst komprimierte Aufarbeitung der bekannten Episode der phönizischen Königin und Aeneas über. Des Weiteren werden auch noch Hannibal selbst, Regulus, das belagerte Sagunt und andere Begebenheiten, auf die im Rahmen dieser Arbeit ebenso nicht weiter einzugehen ist, verbildlicht.
In der unten folgenden Interpretation soll daher analysiert und erarbeitet werden, inwieweit Silius Italicus sich im vorliegenden Passus an den Vorlagen aus Vergils Aeneis (und dabei besonders der Bücher 1-5) orientiert haben könnte, bzw. ob der flavische Dichter gar eine aemulatio mit dem großen Epiker anstrebt und auch, wie sehr diese und andere in der Ekphrasis beschriebenen Begebenheiten als Ursache oder Auslöser der in den Punica vorherrschenden Situation des 2. punischen Krieges fungiert haben könnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung Sil. 2, 414b-415; 2, 420-425
- Interpretation - Sprachliche, stilistische und metrische Analyse
- Schlussteil
- Literaturverzeichnis
- Editionen, Kommentare, Übersetzungen
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Schildekphrasis im 2. Buch der Punica von Silius Italicus. Im Fokus steht die Analyse des Schildes des Hannibal, insbesondere die Darstellung der Gründung Karthagos durch Dido und ihre Begegnung mit Aeneas. Es wird untersucht, inwieweit Silius Italicus sich an den Vorlagen aus Vergils Aeneis orientiert und ob eine aemulatio vorliegt. Darüber hinaus wird geklärt, wie die im Schild dargestellten Begebenheiten als Ursache oder Auslöser des 2. punischen Krieges fungieren könnten.
- Analyse der Schildekphrasis im 2. Buch der Punica
- Vergleich mit Vergils Aeneis und Untersuchung einer möglichen aemulatio
- Interpretation der Darstellung der Gründung Karthagos und der Begegnung Didos mit Aeneas
- Aitiologische Analyse der im Schild beschriebenen Begebenheiten im Hinblick auf den 2. punischen Krieg
- Sprachliche, stilistische und metrische Analyse des Textabschnitts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Kontext der Schildekphrasis im 2. Buch der Punica. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Schildes als Geschenk für Hannibal und der Darstellung der Gründung Karthagos durch Dido. Die Arbeit soll untersuchen, inwieweit Silius Italicus sich an Vergils Aeneis orientiert und ob die im Schild dargestellten Begebenheiten als Auslöser des 2. punischen Krieges fungieren könnten.
Übersetzung 2, 414b-415; 2, 420–425
Dieser Abschnitt bietet die Übersetzung der relevanten Textstellen aus dem 2. Buch der Punica. Es werden die Verse 414b-415 sowie 420–425 vorgestellt, die die Begegnung Didos mit Aeneas und die Abreise des Trojaners beschreiben.
Interpretation - Sprachliche, stilistische und metrische Analyse
In diesem Kapitel wird eine detaillierte Interpretation der ausgewählten Textstellen durchgeführt. Es werden sprachliche, stilistische und metrische Aspekte analysiert, um die Bedeutung der Darstellung der Dido und die Beziehung zwischen der Beschreibung der Gründung Karthagos und der Ereignisse im 2. punischen Krieg zu verstehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Schildekphrasis, aemulatio, aitiologie, Aeneis, Punica, Silius Italicus, Dido, Aeneas, Gründung Karthagos, 2. punischer Krieg, sprachliche Analyse, stilistische Analyse, metrische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was stellt der Schild des Hannibal in den „Punica“ dar?
Der Schild zeigt Szenen der Gründung Karthagos durch Dido, ihre Begegnung mit Aeneas sowie weitere historische und mythologische Begebenheiten der karthagischen Geschichte.
Wer ist der Autor der „Punica“?
Die „Punica“ wurden von Silius Italicus verfasst, einem flavischen Dichter, der in seinem Epos den Zweiten Punischen Krieg behandelt.
Wie bezieht sich Silius Italicus auf Vergils Aeneis?
Silius nutzt die Aeneis als Vorlage für die Dido-Episode, strebt aber eine „aemulatio“ (Wetteifer) an, um die Kriegsgründe zwischen Rom und Karthago aitiologisch zu begründen.
Was bedeutet „aitiological“ in diesem Kontext?
Es bezeichnet die Suche nach den Ursprüngen oder Gründen für den Konflikt, hier dargestellt durch den mythischen Fluch der Dido gegen die Nachkommen des Aeneas.
Welche Funktion hat die Ekphrasis (Bildbeschreibung) im Epos?
Sie dient nicht nur der künstlerischen Ausschmückung, sondern verdeutlicht die Motivation und das Schicksal des Helden, in diesem Fall Hannibals Entschlossenheit zum Krieg.
- Quote paper
- André Markmann (Author), 2013, Der Schild des Hannibal im 2. Buch der Punica. Eine aitiologische Darstellung der Kriegsgründe im römisch-karthagischen Konflikt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345497