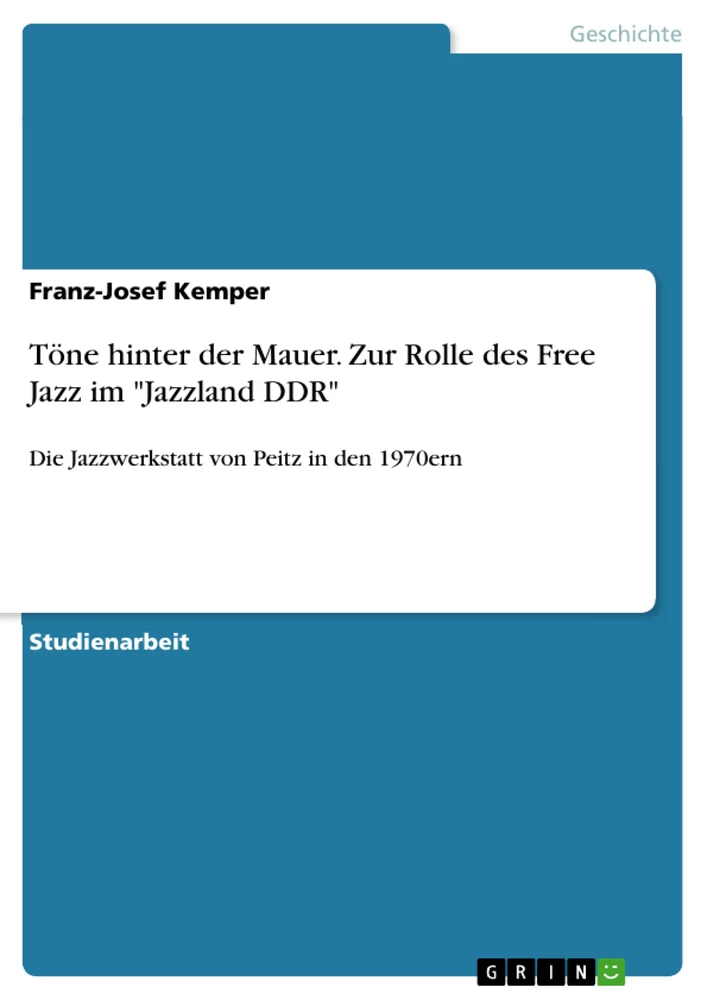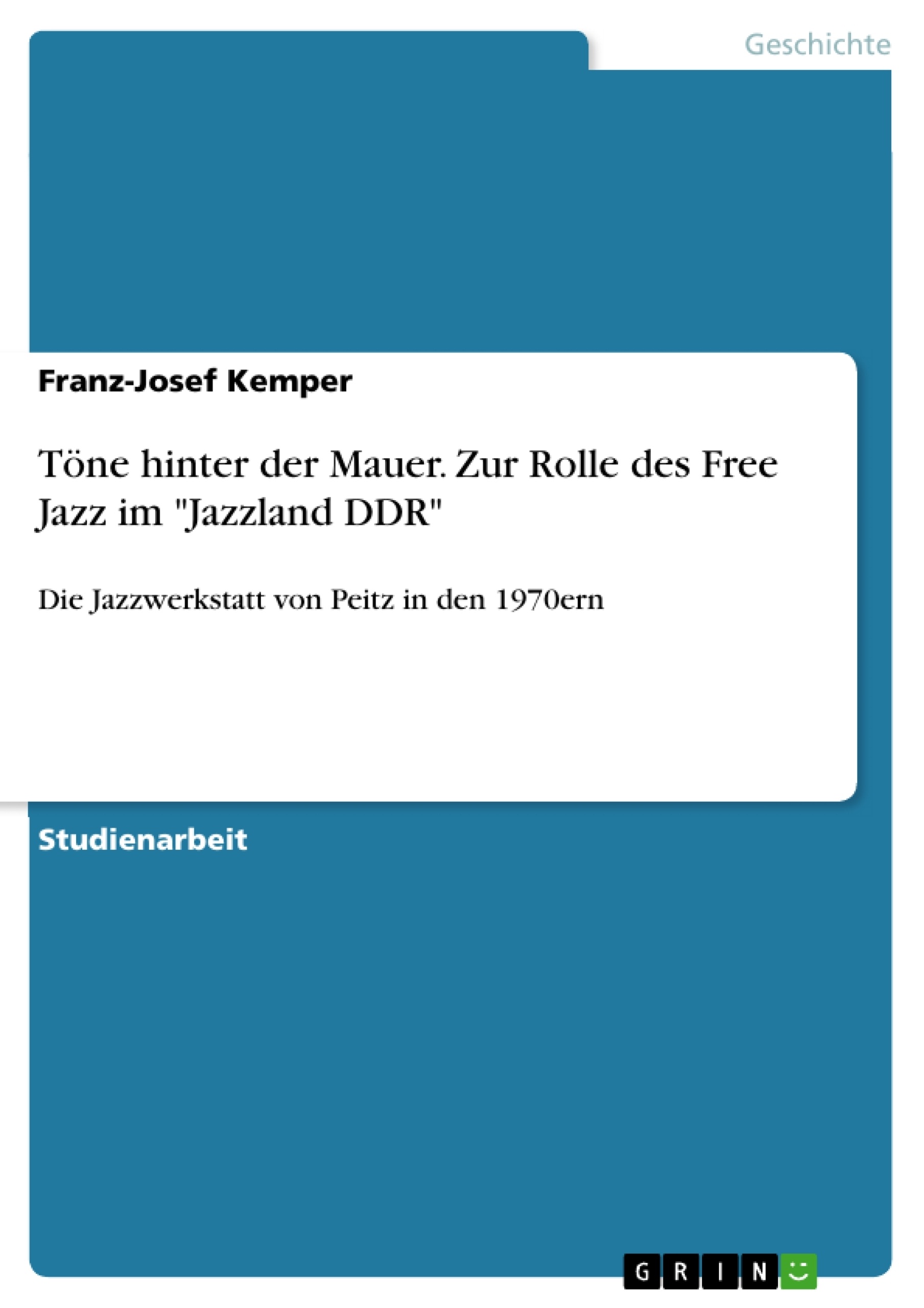Die Musikentwicklung in der ehemaligen DDR war in der Geschichte dieses Staates immer auch eine Geschichte der dortigen populären Jugendkultur. Während sich in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre in der Bundesrepublik eine liberalere Haltung gegenüber den verschiedenen populären Musikrichtungen durchsetzte, versuchten die Verantwortlichen in der DDR den Kulturkonsum der Jugendlichen zu politisieren. Sie schufen zwar kurzfristig größere Freiräume für die Jugendlichen, ohne aber den Kampf gegen die westlich kulturellen Einflüsse aufzugeben. Daraus ergab sich gerade seit den sechziger Jahren ein sozio-kultureller Zickzack-Kurs, der zwischen einer „kontrollierten Freizügigkeit“ und einer starken Unterdrückung hin- und herschlingerte.
Der Einfluss der musikalischen Entwicklung Jugendlicher in Bezug auf diese Bestrebungen war dabei von großer Bedeutung: „Jazz, Blues, Rock oder Pop besaßen emanzipatorischen Symbolwert – sie galten vielen als Medium der Selbstbehauptung und kostbares Gut, das in der von Reglementierung und Mangelwirtschaft gezeichneten Gesellschaft geradezu kultisch verehrt wurde.“ (Rauhut)
Die Trends der westlichen Welt konnten dann auch am „iron curtain“ nicht aufgehalten werden. Daraus entwickelte sich allmählich ein eigener Kult innerhalb des Staatgebietes der DDR mit einer sich immer mehr „verfransenden“ Kultur, die zu Überschneidungen in musikalischer Hinsicht führte.
Diese Arbeit untersucht, wie sich der mit dem westlichen Freiheitsbegriff verbundene Jazz gegen Ende der sechziger Jahre auch in der DDR verbreitete. Es lässt sich sogar belegen, dass die zusätzlichen stilistischen Varianten, die dem alternativen „Way of Life“ musikalisch im Osten hinzugefügt wurden, aus der DDR ein ausgesprochenes „Jazzland DDR“ werden ließen. Mit dem Free Jazz setzte sich dabei eine eigene stilbestimmende Richtung durch. Die Improvisation, ein markantes stilistisches Merkmal des Free Jazz, wurde dabei mit den Kennzeichen von Freiheit, Protest und Provokation assoziiert und diente damit als weiterer idealer Nährboden, wenn auch staatlicherseits unbeabsichtigt, für die Jugendbewegung in der DDR. Allerdings spaltete sich „die Szene […] in Underground und Hochkultur“ (Rauhut). Der methodische Focus dieser Arbeit soll entsprechend dem Seminarthema oral history hierbei auf Protagonisten und Zeitzeugen mit ihren Gedanken, Meinungen und Einschätzungen liegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Forschungslage und Fragestellung
- 1.2. Zur Jazz-Rezeption durch Jugendliche in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR (1945-1969)
- 2. Die Entwicklung des Free-Jazz hin zur Jazz-Werkstatt von Peitz
- 2.1. Free Jazz: Was er ist und was er will
- 2.2. Die Jazzwerkstatt von Peitz zwischen 1972 bis 1982
- 2.3. Die offiziellen Reaktionen der SED
- 2.3.1. Ärger um Honecker in der Endlosschleife
- 2.3.2. Das "grausige Ende" von Peitz (1982)
- 2.4. Die inoffiziellen Folgen
- 2.4.1. Das Ost-West-Verhältnis aufgrund der Kontakte in Peitz
- 2.4.2. Zwischen innerer Emigration und Subversion?
- 3. Resumeé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung des Free Jazz in der DDR, insbesondere in den 1970er Jahren, und fokussiert dabei auf die Rolle der Jazzwerkstatt Peitz. Ziel ist es, zu verstehen, wie sich der Free Jazz, als Ausdruck westlicher Freiheitsideale, in der DDR etablierte und welche Bedeutung er für die Jugendkultur und das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft hatte.
- Der Einfluss des Free Jazz auf die Jugendkultur in der DDR
- Die Ambivalenz der DDR-Staatspolitik gegenüber dem Free Jazz
- Die Bedeutung der Jazzwerkstatt Peitz als Zentrum der Free-Jazz-Szene in der DDR
- Die kulturelle und politische Bedeutung der Improvisation im Free Jazz
- Die Auswirkungen des Free Jazz auf das Ost-West-Verhältnis
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und erläutert die Forschungslage sowie die Fragestellung der Arbeit. Es beleuchtet die Rezeption von Jazz durch Jugendliche in der DDR in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt die besondere Bedeutung von Jazz als Symbol für Individualität und Selbstbehauptung in einer Gesellschaft geprägt durch politische Kontrolle und Mangelwirtschaft auf.
Kapitel 2 widmet sich der Entwicklung des Free Jazz in der DDR, betrachtet seine stilistischen Merkmale und beschreibt die Rolle der Jazzwerkstatt Peitz als einflussreiches Zentrum der Free-Jazz-Szene. Die Reaktion der SED auf den Free Jazz wird mit besonderem Fokus auf den Konflikt um die Jazzwerkstatt Peitz beleuchtet.
Kapitel 3 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und reflektiert die Bedeutung des Free Jazz für die DDR-Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Free Jazz, Jazzwerkstatt Peitz, DDR, Jugendkultur, Staat, Politik, Improvisation, Freiheit, Protest, Ost-West-Verhältnis, Subversion, Musikgeschichte, Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatte der Free Jazz für die Jugend in der DDR?
Free Jazz galt als Medium der Selbstbehauptung und besaß emanzipatorischen Symbolwert. Er wurde mit Freiheit, Protest und Provokation assoziiert.
Was war die Jazzwerkstatt Peitz?
Die Jazzwerkstatt Peitz war zwischen 1972 und 1982 ein zentraler Treffpunkt der Free-Jazz-Szene in der DDR, der nationale und internationale Musiker sowie ein großes jugendliches Publikum anzog.
Wie reagierte die SED auf die Free-Jazz-Bewegung?
Die Reaktion war ein „Zickzack-Kurs“ zwischen kontrollierter Freizügigkeit und starker Unterdrückung. 1982 wurde die Jazzwerkstatt Peitz staatlich unterbunden.
Warum wurde Improvisation als politisch empfunden?
Die musikalische Improvisation wurde als Bruch mit starren Regeln und als Ausdruck individueller Freiheit verstanden, was im Gegensatz zur reglementierten Gesellschaft der DDR stand.
Welchen Einfluss hatte der Jazz auf das Ost-West-Verhältnis?
Der Jazz förderte Kontakte über die Mauer hinweg. In Peitz trafen sich Musiker und Fans aus beiden Teilen Deutschlands, was den kulturellen Austausch trotz politischer Barrieren ermöglichte.
- Citar trabajo
- Franz-Josef Kemper (Autor), 2016, Töne hinter der Mauer. Zur Rolle des Free Jazz im "Jazzland DDR", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345514