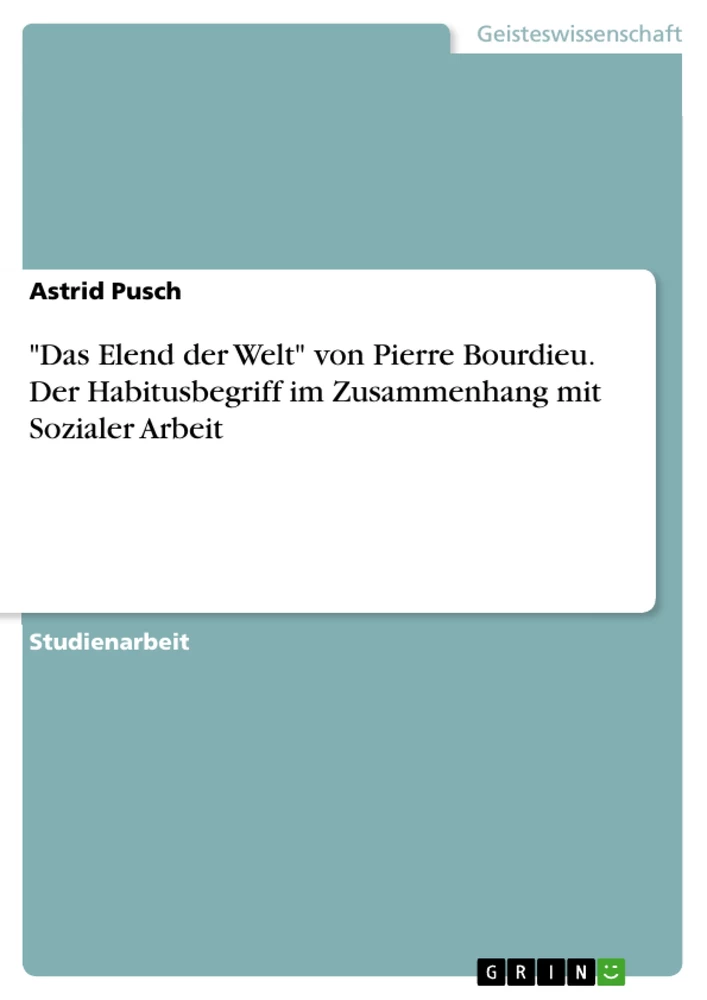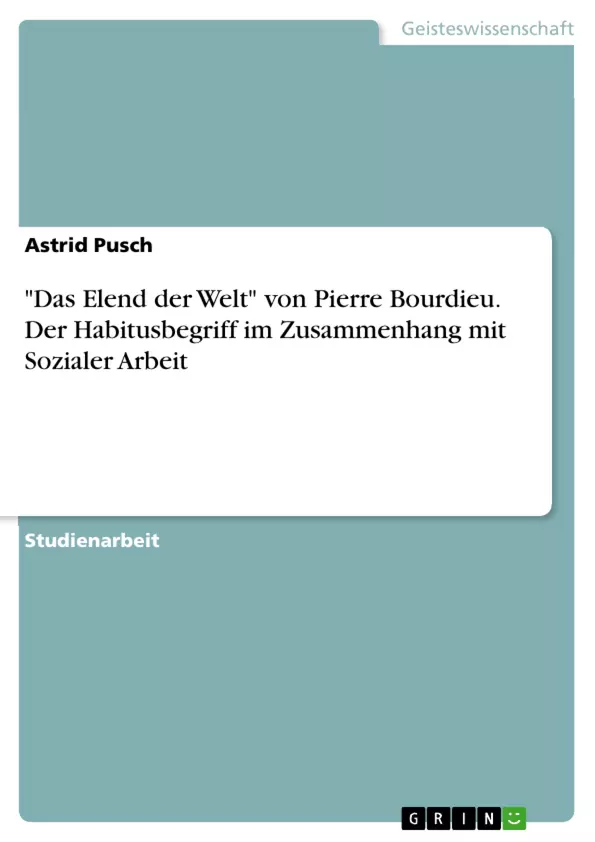Diese Seminararbeit handelt von Pierre Bourdieu’s Werk „Das Elend der Welt“. Einleitend wird auf die Hintergrundynamik zu diesem Werk aufmerksam gemacht. Dabei zeigt sich, dass es sich dabei nicht – wie man denken könnte – um Zustände der Dritten Welt handelt, sondern um herrschende europäische Verhältnisse.
Dazu zählt das Elend verschiedener Personengruppen, wie „Schüler, Lehrer, Kleinkriminelle, Richter und Polizisten, Gewerkschafter und Angestellte, Mieter und Hausmeister, junge und alte Menschen“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung 1998, o.S.).
Nachdem der Aufbau des Werkes geschildert wurde, wird auf den Habitusbegriff aufmerksam gemacht, der in diesem Werk eine zentrale Rolle einnimmt. Im Anschluss daran wird der Zusammenhang zwischen dem Habitus und der Sozialen Arbeit aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund zum Werk „Das Elend der Welt“
- Habitus
- Habitus und Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Pierre Bourdieu's Werk „Das Elend der Welt“ und untersucht den Einfluss des Habitus auf soziale Strukturen und insbesondere auf den Bereich der Sozialen Arbeit.
- Die soziologische Analyse von Vorstädten in Paris
- Der Habitusbegriff als Vermittlungsinstanz zwischen objektiven gesellschaftlichen Bedingungen und subjektivem Handeln
- Die Rolle des Habitus in der Gestaltung von Lebensverhältnissen, Perspektiven und Erfahrungen
- Der Zusammenhang zwischen dem Habitus und sozialen Ungleichheiten
- Die Bedeutung des Habitus für die Praxis der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert den Fokus der Seminararbeit auf Pierre Bourdieu's Werk „Das Elend der Welt“. Sie stellt klar, dass es sich nicht um Armut in der Dritten Welt handelt, sondern um die schwierigen Lebensumstände verschiedener Personengruppen in Europa, wie z.B. Schüler, Lehrer, Kleinkriminelle, etc.
Hintergrund zum Werk „Das Elend der Welt“
Dieser Abschnitt beleuchtet die soziologische Studie „Das Elend der Welt“ als Interviewband über Vororte von Paris. Er beschreibt die Methodik des Verstehens, die der Studie zugrunde liegt, und die Art und Weise, wie die Interviews durchgeführt wurden.
Habitus
In diesem Kapitel wird der Habitusbegriff als Vermittlungsinstanz zwischen objektiven gesellschaftlichen Bedingungen und subjektivem Handeln definiert und erläutert. Es werden verschiedene Definitionen des Habitus aus unterschiedlichen Perspektiven vorgestellt.
Habitus und Soziale Arbeit
Dieser Abschnitt soll den Zusammenhang zwischen dem Habitus und der Sozialen Arbeit aufzeigen. Er beleuchtet die Bedeutung des Habitus für die Gestaltung von Lebensverhältnissen, Perspektiven und Erfahrungen und wie er soziale Ungleichheiten beeinflusst.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Seminararbeit sind: Pierre Bourdieu, „Das Elend der Welt“, Habitus, Sozialisation, soziale Ungleichheit, Soziale Arbeit, methodisches Verstehen, Interviewstudie, Lebensverhältnisse, Perspektiven, Erfahrungen, und Handlungsschemata.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Bourdieus Werk „Das Elend der Welt“?
Es ist eine soziologische Studie über die schwierigen Lebensbedingungen verschiedener Bevölkerungsgruppen in Europa, insbesondere in den Vorstädten von Paris.
Was versteht Pierre Bourdieu unter dem Begriff „Habitus“?
Der Habitus ist ein System dauerhafter Dispositionen, das als Vermittlungsinstanz zwischen gesellschaftlichen Bedingungen und individuellem Handeln fungiert.
Warum ist der Habitusbegriff für die Soziale Arbeit wichtig?
Er hilft zu verstehen, wie soziale Ungleichheiten die Lebensverhältnisse und Handlungsschemata von Klienten prägen und wie darauf professionell reagiert werden kann.
Welche Personengruppen werden in der Studie interviewt?
Dazu zählen unter anderem Schüler, Lehrer, Kleinkriminelle, Polizisten, Angestellte und Hausmeister.
Was ist das „methodische Verstehen“ in Bourdieus Werk?
Es beschreibt den Forschungsansatz, durch tiefgehende Interviews die subjektive Sicht der Betroffenen im Kontext ihrer objektiven Lebenslage zu begreifen.
- Quote paper
- Astrid Pusch (Author), 2015, "Das Elend der Welt" von Pierre Bourdieu. Der Habitusbegriff im Zusammenhang mit Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345575